Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Die Inexistenz des Anorganischen
Kapitel I: Organik
Kapitel II: Anorganik
Kapitel III: Anorganisch-Werden
Einführende Schlussbemerkung: Maschinenlärm und Schizo-Kybernetik
Literaturverzeichnis
Einleitung – Die Inexistenz des Anorganischen
„Kurz, es geht darum, ein klein wenig Blut des Dionysos in den organischen Adern Apollons fließen zu lassen.“[1]
Sokrates ist ratlos; und wie sollte es auch anderes sein. Am Strand hat er das weiße Gebilde gefunden – vielleicht ist es Holz, oder es imitiert dieses bloß. Er kann nicht anders als die kunstvolle Ausführung, die meisterliche Verarbeitung des Fundstücks zu bewundern, ohne, dass er dessen Zweck erkennen kann; als sei sein Sinn unter der Oberfläche eingeschlossen, der gefrorene Sinn des Baumeisters – vielleicht eines fernen Landes für eine ebenso ferne Praxis. Die Wellen brechen sich krachend über dem Sand, die Seeluft steigt ihm in die Nase und hört nicht auf in den Lungen weiter zu zittern. Ohne Gewalt steigt ein Gedanke in ihm auf, der beginnt sich unsanft Raum zu verschaffen. Die unzähligen Waschungen der Wellen, lange – vielleicht unendlich lange – Begegnungen mit Kiesel, Algen und Salz hatten die Hand des Werkmeisters geführt; der Ozean selbst, hatte diesem Stück seinen Schliff aufgesetzt. Der Kollaps von τέχνη und φύσις; sie stürzen ineinander – Kernfusion – viel zu viel Energie – inkommensurable Intensität – Aporie. Sokrates tut, was er tun muss, um nicht wahnsinnig zu werden. Er wirft das Stück zurück und verlässt die Szene; Valérys Version des verpassten Anorganisch-Werdens Sokrates‘.[2] Und da sind all die verpassten Gelegenheiten; wie Simmels Henkel, der die intime Beziehung des Objekts mit dem Menschen ausmacht und uns die Dinge darreicht – wie „der Arm, den die eine Welt ausstreckt – mag es die reale, mag es die ideale sein – um die andere zu ergreifen und an sich zu schliessen und sich von ihr ergreifen und an sich schliessen zu lassen.“[3] Heterogenese, maschinelle Gefüge – alles scheint schon zum Greifen nahe, wenn nicht die Form sie der Homogenität Preis geben würde. Denn ohne sie – ohne die notwendige Harmonie der Form – könnte man vielleicht den großen Gedanken im Anschluss an Simmel denken; dass wir selbst Henkel sind, einer Welt hingereicht, von der wir uns nicht mehr unterscheiden; unpersönlich und anorganisch – als gäbe es ein Leben, dass nicht organisch ist und nach uns Organismen greift. Das Problem der Philosophie besteht indes darin, dass es für sie, das Anorganische noch gar nicht gibt.
Es ist jedoch noch ein Einmischen möglich in diese verpassten Gelegenheiten – man muss nur in den Entstehungsherd einsteigen. Man muss die virtuellen Potentiale der Gedanken jenseits ihrer Geschichte freilegen, ihr Werden[4]; das, was Heidegger einst das Ungedachte im Gedachten nannte[5], den virtuellen Schatten jedes aktuellen Gedankens. Und man muss an dem Punkt einsteigen, an dem die Singularitäten auftraten, die ein System in eine Richtung kippen ließen, jene Konstellationen, die eine Entscheidung erzwangen – nicht um eine Gegenthese zu dieser zu vertreten, sondern um aus der Entscheidung selbst einen Akt zu machen, der nicht definiert, sondern öffnet; das heißt nicht, sie umkehren, sondern sie aufzuheben, um auf dem Feld, auf dem sie stattfand, andere Entscheidungen möglich zu machen, die nicht in die binäre Opposition dieser faktischen Entscheidung fallen. Man muss weder ja noch nein zum Organismus sagen, sondern sehen, wie er aufgetaucht ist und was sich inmitten, zwischen und an seinen Rändern abspielt und nicht von ihm kontrolliert werden kann. Diese Kräfte, die beständig versuchen, den Organismus zu stürzen, geben Aufschluss über das anorganische Leben des Gilles Deleuze. Aber, so wird man einwenden: ‚Deleuze geht überhaupt nicht so vor‘ – und man hat Recht. Aber, wird man hinzusetzen: ‚Deleuze erwähnt das anorganisch Leben überhaupt nur eine Hand voll Mal in seinem gesamten Werk‘ – und abermals hat man Recht. Aber, und das ist entscheidender, hat man Recht, wenn man sagt, dass Deleuze der Philosoph des Anorganischen ist. Nicht, weil er es unentwegt beim Namen nennt, sondern weil er ständig von ihm und vielleicht überhaupt von nichts anderem spricht. Seine ganze Philosophie baut in ihren Aussagen, aber auch im Stil auf jenen intensiven Differenzen, den maschinellen Gefügen, organlosen Körpern und Rissen der Zeit und des Raumes auf, die das anorganische Leben sind. Und wenn er es nicht beim Namen nennt, dann genau deswegen, weil es das Wesen des Leben, das immer ein Leben, ist, nicht annektiert werden zu können, nicht einmal von einem Begriff. Aber, wird man abermals einwenden: ‚Man kann doch nicht über etwas reden, was sich dem Reden wiedersetzt‘ – und vielleicht hat man Recht, vielleicht auch nicht, aber zumindest trifft man damit den Kern der Frage. Man kann noch nicht vom Anorganischen sprechen, weil es für die Philosophie noch nicht existiert. Sie hat noch keine Sprache für das Anorganische, außer jene Begriffe, die aus der Negation des Organischen entstanden sind, und nur zur Spezifizierung des Organischen dienen. Anorganisch = organisch; das bezeichnet den problematischen Horizont, nicht seine Auflösung.
Aristoteles und Kant sind die Vorläufer dieses Problems und der modernen Lösungen. Mit ihnen kommt der Organismus nicht nur als Gegenstand, sondern gleichzeitig und verwoben als Ideal und Bild des Denkens auf. Besonders Aristoteles Anspruch, die metaphysischen Spekulationen mit den empirischen Naturwissenschaften des Lebens zu vereinen, bildet nicht nur die methodische Grundlage für De Anima, sondern wird auch ein organisches Paradigma begründen, welches sich in der Gegenwart fortsetzt. Er wird durch den sôma organikon, der durch die psychḗ vereint wird, das Bild einer notwendigen Zweck-Mittel-Relation von Einzelnem und Ganzem einführen. Diese wird er jedoch durch einen mereologischen Trick asymmetrisch machen, um Hierarchien ins Leben einzuführen.
Obwohl Kant die Zweck-Mittel-Relation von Einzelnem und Ganzen erben wird, wird er das Gedankengebäude kritische beziehungsweise transzendentalphilosophisch wenden, indem er die Prinzipien des Organismus in regulative Reflexionsmaximen der Urteilskraft wandelt; Kritik der Urteilskraft. Der transzendentale double bind Kants ist wiederum doppelt – als Bild des Denkens und des Organismus. Nicht nur das inhärente Telos, Selbsterhaltung, Gleichgewicht, Zweck-Mittel-Relation von Einzelnem und Ganzem, sondern auch die Autopoiesis bauen auf der retrospektiven Annektierung ihres Prozesses durch das Produkt auf – die organischen Differenzen der Produkte überlagern die nicht organischen (intensiven) Differenzen, die sie erst hervorbrachten. Eine Strategie, die sich im Schatten Kants auch in der Phänomenologie und Leibphilosophie wiederfinden lässt. An den Rändern, den fliehenden Linien der organischen Dogmatik wird man überall nach den Brücken suchen müssen, die die Ansprüche in sich tragen, nicht um diese negativ gegen die Dogmatik zu wenden, sondern aus ihnen eine affirmative Fluchtlinie zu machen; die ausgeschlossenen Kreaturen, denen das Leben versagt bleibt, die Dynamiken, die sich nicht annektieren lassen, die Kämpfe gegen das Außen der Definitionen, das beständig eindringen will.
Fritz Lieber beschreibt in seiner Erzählung Der schwarze Gondoliere bereits eine seltsame Form des Lebens, die auf den ersten Blick das organische Paradigma beunruhigt. Die Menschheit richtig sich selbst zu Grunde, in Kriegen um den Treibstoff für ihre allgegenwärtigen Maschinen. Plötzlich zeigt sich jedoch, dass das Öl selbst einen Willen besitzt, der die Welt in den Abgrund reißt, während sie der amorphen Kreatur, wie dem objet a, hinterher läuft. Man kennt solche Erzählungen und Kreaturen – es ist eben nicht so, als spräche man nicht über das anorganische Leben – man nennt es jedenfalls häufig beim Namen, sonders in jüngster Zeit. Doch dieses Sprechen, bedeutet noch nicht, dass es existiert. Besonders die Object-Oriented-Philosophy Graham Harmans und der Neo-Vitalismus Manuel DeLandas und Jane Bennets versuchen die Idee Deleuze‘ wieder produktiv aufzugreifen, um eine Philosophie zu schaffen, die der Produktivität der Materie und den Dingen gerecht wird.[6] Harman wird dafür die Dinge/objects – welche er in der Philosophiegeschichte immer unterdrückt sieht – wieder in den Fokus rücken und versuchen. Er konzipiert Dinge als Klasse von Seienden, welche durch ihre Autonomie kein Bewusstsein zur Legitimation, noch notwendig organische Lebewesen brauchen, um zu sein, da sie sich gegenseitig bestimmen konstituieren oder determinieren können. Diametral entgegen spricht sich DeLanda für das Leben der Materie aus, welches nicht in den aktualen Dingen, sondern durch die virtuellen Strukturen stattfindet, welche die aktualen Zustände erst ermöglichen. Ebenso wie Jane Bennett ist er daher versucht, der Materie nicht nur eigenes produktives Potential, sondern auch eine gewisse teleologische Unvorhersehbarkeit oder Spontanität zuzuschreiben. Die Bewegung Harmans genauso wie die DeLandas und Bennetts richtet sich auf das Leben des Anorganisch und es wird noch zu fragen sein, ob sie damit das Anorganische erschaffen, oder es lediglich unter das Paradigma des Organischen subsumieren, indem sie ihm die Eigenschaften dieser aufprägen.
Erst dann – auf diesem Feld der Organismen, auf dem die Neovitalisten mit den Kantianer, um die Produktivität der Materie streiten und in der Aristoteliker mit den Object-Oriented-Philosophers sich zum Schulterschluss für eine einheitliche Substanzontologie verbünden; erst auf diesem dystopischen Feld von umkämpften und verlorenen Theorien, kann Deleuze seinen Science Fiction Roman schreiben.[7] Er schreibt sein ganzes Werk lang, diese Romane vom Unmöglichen, die keine Geschichten von dem sind, dass nie sein wird, sondern Fiktionen von dem, was seine eigenen Bedingungen noch nicht geschaffen hat. Darin liegt doch die Stärke der Science Fiction Literatur, dass sie gar nicht versucht abzubilden oder vorherzusagen. Sie ist nicht analytisch, sondern konstruktiv. Man fragt nicht nach dem Wesen der aktualen Welt oder der derzeitigen Situation, sondern im Gegenteil, versucht man die Welt auf ihren virtuellen Potentialen neu aufzubauen, und fragt nur nach ihrer Konsistenz. Man entwirft Welten, indem man Elemente der Bestehenden herauslöst und anders zusammenschließt, ihnen andere Funktionen zukommen lässt, schaut, wie sie mit anderen Elementen interagieren, kurz, indem man andere Maschinen entwirft, und sie laufen lässt. Asimov fragt, was wäre, wenn die menschliche Intelligenz nichts Besonderes wäre und auch Roboter diese erlangen könnten? Und schon ist der Gedankenstrom nicht mehr zu halten – diese Frage, die nur ein Element verschiebt, erschafft ganze Universen. Was wäre, wenn wir im All nicht allein wären, wie Leinster fragt oder – viel erschreckender – was, wenn es nichts außer uns da draußen gäbe, wie Clark einwirft. All diese Fragen sagen etwas über das Reale aus, das nicht mit der Realität zusammenfällt, oder über die Virtualität, die nicht mit der Aktualität deckungsgleich ist. Deleuze ist weder ein Prophet, noch ein Futurologe, sondern ein Ingenieur oder Hacker[8] – er ist Case aus Gibsons Neuromancer.[9] Er greift in die Eingeweide der Aristotelischen Philosophie und schließt das Hirn über den Darm an die Fußsohlen – mal sehen was geschieht. Monströse und nicht entelechiale Philosophie. Er nimmt Kants implizite Lösung für den Streit der Fakultäten und entfernt das geheime Element, dass sie eint, mal sehen was geschieht. Asymmetrische und disjunktive Synthesen. Er zieht die Freudsche Maschine des Todestriebes bin zum letzten Anschlag auf – jetzt rast sie los, überschlagt sich, aber bleibt nicht liegen. Die Wiederholungen des Todestriebes sind so eilig und so schnell, dass sie die Identität des zu wiederholenden Anfangs mit sich reißen. Deleuze entfernt den Ursprung aus der Todestriebmaschine und sie beginnt mit unendlicher Geschwindigkeit zu laufen, indem sie die transzendentale Illusion der Entropie abwirft. Und dann steht man da; in einer Welt, in der alles einen Zug ins Anorganische hat, ohne, dass es ein Ursprüngliches Dekontrahiertes wiederholt, sondern selbst Schöpfung von beständig Neuem wird. Anorganisches Leben. Nichts kann dieses Leben, diese Risse der reinen leeren Form der Zeit mehr aufhalten, nicht einmal Freuds bestehen auf der Integrität der Ego-Triebe, die jetzt gegen sich aufbegehren. Die Rekonstruktion des Deleuzeschen Science Fiction Romans über das Anorganische Leben wird daher das Ende bilden – von Freuds Todestrieb zu Deleuze transzendentalen Todestrieb, vom persönlichen zum unpersönlichen Tod, vom organischen zum anorganischen Leben.
Kapitel I – Organik
„Einzusehen versuchen, daß dieser große Gerichtsorganismus gewissermaßen ewig in der Schwebe bleibt und daß man zwar, wenn man auf seinem Platz selbständig etwas ändert, den Boden unter den Füßen sich wegnimmt und selbst abstürzen kann, während der große Organismus sich selbst für die kleine Störung leicht an einer anderen Stelle – alles ist doch in Verbindung – Ersatz schafft und unverändert bleibt, wenn er nicht etwa, was sogar wahrscheinlich ist, noch geschlossener, noch aufmerksamer, noch strenger, noch böser wird“[10]
Obwohl es ihn schon vorher gab[11], wird der Organismus als Prinzip erst mit Aristoteles geboren. Und doch taucht er bei Aristoteles nirgends auf[12], hat noch keinen Namen und wirkt doch durch und zwischen den Strata der De Anima.
Gerade diese Schrift, deren Originaltitel Περὶ Ψυχῆς in der Zeit verloren gegangen ist[13], nimmt eine wirkgeschichtliche wie werkimmanente Sonderrolle in Aristoteles Kanon ein. Es ist ein Werk von Brüchen und Überschneidungen, vollgesogen von den Landschaften, Pflanzen und Tieren, in denen er zu Hause war, ebenso wie den Hallen, die Aristoteles errichten ließ. Er hatte die Akademie Platons verlassen, um in späten Jahren zurückzukehren und seine eigene Schule zu gründen, das Lyceum. Die Zwischenzeit verbrachte er in den Heiden, Wäldern und Bergen um die Ägäis, die Natur beobachtend, beschreibend und klassifizierend. Die Wurzel seiner Naturphilosophie hat hier ihren Sitz – er trägt das Erbe der Akademie in die Landschaften.[14] Diese Parallelbewegung führt ihn einerseits weg von Platon und zur Grundlegung seiner letzten Prinzipien, welche später den Titel μετά φύσις tragen werden[15] und gleichzeitig zur naturwissenschaftlichen Beschreibung und Klassifizierung, wie sie sich in den biologischen Werken[16] niederschlagen. In De Anima treffen die Beschreibungen von Form, Kausalität, Substanz und Akzidens des Metaphysikers Aristoteles teils vermittelt, teils unvermittelt auf die Beschreibungen der Physiologie und Verhaltensweisen der Tiere und Pflanzen des Naturforschers Aristoteles. In diesem double bind von metaphysisch-theoretischer Konzeption und empirisch-wissenschaftlicher Praxis[17] ergeben sich nicht zufällig Spannungen, Hohlräume und Synergien.
Bereits der Aufbau spiegelt diese Spannung oder Resonanz wider. Der erste Teil stellt die Intention des Werkes vor, die gleichzeitig metaphysisch wie empirisch formuliert ist: die Suche nach dem Prinzip des Lebens ψυχή (psychḗ).[18] Dabei wird das Projekt zunächst ex negativo bestimmt im Absetzen von den klassischen Definitionen von psychḗ von Anaxagoras bis Platon. Obwohl er sie alle fast restlos verwerfen wird, entdeckt er durch die Kritik den Impetus dieser Theorien wieder. Für die Atomisten war psychḗ jene Kraft, die Atome zusammenstoßen, binden und sich abstoßen lässt. Während sie für Anaxagoras und Empedokles jenes eine Prinzip darstellte, dass den Kosmos zusammenhält und somit selbst nicht veränderlich sein kann, begriffen die Pythagoreer sie als abstraktes Mathem, welches das Universum unterzieht und ordnet. In all diesen Fällen hat die psychḗ eine aktive und ordnende Rolle, ohne selbst unter diese Ordnung zu fallen. Damit steckt Aristoteles den methodischen Rahmen ab: die psychḗ muss sich durch die Dynamiken und Verhaltensweisen beschreiben lassen (empirisch), die sie verursacht, muss aber gleichzeitig unabhängig von diesen Dynamiken gedacht werden (metaphysisch). Der methodologische Anspruch ist damit überbordend; man beschreibt nicht nur, dass psychḗ ist, sondern auch wie sie ist und damit auch was sie ist. Die Untersuchung wird also seine eigenen Bedingungen einfangen müssen, die ihr notwendig bereits vorausgehen. Aristotelischer Double Bluff.
Besonders deutlich zeigt sich diese Spannung der metaphysisch-empirischen Ausrichtung in der Sonderstellung des Lebens, die Aristoteles ihm philosophisch einräumen will, im Gegensatz zum Sein. Es folgt aus der Methodologie des ersten Buches, dass psychḗ nur durch seine Phänomene beschrieben werden kann. Insofern diese aber nur im Sein oder als Seiende erscheinen können, wird man das Leben nur in den Termen des Seins beschreiben können, d.h. ontologisch. Auch wenn Aristoteles praktisch die psychḗ in Termen ausdrückt, die ihr nicht selbst entspringen, sondern ontologische Kategorien sind, bleibt die Frage, ob dies theoretisch mit seinem Ansatz konsistent ist. In der Historia animalum beobachtete er über die ganze Breite der Verstreuung des Lebens bestimmte Eigenschaften, die er Leben nennen will; besonders die Form als kreative, schöpferische Kraft, die Zeitlichkeit als ständige Veränderung, Entstehen und Vergehen und Geist als die immaterielle Essenz, die unverändert die Materie bewohnt und dieselbe in allen Lebewesen ist. Diese Trias ontologischer Begriffe ist jedoch nach Aristoteles selbst in zweifacher Hinsicht problematisch.[19] Sie sollen für alle Instanziierungen des Lebens gelten, welche aber selber nicht nur akzidentiell, sondern substanziell veränderlich sind. Will man ein Prinzip des Lebens denken, dann darf dieses nicht vollkommen in den veränderlichen Zuständen aufgehen, ohne die es jedoch nicht bestimmt werden kann. Es muss diesen Instanziierungen des Lebens also gleichzeitig immanent und transzendent sein. Jedoch noch gravierender ist die Konsequenz des Anspruches, das Leben nicht nur als dass und wie zu definieren, sondern auch als was. psychḗ soll eben jenen Punkt bezeichnen, an dem die formale und die finale Ursache sich begründen und gleichzeitig zusammen laufen (in der ἐντελέχεια), ohne das eine vollständig auf das andere zu reduzieren. Lässt Aristoteles die Frage des Lebens in der Frage nach dem Sein aufgehen, dann verliert das Leben an Schärfe und droht am Ende ein hohles Konzept zu werden, das nicht mehr Prinzip vor oder jenseits des Seins ist, sondern Derivat des Seins. Verloren in der Form, der Zeit und dem Geist. Die Eigenheit des Leben gegenüber dem Sein – die psychḗ – droht die Linie zwischen beiden ausgerechnet ontologisch zu ziehen.
Leben und/oder Sein? Diese Frage wird ihr Echo in den folgenden Jahrhunderten finden und somit zu sich selbst zurückkehren.
***
Während das Verhältnis der Ontologie und der Metaphysik im ersten Buch noch vage ist, wird es im zweiten Buch durch die Praxis entschieden. Diese setzt an, eine eigene Definition der psychḗ zu liefern, als „die erste vollendete Wirklichkeit eines natürlichen Körpers, welcher der Möglichkeit nach Leben besitzt.“[20] Man muss über die natürlichen Körper gehen, um deren Prinzip zu ergründen, über die seienden Dinge. Daher begründet sich auch Aristoteles Analyse des Sôma organikon, dem „mit Organen ausgestatteten Körper[…]“[21] als Exemplifikation der psychḗ, und zugleich – retrospektiv – deren Sitz. Diese Verschiebung von der Spekulation hin zur Empirie eines beobachtbaren Körpers, bringt Aristoteles den entscheidenden und auf die Metaphysik zurückwirkenden methodischen Vorteil: insofern die psychḗ eine Essenz hat, wird es einige Dinge geben, die dieser mehr entsprechen, andere Körper weniger; einigen Körpern wird sie ganz fehlen. „[…] nicht der Körper, der die Seele verloren hat, sondern einer, der sie besitzt, hat auch die Möglichkeit zu leben.“[22] Die Werkzeug-Analogie – so umstritten sie auch ist – lässt es zu, eine Kontinuität und gleichzeitig den Bruch mit den politischen und ethischen Schriften des Aristoteles zu illustrieren, und zugleich die treibenden Prinzipien klarer werden zu lassen.
Zunächst scheinen die beiden Übersetzungen von organikon „zum Werkzeug geeignet“ und „aus Organen/Werkzeugen bestehend“ den Werkzeugcharakter auf die einzelnen Teile des Körpers zu verschieben. Dies stützend, meint Aristoteles schließlich: „Wenn nämlich das Auge ein Lebewesen wäre, dann wäre das Sehvermögen seine Seele.“[23] Doch diese hypothetische Formulierung legt schon nahe, dass es sich hier um eine Analogie innerhalb einer Analogie handelt. Denn zweifellos spricht Aristotles nicht von der Seele der Teile des Körpers, sondern des Körpers als Ganzem. Die Analogie des Auges verbindet er jedoch mit der des Beils als archetypischem Werkzeug, um zu illustrieren, wie das Beil, durch seine Funktion bestimmt ist und wie auch das Auge nur durch das Sehen bestimmt werden kann, nicht nur aus seinen Teilen. Vielmehr sind die Teile notwendig für die Erfüllung der psychḗ als Wesenheit, bestimmt durch ihren Gebrauch. Sie sind jedoch nicht symmetrisch gleichzeitig bestimmend für das Wesen. Verliert das Auge seine psychḗ wird es stumpf und nutzlos, trotz seiner materiellen Identität. In der Weise, wie Aristoteles auch an anderen Stellen vom Ganzen des Körpers als Werkzeug spricht, so müssen wir auch hier organikon als die Organisation des Körpers als Ganzes, die ihn als Werkzeug geeignet macht, lesen. Damit gehen wir den ersten Missverständnissen aus dem Weg, wie dem, dass die Seele einzelne Teile des Körpers benutzen würde, da diese allein noch nicht psychḗ besitzen. „The tongue is not the soul’s instrument for tasting in Aristotle.”[24]
***
Obwohl der Begriff des Organismus bei Aristoteles noch nicht vorkommt, sind die Teile und das Ganze eines Körpers – wie später bei Kant – durch wechselseitige Bedingung als Mittel und Zweck bestimmt. Was heißt, dass das Vorhandensein einzelner Teile sich aus der Funktion erklärt, die sie für das Ganze erfüllen und gleichzeitig eben diese Funktion sich durch den Gebrauch bestimmt, durch die Leistungen, die sie vollbringen.[25]
Dies ist die Höhe des Aristotelischen double bind von Metaphysik und Empirie – ähnlich wie später bei Kant. Bis zu diesem Punkt hat der die psychḗ definiert als die Essenz des Lebewesens, wobei noch nicht klar ist, was dies bedeutet, da sie rein spekulativ ist. Um diesem Modell Empirie anzutragen, analogisiert Aristotles den Körper mit den Werkzeugen, die ihre Essenz im Gebrauch haben. Diese scheinbare Empirie ist jedoch eine Konsequenz aus der Spekulation und nicht dessen Begründung. Es ist ein transzendentalphilosophischer Zirkelschluss, den Aristoteles mit folgendem Syllogismus zum äußersten treibt:
„Jedes Werkzeug ist zu einem Zweck, von den Körperteilen ist jeder zu einem Zweck, der Zweck ist eine Tätigkeit (praxis), deshalb ist klar, daß der ganze Körper zwecks einer vollständigen Tätigkeit gebildet ist. Denn das Sägen ist nicht um der Säge willen da, sondern umgekehrt; das Sägen ist nämlich ein Gebrauch. Daher ist der Körper irgendwie zwecks der Seele da, und die Teile zwecks der Leistungen, für die sie von der Natur bestimmt sind.“[26]
Dieser mereologische Taschenspielertrick erlaubt es Aristoteles vom den Teilen, die nicht für die Seele sind, auf das Ganze zu schließen, das diese Aufgabe dann doch erfüllt. Nehmen wir nun aber ein systematisches Element x, welches durch seine Funktion das Element y erhält, y erhält wiederum z und z wiederum x. Die Interaktion zwischen ihnen kann als System α[27] beschrieben werden. Jedoch geht weder aus den Elementen x, y, z, noch aus ihren Relationen hervor, dass sie diese eingehen oder erhalten um α zu erhalten. Ob die Erhaltung oder gar Konstitution von α substanziell oder nur akzidentiell durch die Funktionen von x,y,z erfolgt ist nicht bestimmbar. Aristoteles erdenkt mit diesem unzureichenden Syllogismus jedoch eine frühe Form der Autopoiesis, die – erst einmal als ein System etabliert – ihre konstitutiven Vorgänge wieder auf sich zurück bindet und sich selbst notwendig Genetiv macht. Die Funktionen, die sich in einem System abspielen, sind für Aristoteles notwendig Funktionen des Systems.[28] Nur diese Annektierung der Teile des Körpers zu einem Ganzen, das der Seele als Instrument dient, kann den Horror abwenden, der drohen würde, wäre die Entelechie außer Kraft gesetzt, verlöre sie ihren Garanten, die Seele. Es wäre der Schrecken, dass sich die Natur/Leben von den theologischen und ethischen Dimensionen der Aristotelischen Philosophie lösen würde.
Aus der Metaphysik erfahren wir, dass das höchste Seiende ἐνέργεια ist, die reine Aktivität, deren selbst gerichtete Bewegung, seine Funktion oder Aufgabe (ergon) ist. Die Energia hat nicht zufällig innerhalb der Metaphysik dieselbe Funktion wie die Entelechie in De Anima. Beide sind die „vollendete Wirklichkeit“ – als Gegenpol zur Potentialität – und sind damit die Ausführenden des Ergon. Die Nikomachische Ethik bestimmt eben dieses Ergon als den Inhalt der Glückseligkeit im Ausführen der essentiellen Tätigkeit. Ethik, Metaphysik und Biologie überschneiden sich. Dies erklärt jedoch auch den Anspruch die psychḗ als jenen „Steuermann“[29] des Körpers einzusetzen, dessen höchstes Ziel das Ergon wird. Ohne diese zusätzliche Dimension wäre der Körper für Aristoteles der schützenden Hand der zirkulären Kreisläufe entzogen an dem selbst die Sterne partizipieren, getrennt vom göttlichen Ursprung des Lebens.[30] Diese gerichtete Bewegung der Natur, deren ungreifbares Ziel und Vorbild (ho theos) durch das Ergon ausgedrückt wird, dient Aristoteles auch als Ausgangspunkt für sein politisches Ideal der Autarkie (αὐτάρκεια) – das Ideal der männlichen Bürger eines Staates, sich selbst zu genügen, selbst organisch zu werden. In der Nikomachischen Ethik finden sich zwei einander ähnliche Syllogismen, die dies verdeutlichen. Erstens, ist das Gute (höchstes Gut) eigenständig, unabhängig und kann durch kein anderes Gutes erhöht werden. Da das Glück autark in diesem Sinne ist, folgt, dass das höchste Gut das Glück ist.[31] Zweitens, ist das höchste Gut das Wählens werteste, und kein anderes ist ihm vorzuziehen. Dasselbe kann vom Glück gesagt werden, daher ist das Glück das höchste Gute.[32] Es ist ersichtlich, dass diese Identifikation im Kontext der Nikomachischen Ethik selbst noch keinen inhaltlichen Gewinn bringt. Doch diese semantische Spielerei entpuppt sich bald als strategisches Mittel. Erinnern wir uns an die Definition der Glückseligkeit: das erfüllen der essentiellen Funktion, das Ergon. Insofern ist das Handeln für Aristoteles, wenn es gut sein soll, immer am Ergon ausgerichtet, an seiner Funktion. Die Bestimmung der psychḗ ist nun also nicht mehr nur metaphysisch oder empirisch, sondern aus dem double bind beider erhält sie nun auch ethische, theologische und politische Bedeutung. Aristoteles bestimmt die psychḗ als Essenz, lässt aber offen, worin diese besteht. Indem er die Essenz nun mit Charakteristika füllt, versucht er sie näher zu beschreiben. Das Ergebnis ist jedoch, dass Aristoteles die psychḗ nur durch Charakteristika definiert, die der Essenz erst einen Sinn geben. Diese Charakteristika ergeben sich jedoch erst aus einer Spekulation auf die Essenz und bleiben die ganze Analyse lang nicht mehr hinterfragt. Daraus erklärt sich die Notwendigkeit des mereologischen Tricks, die der Seele ihre Herrschaft sichert. Um das Ergon erfüllen zu können, muss die psychḗ den Körper als Werkzeug nutzen, der auf sich allein gestellt das Gute nie erreichen würde; der Körper ist schwach und fordert die Abkehr von der Einheit und dem Guten, die psychḗ vereint ihn wieder[33] Exemplarisch bestimmt Aristoteles das Ergon des Menschen als das Leben mit der Vernunft, deren Erfüllung vom Grad der Herrschaft der Seele abhängt.[34] Sie muss kultiviert werden, gepflegt und der Körper entsprechend diszipliniert werden, man muss sich – nach Aristoteles – all die weiblichen und sklavischen Züge austreiben, die die psychḗ schwächen; die Abhängigkeit, das Zögern, den Appetit.[35] Man muss sich organisch machen, Organismus sein. Ethico-theologisch-biologisch-politische Organizität.
Aristoteles – Lebendig sein
Noch haben wir uns aber nicht an der Formulierung gestoßen, dass der Sôma organikon der Möglichkeit nach Leben besitzt. Diese Unterscheidung zieht die Frage nach sich, wie ein Körper beschaffen ist oder welchen ontologischen Status er hat, wenn er zwar lebensfähig (der Möglichkeit nach lebendig), aber nicht lebendig (in Wirklichkeit lebendig) ist. Wenn wir versuchen durch die Analogien, die Aristoteles selbst beibringt, „die Materie ist die Möglichkeit, die Form aber die vollendete Wirklichkeit, und das im zweifachen Sinne, wie z.B. Wissen einerseits und Denken andererseits.“[36], dann stehen wir vor der nächsten Frage. Wir haben die Paare Möglichkeit (δύναμις) / Wirklichkeit (ἐνέργεια), Materie (ὕλη) / Form (εἶδος), Wissen / Denken, von denen Aristoteles behauptet, dass es isomorphe Relationsmengen seien, jedoch wissen wir noch nicht, worin diese Relationen bestehen. Einen Hinweis gibt die Tatsache, dass Aristoteles für Form nicht das übliche μορφή, sondern εἶδος verwendet. Materie ist für Aristoteles potentieller Träger von Form, die sich ihr aufprägt wie ein Stempel in weiches Wachs. Hier jedoch finden wir einen gezielteren Hinweis. Der unbegrenzten und unbestimmten Materie wird hier durch die Form (εἶδος) eine Grenze (πέρας) gesetzt, die die Materie somit bestimmt und zu etwas werden lässt. Aber nicht irgendeine Form, sondern ein Eidos, formt diese Grenze.[37] Um die Frage nach den lebensfähigen gegen den lebendigen Körper zu klären, reicht dies jedoch noch nicht. Wir müssen einen genaueren Blick in die Methode des zweiten Buches werfen.
Erinnern wir uns an die grundlegende Spaltung der psychḗ, die sich aus dem methodischen Ansprung der De Anima ergab; psychḗ ist das, was jedem Lebewesen gegeben ist, und gleichzeitig aber nicht in diesen Lebewesen aufgeht, gleichzeitig immanent und transzendent. Es muss jede Instanziierung des Lebens erklären und begründen, ohne selbst diese Begründeten zu sein. Platon hatte sich nicht klar entschieden, wie die Ideen mit ihren Instanziierungen zusammenhing; vollkomme Trennung (χωρισμός) oder Teilhabe (μέθεξις). Aristoteles will dieses Verhältnis nun neu bestimmen, stößt aber auf die gleichen Probleme wie Platon. Um dennoch mehr zu leisten als eine enzyklopädische Aufzählung aller lebenden Dinge oder ein bloß spekulativen Prinzip zu postulieren, muss Aristoteles den Raum des Lebens nach Gleichmäßigkeiten durchmessen. Diese Messgeräte mit denen Aristoteles psychḗ bestimmen will, müssen jedoch selbst erst gewonnen werden. Man muss eine Sensibilität dafür erst entwickeln, was George Canguilhem, einst den „permanenten Anspruch des Lebens im Lebendigen“[38] nannte, den Exzess des Lebens über die Lebenden, der sich darin zeigt, dass er sich als Schnittmenge der Lebewesen zeigt, ohne sie zu sein. Dafür wird es jedoch notwendig sein, die Lebewesen zu bestimmen, deren Schnittmenge das Leben liefert, das man zuvor postulieren musste. Diese Bestimmung fordert jedoch eine Metaphysik, die zwar dem Leben nachgeordnet ist – da sie das Leben selbst nicht bestimmt – jedoch methodisch zuerst kommen muss, da sie das Leben erst enthüllen muss, so dass man dessen Unabhängigkeit sehen kann. Die metaphysischen Unterscheidungen, die Aristoteles verwenden wird, sind selbst jedoch erst gemachte oder gefundene Werkzeuge. Die dynamische Beziehung die er zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen propagiert ist auf den Wiesen von Mytilini gewachsen und verdankt sich der Fauna von Stagira. ὕλη und μορφή sind selbst keine spekulativen Kategorien, sondern orientieren sich an den empirischen Beobachtungen der Wachstumsprozesse von Tieren und Pflanzen, die in immer höherer Formgebung durch Differenzierung und damit Formung verläuft.[39] Ebenso findet Aristoteles die Kategorien der δύναμις und ἐνέργεια nicht durch Ableitung, sondern durch die Prozesse der speziellen Teleologie der Lebewesen, die eine mögliche Funktion bzw. Vermögen realisieren oder scheitern und vergehen. Diese Empirie faltet sich im Anschluss zurück, um gerade jene metaphysischen Kategorien zu bilden, die wiederum die Empirie leiten und die (noch nicht bestehende) Wissenschaft der Biologie[40] bestimmen sollen.[41] Die Exekution der Empirie als Explikation der metaphysischen Kategorien, die man zuvor postulieren musste, führt zur Implikation jener Regeln, die rückwirkend deren Explikation legitimieren. Empirischer Transzendentalismus.
Durch diese geschickte Aufhebung der Methoden, die sich selbst retrospektiv legitimieren, wird verschleiert, dass am Anfang eine Entscheidung, statt eine Ableitung stand. Der Gegenstand, an dem sich die Methoden festmachen, die wiederum rückwirkend diesen Bereich als den legitimen ausweisen, wird selbst nicht mehr hinterfragt; die ursprüngliche Stratifizierung, die Aristotles voraussetzt, um diesen Gegenstand, die Lebewesen, zu finden, bestimmt die ganze Untersuchung bis in die Fasern und Schachteln der Metaphysik. Besinnen wir uns auf den Anspruch des Aristoteles die Möbius-Bewegung zwischen dem Leben und dem Lebendigen auszuführen, dann besteht sein erster Schritt darin – und wenn auch nur provisorisch – einen Bereich zu wählen, von dem keiner widersprechen könnte, dass er lebendig sei. Aristoteles, Apostel des gesunden Menschenverstands. Und es sind, die Blumen und Bäume, die Tintenfische und die Menschen, die Aristotles wählt. Es sind die Organismen. Und keiner der metaphysischen Gedanken und der empirischen Beobachtungen wird sich mehr davon lösen, dass diese Stratifizierung der Lebewesen unhintergehbar ist. Das Denken selbst wird organisch; eben durch den Taschenspielertrick, die einst provisorische Absteckung des Gebiets der Lebewesen so gut bestätigt zu sehen, dass es selbst keiner weiteren Kritik bedarf. Aus Willkür wird Syllogismus.
Und doch ist diese Stratefizierung in gewisser Weise doppelt. Sie legt die Organismen als jene Gegenstände fest, die das Gebiet des Lebens erst definieren können und sie zugleich durch dieses Gebiet als die Lebendigen ausweist. Aber zur gleichen Zeit trifft die Bestimmung eines Gegenstandes auch die Entscheidung über die Methode, die später die Methoden erst begründen wird; man untersucht Körper. Man wird sie in ihrer Abgeschlossenheit und Eigenheit untersuchen, um deren eigene Essenz zu erfassen, die sich ganz unabhängig von anderen Körpern gestaltet, gemäß ihrer Funktion. Ergon trägt die Laborphilosophie auf dem Rücken. Unsichtbar werden die Dynamiken des Austauschs, die Genesen des Dinges aus einem Feld, selbst die Wurzeln des Baumes werden obskur. Der Vorwurf, Aristoteles übertrage das intentionale oder teleologische Weltbild des Menschen auf die Natur und treffe damit die Grundentscheidung für die Biologie[42], greift viel zu kurz und ignoriert noch den Gegenstand, auf den erst diese Kategorien übertragen werden oder nicht.[43] Nicht zuletzt ist aber die Verneinung des letzteren Vorwurfs benutzt worden, um die strikte Trennung der Philosophie und Biologie zu illustrieren[44], die sich im Lichte der Grundentscheidung des Aristoteles und der damit einhergehenden Hervorbringung eines diskursiven Gegenstands, als retrospektive Teilung der Moderne erweist, in welcher die Biologie überhaupt erst allein existierte.
Diese Stratifizierungen, die einen Gegenstand der Biologie erst hervorbringen – das Lebendige – bringt uns näher an die Antwort auf die Frage, was ein lebensfähiger Körper im Gegensatz zu einem lebenden ist. Insofern die Analysemittel der psychḗ selbst aus empirischen Kategorien gewonnen sind, sind sie immer zweifach; sie können zutreffen oder nicht, ein Ding einem gewissen Grad oder Gruppe zuordnen oder ihn davon ausschließen. Daher ist die negative Determination mindestens genauso wichtig, wie die positive Feststellung. Eben jenes negative Herausschälen des Lebens finden wir bei Aristoteles nicht selten; im Sperma und im Leichnam. In diesen zwei Bewegungen versucht sich Aristoteles dem Leben von seinem Außen zu nähern. Wobei er den ersten Fall, dass etwas nicht Lebendiges durch welchen Akt auch immer lebendig wird, sehr schnell als widersinnig abtut. Selbst wenn der Körper bereits lebensfähig war, kann Aristoteles sich nicht vorstellen, wie er von der Potentialität von selbst in die Aktualität übergehen sollte. Grenzfall ist für ihn das Sperma und die Eizelle, welche durch das Sperma erst zur Bildung eines Embryo angeregt wird, kommen als lebensfähige Körper nicht in Frage, da sie einen Teil des Körpers der Frau bilden.[45] Aristotelischer Horror vor der Invitro Befruchtung. Statt den Eintritt ins Leben zu betrachten, nähert sich Aristotles nun auch dem Leichnam. Matte Augen, die ungelenke Steifheit seines Körpers, die Abwesenheit von πνεῦμα – die psychḗ wohnt dem Körper nicht mehr inne. Doch hat sie den Körper verlassen oder ist sie zerstört worden? Energisch wehrt sich Aristoteles gegen die pythagoreische Theorie, die Seele könne in einem anderen Körper wiedergeboren werden, da die Seele in keinen Körper geboren wird, zu dem sie nicht passt, ebenso wie der Zimmermann der Flöte keine Töne entlockt. Auch wenn wir hier die Theorie der Herrschaft der Seele über den Körper wieder aufzuscheinen scheint, ist es doch ganz umgekehrt. Denn Aristoteles erkennt damit auch an, dass es keine Seele ohne Körper gibt, und dass diese damit sogar von diesem abhinge, genauso wie das Flötenspiel nicht existiere ohne Flöten. Dies stürzt die Herrschaftsthese nicht, doch es verschiebt sie.
Halten wir fest, da diese Versuche vor und hinter das Leben zu treten, nur Negativfolien liefern, die sich selbst noch hinter den Zuckungen des Lebens verstecken wollen. Doch gerade die Unterscheidungen eines lebensfähigen Körpers von nicht lebenden Körpern wie Leichnam und Sperma enthüllt, dass es sich bei psychḗ nicht um eine Eigenschaft handelt, die man unabhängig von dessen Realisierung betrachten könnte. Der Leichnam ist nicht tot, weil er nicht lebendig ist, sondern weil er nicht lebensfähig ist, das heißt auch nie lebendig werden kann. Ihm fehlt nicht das Leben, sondern das Lebendig sein, dass im ständigen realisieren seiner Lebensfähigkeit als Lebendig sein besteht. Es gibt bei Aristoteles keinen lebensfähigen Körper, der nicht auch lebendig wäre. Doch um die Stratifizierungen und Vorentscheidungen aufrecht zu erhalten, die wir zuvor gesehen haben, muss er zwischen den lebensfähigen und nicht lebensfähigen Körpern unterscheiden, weil sonst die negative Bestimmung selbst vage und fragwürdig würde. Genauso wie von der Materie nur mit der Form vernünftig geredet werden kann[46], so kann auch von der Möglichkeit des Lebens nur gesprochen werden, wenn diese im Übergang zum Lebendig-Sein gedacht wird. In der psychḗ finden Möglichkeit und Aktualität ihre Schnittstelle. Spinoza wird diese Problematik wieder aufnehmen, wenn er das Wesen eines Modus nicht mit dessen Existenz vollständig in Deckung bringt.[47] Im Gegensatz zu Leibniz, der das Wesen eines Dinges mit einem Willen zur Existenz – einem Anspruch auf Existenz ausstattet – will Spinoza das Verhältnis gerade umdrehen, indem er die modalen Wesen nicht als „metaphysische Realität noch [als] logische Möglichkeit“[48] begreift, sondern als „eine reine physische Realität.“[49] Er beugt damit zwei Missverständnissen gegenüber dem Möglichen und seinen Realisierungen vor. Erstens ist das Wesen nicht die Ursache für die Existenz eines Modus, das heißt, das der Modus ist nicht einfach nur Bedingung für die Realisation des Wesens. Und zweitens, kann das Wesen nicht mehr als die Ursache seiner Existenz betrachtet werden, sondern ist selbst ein Verursachtes, insofern es die Existenz nicht einschließt.[50] Wenn Spinoza meint, dass Gott die Wirkursache aller Wesen ist, dann sagt er damit, dass die Wesen aus der Existenz, ihrer Ursache, resultieren, als dieser vorauszugehen. Damit sind die Wesen eben keine Möglichkeiten, die sui generis vor der Existenz bestehen und sie leiten, sondern im Gegenteil Konsequenz ihrer Existenz, durch die sie notwendig durch den Modus existiert. Die Möglichkeiten entpuppen sich somit als Abstraktion nachdem ein Modus bereits existiert, nicht aber als dessen vorausgehendes Wesen. Ebenso folgt die Möglichkeit des Lebens (lebendfähiger Körper) aus der Realität des bereits physisch lebendigen Körpers.
Halten wir die Grundentscheidungen der Aristotelischen Methode auf der Suche nach der psychḗ fest; Einführung einer doppelten Stratifizierung, die die Wissenschaft (empirisch) und das Wissen (metaphysisch) des Lebens bestimmen werden. Erstens, es sind einzelne Körper in deren Eigenheit zu betrachten (Somatismus) – Laborphilosophie – und es sind die Körper zu betrachten, an denen sich das Leben zeigt. Welche Körper dies sind ist bestimmt durch klare metaphysische Kriterien, welche sich positiv aus der Betrachtung einiger Körper, die zweifellos lebendig sind ergeben und negativ aus der Abgrenzung von den eindeutig nicht, noch nicht oder nicht mehr lebendigen Körper. Es ist diese Bewegung, die nicht zuletzt Giorgio Agamben auffällt und verweist gerade auf die paradoxe Situation Aristoteles‘. Obwohl er das Leben nicht genau fassen kann, weil es sich zwischen Ontologie und Epistemologie immer zu verflüchtigen scheint, versucht er doch Kriterien festzulegen, um doch überhaupt in analytischer Weise über das Leben nachdenken zu können. Letztendlich, so Agamben, würde Aristoteles das Leben auf das nutritive beziehungsweise vegetative Leben festlegen.[51] Eben diese Position wird von Aristotles selbst hinterfragt, jedoch kann er den Riss zwischen dem Leben als nicht zuordenbarem Prinzip, dass sich nicht auf die Lebendigen reduzieren lässt, und dem Leben in den Lebewesen, welches immer schon zugeordnet ist, nicht ohne einen Gewaltakt lösen. Agamben verweist damit auf den blinden Fleck bei Aristoteles – ein nicht zuordenbares, nicht beherrschbares Leben zu evozieren und dann wieder zu unterdrücken. Nicht zuletzt wird dieser Riss zwischen dem Leben und den Lebewesen bei Kant wiederkehren. Das Gespenst des Organischen.
Kant – Der Organismus als regulatives Prinzip
Der Organismus schlief nicht – er hat die Geschichte hindurch nicht überwintert. Nach Aristoteles, der den Begriff zwar gebar, aber nie benannte, verschwindet er als ausgedrücktes Prinzip oder führt als unproblematisches Prinzip unter der Herrschaft des Organischen eine Schattenexistenz – ohne eigenen Namen, ohne Komplikationen. Erst auf dem Hintergrund der Moderne und den erneuten Problematisierungen der Mechanik kann er wieder auftauchen. Der Botaniker Georg Ernst Stahl gibt ihm 1700 endlich einen Eigennamen; „Organismus“. Jedoch geschieht diese Schöpfung nicht ohne ihm gleich seinen Gegenpol anzutragen, der „Mechanismus“, der den Horizont des Organismus bestimmt. Seltsam vertraut klingt der Streit des ausgehenden 17. und beginnenden 18.Jahrhunderts um das Wesen der Lebewesen und deren ontologischen, theologischen, epistemologischen und nicht zuletzt politischen Status. Als wilder Denker tritt Descartes der aristotelischen Schulphilosophie mit der transgressiven These entgegen, die Natur, die Pflanzen bis hin zu den Tieren könnten als sehr geschickte und kunstfertige Maschinen beschrieben werden. Die Untersuchung ihrer in ihnen wirkenden Kräfte (und deren Wirkursachen) und deren strukturelle Einbindung in die Tiermaschine, die Pflanzenmaschine, die Weltmaschine, seinen alles, was die Naturwissenschaft leisten könne.[52] Die Uhr tickt makellos ohne Zweck, die Welt tickt makellos ohne Zweck, das Tier – es tanzt nicht, es lacht nicht – es tickt makellos; ohne Zweck. Dem gegenüber sieht sich die Aristotelische Schulphilosophie weiterhin der zweckmäßigen Organisation der Lebewesen verpflichtet, deren Zweckursachen sich nicht auf die Wirkursachen reduzieren lassen. In diesem Feld des Mechanizismus und Proto-Vitalismus – der Uhr und des Tieres – entsteht eine Theorie des Organismus, die beide zu vereinen strebt; Leibniz Monadologie. Indem er den Monaden als Spiegel des Universums[53] auf kosmische Dimension ausdehnt, kann er behaupten, dass lebende Körper Maschinen seien, aber eben entelechiale Maschinen. Da sie Naturdinge sind, lassen sie sich durch Naturgesetze – mechanisch – beschreiben. Gleichzeitig ist die Harmonie in der Natur jedoch durch den Schöpfergott eingerichtet, der diese selbst mit Zwecken ausstattete. Jede menschliche Maschine ist endlich komplex und begrenzt. Der Körper aber besteht aus unendlich vielen Teilen, jeder von ihnen eine Maschine – τέχνη und φύσις fallen durch die Kunstfertigkeit des Schöpfergottes zusammen.[54] Mechanismus und Zweck, Naturmaschinen-Maschinennatur; Leibniz, synthetischster aller Denker. Nur auf diesem Hintergrund des Streits zwischen den Maschinen und den Organismen, den zureichenden causa efficiens und den irreduziblen causa finalis, sowie der versuchten Lösung Leibniz‘ – dessen Ton und Schwung noch durch die vorkritischen Schriften Kants dringt – lässt sich Kants kritische Philosophie des Lebens und des Organismus verstehen.
Der Ort der Organismen
Entgegen des substanzontologischen Ansatzes der Monadologie und jenseits der spekulativen Naturphilosophie Spinozas setzt mit der Kritik der reinen Vernunft eine transzendentale Wende ein, die den Begriff des Lebens und des Organismus entscheidend verändert, ohne diesen notwendig als Zentrum zu haben. Analytische Konsequenz für die Bestimmung des Begriffs des Organismus findet die transzendentale Methode jedoch letztendlich in jenem Werk, das ausgerechnet diese Methode bis an die Grenzen treiben wird; die Kritik der Urteilskraft. Zu Beginn steckt dabei die transzendentale Wende Möglichkeit und Grenzen des Sprechens über den Organismus ab. In kritischer Manier formuliert Kant nicht primär[55] eine Analyse der Organismen als Naturdinge, sondern eine Theorie der Urteilskraft, deren sich der Reflektierende bedient, der die Natur bewertet. Die Formulierung des Prinzips der Bewertung ist entsprechend hypothetisch:
„Dieses Prinzip, zugleich die Definition des derselben, heißt: ein organisiertes Produkt der Natur ist das, in welchem alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist. Nichts ist in ihm umsonst, zwecklos, oder einem blinden Naturmechanismus zuzuschreiben.“[56]
Die Organismen – die nach Innen gewendeten Dinge – falten sich abermals weiter nach Innen und deren Analyse wird zur Untersuchung der teleologischen Urteilskraft. Und doch scheint Kant diesen „Rückzug zu einer subjektiv-regulativen Reflexionsmaxime“[57] im §66 erst in letzter analytischer Instanz zu vollziehen, während in den vorhergehenden Kapiteln[58] noch der Impetus und die substanzontologische Wucht von Aristoteles und Leibniz zu spüren ist. So bestimmt er die innere Zweckmäßigkeit/Teleologie der Natur im §61 als objektiv, das heißt sie müssen als durch die Naturwissenschaften untersuchbar betrachtet werden, auch wenn ein unüberwindlicher Abgrund zwischen Kausalität und Zweckmäßigkeit klafft. Auch wenn das übersinnliche Substrat des §78 noch nicht eingeführt ist, bekräftigt Kant bereits, dass man die gemeinsame Fundierung der beiden Seiten annehmen muss; man riskiert sonst nicht weniger als den Organismus im Abgrund – entweder als unbegreifliches Mysterium oder als stumpfe Maschine – versinken zu lassen. Der §62 nennt ihn sogar material real und der §63 absolut innerlich; Aristoteles Erbe. Schnell missversteht man aber diese Kriterien – wie Blumenbach – als ontologische Bestimmungen des Wesens des Organismus. Jedoch sind es lediglich Bestimmungen des regulativ-subjektiven und apriorischen Prinzips der Urteilskraft, die der Reflektierende annehmen muss, wenn er über die Naturdinge sprechen will. Obwohl in der Anschauung selbst die Dinge der Natur als zweckmäßig gegeben sind, liegt diese Gegebenheit nur im Bewusstsein, welches (unter anderen) wiederum durch die Urteilskraft bestimmt wird. Kritisch biegt Kant die Gegebenheit der Zweckmäßigkeit der Organismen ins Transzendentale zurück. Organismen haben ihren Ort bei Kant nicht in der Natur, sondern ausschließlich im (Selbst-)Bewusstsein. Die Gegebenheit der Zweckmäßigkeit ist objektiv – weil in der Anschauung nicht willkürlich – jedoch auch ideell, weil nur in der Urteilskraft legitimierbar. Als-ob; nichts als Als-ob.
Transzendentaler Double Bind
Die analytische Spandrille, die Kant für die (noch nicht benannte) Biologie versucht zu schaffen, findet daher auch so schwer halt und muss ständig revidiert und überarbeitet werden[59]. Sie findet ihren Tritt nicht zwischen dem Anspruch die aristotelische Naturphilosophie, welche substanzontologisch entschieden realistisch auftritt[60], mit dem kritischen Impetus der Transzendentalphilosophie, die anti-realistisch ist, oder bestenfalls der Realität skeptisch gegenüber steht, zu vereinen, während sich die Letztere eben erst ausbildet. Wir erlangen bei der Untersuchung der Zweckmäßigkeit keine wirkliche Erkenntnis von den Organismen, sondern nur über das auf sich selbst zurückfaltende Bewusstsein,[61] so Kant. Diese Strategie ist Teil des größeren Impetus, die Wissenschaftlichkeit der Untersuchungen zu garantieren[62], und wird restlos auf alles angewendet. Nicht die Natur selbst wird gesucht, sondern eine Strategie, die ein Maximum an gesichertem und beweisbarem Wissen gewährleistet.[63] Schellings Kritik, für die Philosophie hätte es die Natur noch nicht gegeben, trifft vor allem seinen Lehrmeister Kant, für den die Natur selbst keinen Platz in der Philosophie hat, außer als „der Inbegriff aller Dinge, sofern sie Gegenstände unserer Sinne, mithin auch der Erfahrung seyn können, worunter also das Ganze aller Erscheinungen, verstanden wird“[64]. Im Bewusstsein oder nirgendwo. Kant erschafft eine abstrakte Maschine, die jeden Ballast abwirft und unendlich schnell werden kann – die transzendentale Beschleunigung – aber im Nichts mit Nichts arbeitet. Eine Natur aus Repräsentationen und Erfahrungen, nicht aus Natur. Ein Naturschattentheater, dessen Leinwand Kant unablässig auf Struktur und Lücken prüft. Es ist aber gerade die Kritik dieses Spektakels, welches Kant zu zahllosen Eingeständnissen zwingt. Der ganze Gang der Untersuchungen, der mit den wissenschaftstheoretischen Überlegungen der Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft über die Kritik der reinen Vernunft bis hin zur Kritik der Urteilskraft diente dazu, die Philosophie ins sichere Fahrwasser der Wissenschaft zu bringen. Die Teleologie im Besonderen stellt diesen Anspruch jedoch in Frage, da sie strenggenommen „nicht Naturwissenschaft, sondern lediglich Naturbeschreibung“[65] sein kann. Aus sich selbst hinaus ist sie nicht in der Lage ihre Phänomene durch theoretische Verstandesbegriffe vollständig zu erklären, aber eben das fordert Kant als Maßstab für strenge Wissenschaft.[66] Es daher nicht verwunderlich, dass Kant im §62 noch einmal die Naturbeschreibung von den mathematischen Wissenschaften trennt, die ohne jede Form von Empirie auskommen, ohne jedoch diese Irreduzibilität als Mangel zu beschreiben. Sondern vielmehr scheint die Urteilskraft ein über die Mathematik hinaus reichendes Vermögen zu besitzen. Kant widerspricht dem Traum Norbert Wieners.[67]
Das seltsame Surplus der Urteilskraft, welche Kant transzendentalphilosophisch nutzen will, um die Wissenschaftlichkeit zu sichern, ist eben auch der exzessive Punkt an dem diese Überschritten wird. Die Loslösung von der spekulativen und vorkritischen Naturphilosophie führt ihn über Umwegen zurück in Spekulationen transzendentaler Art. Dieser transzendentalphilosophische double bind kommt gerade in dieser Spannung zwischen den theoretischen Verstandesbegriffen und dem Vermögen der Urteilskraft, die sich nicht restlos auf diese reduzieren lässt zum Ausdruck. Obwohl sich die Notwendigkeit eines Prinzips für die Bewertung der Organismen schon ankündigte gewinnt Kant die Kriterien für dessen Betrachtung gerade aus der Betrachtung der selbigen. Die in der Anschauung gegebene objektive Zweckmäßigkeit wird von Kant als transzendentales Prinzip hypostasiert, welches schon immer die Anschauung strukturierte und darüber hinaus auch die Anschauung strukturieren soll, um die wissenschaftliche Forschungspraxis zu optimieren. „Allgemeinheit und Notwendigkeit“[68] bilden die Legitimation dieses Prinzips in der die Forschungspraxis sich selbst bestätigt. Ein jeder „Zergliederer der Gewächse und Tiere“[69], verwendet die Urteilkraft bei seiner Untersuchung schon immer so, als sei „in einem solchen Geschöpf nichts umsonst“[70] – sonst hätte er es mit einer zufälligen und blinden Mechanik zu tun, ohne Sinn und Zweck; verheißungslose Geschöpfe ohne Innerlichkeit. Um dies zu vermeiden, „können“[71] die Forscher gar nicht anders als das teleologische Prinzip der Urteilskraft zu verwenden – absolute Notwendigkeit. Insofern sie das Prinzip aber verwenden, kann es nicht eingeschränkt werden, sondern stellt sich als Idee dar. Eben als eine solche „absolute Einheit der Vorstellung“[72] kann sie nicht nur auf einige Aspekte angewendet werden, sondern muss alles[73] an einem Lebewesen erklären können. Was und wie ein Organismus ist, ergibt sich aus seinem Erscheinen, in dessen Prinzipien es im Anschluss gleich wieder eingeschlossen wird. Nichts Neues ist mehr möglich. Jede Erkenntnis des Organismus wird sich in das Transzendentale einpassen lassen müssen, welches nicht nur Grundlage, sondern auch Norm ist – allgemein und notwendig. Die einzelne Erkenntnis des Organismus ist Mittel und Zweck des Ganzen – der Idee – welche wiederum die einzelne Betrachtung – Anschauung – als Mittel und Zweck möglich macht. Die Erkenntnis des Organismus wird selbst organisch. Organisch-vitalistischer Transzendentalismus statt anorganisch-transzendentalem Vitalismus.
Das innere Zerren der Kantischen Urteilskraft wird hier am deutlichsten, da Kant zwar die Finalursachen als reale Prinzipien der Naturdinge für illegitim erklärt, weil sie nicht zur Erkenntnis des Gegenstandes gehören, sondern ihnen durch die subjektiv-regulative Reflexionsmaxime zugesprochen werden, und doch nicht ganz. Kant versucht das Zerbrechen seiner Welt in eine Zwei-Welten-Physik zu verhindern, indem er strenggenommen eine zweischneidige Analyse führt. Es stimmt, dass die Naturteleologie nicht objektiv erfahren werden kann, dass sie dunkel für die Augen bleibt, und doch ist sie nicht nur für den Kopf erleuchtet. In der Anschauung weist die Natur auf ihre eigene Teleologie hin. Geburt der hermeneutischen Phänomenologie. Wir bekommen einen „Wink“[74], „dass eine untergründige Affinität zwischen uns und der Natur existiert.“[75] Der Umstand, dass ein Band geknüpft ist, zwischen uns und dem Ganzen der Natur, die nicht nur in unserem Bewusstsein ist. Der seltsame Umstand, dass Kant die Kunst im selben Buch, häufig die Wege kreuzend, behandelt, trägt in einer Reflexion darüber die paradoxesten aber auch progressivsten Früchte: „Die schönen Dinge zeigen an, dass der Mensch in die Welt passe und selbst seine Anschauung der Dinge mit den Gesetzen seiner Anschauung stimme.“[76] Man mag sagen, dass Kant auf den Sinnverlust des Menschen durch die Naturwissenschaft reagiert, den schon Leibniz spürte, und dem er entgegenwirken will; dass er der absoluten Deterritorialisierung des Menschen, seine Auflösung in das Meer des Seins, etwas entgegensetzten will, dass ihn wieder erdet. Doch Kant tut mehr, indem er das Band zwischen Natur und Mensch wieder herstellt, riskiert er dessen Eingehen in die Erde, sein Verschwinden in die Natur, der er nicht gegenüberstehen kann. Der Wink offenbart auch den realen Kern der Anschauungen, realitas phaenomenon[77], als die Intensität, die den Gegenstand erscheinen lässt und von dem wir uns nicht lösen können. Dabei ist noch nicht gesagt, dass die Naturteleologie thematisch auch real ist, doch aber, dass sie durch etwas überhaupt erst erscheinen kann, dass nicht im Bewusstsein ist und uns doch nicht ganz verschlossen ist.
Anti-Physik
Noch bleibt Kants theoretisches Fundament des Organismus dunkel, da wir den Untergrund noch nicht eingeführt haben, auf dem er erscheinen kann; das Anorganische. Die Bewegung gegen und mit dem Anorganischen vollzieht sich vor allem im §64 und §65 der Kritik der Urteilskraft im Wechselspiel mit der Kunst, die einmal Folie der Abstoßung als Materie ist, andermal gefährliche Analogie. Wenn wir, so Kant, begreifen wollen, was die Produkte der Natur von denen der Kunst unterscheidet, müssen wir auf die Umstände ihrer Hervorbringung achten. In kaum differenzierter Wiederholung Aristoteles verweist Kant beim Kunstwerk auf den intentionalen Agenten, der das Werk hervor bringt und damit die Kausalität der Entstehung außerhalb des Kunstwerkes setzt. Die organischen Naturprodukte hingegen entwickeln sich aus dem Inneren heraus nach ihrer eigenen Kausalität, der Zweckmäßigkeit – die Definition des Organismus lässt keine äußere Kausalität zu.[78] Kant scheut sich eben in diesem Zusammenhang auch nicht das Musterbeispiel eines gut funktionierenden Mechanismus zu bedienen; die Uhr. Sie funktioniert autark, kann sich aber weder aus sich selbst heraus schaffen, noch sich selbst reparieren; die Regeneration des Schwanzes einer Eidechse anstatt die Regeneration einer Maschine durch sich selbst.[79] Τέχνη und φύσις brechen erneut auseinander – mehr aus Tradition als aus Überlegung. Als müssten die Tiere nicht fressen oder das Jagen erlernen, als müsste die Pflanze nicht auf gutem Boden wachsen – als würden auch die Lebewesen nicht ständig und immer wieder von der Natur hergestellt. Obwohl Kant in einzigartiger Weise die genetische Dimension der Dinge nicht nur als akzidentiell, sondern essentiell erkennt, verkennt er sie gleich wieder durch sein Aristotelisches Erbe.
Um diese Innerlichkeit der organischen Naturdinge noch weiter zu fundieren, macht er in ihnen einen nexus finalis aus, eine den Naturdingen eigene Art de Kausalität – nicht nur monokausal, sondern „sowohl aufwärts wie auch abwärts Abhängigkeit bei sich führt“[80]. Damit hebt sie sich von der einfachen Kausalität des nexus effectivus in der mechanischen Welt ab, bei der die Kausalität immer nur abwärts funktioniert, eine Wirkung immer auf eine Ursache folgt, nie aber eine Wirkung auch ihre eigene Ursache sein kann. Wie unklar die Konturen dieser Konzeption jedoch sind und wie weit Kant das Prinzip des Organischen auszudehnen versucht, zeigt sein Beispiel zum nexus finalis, der Hausbau. Wir stellen uns ein einen potentiellen Bauherren vor, der ein Haus errichten will, damit er durch dieses Miteinnahmen macht. Das Versprechen von Geld folgt aus dem Hausbau, doch der Hausbau folgt auch aus dem Versprechen von Geld. Die Stadt wird organisch, wenn alle Vermieter werden. Doch dieses Beispiel ist keineswegs so erhellend, wie einige Interpreten meinen[81], denn es bezieht sich nicht nur nicht auf Organismen, sondern präsuppositioniert auch einen reflektierenden Geist am Werk. Auch wenn Kant sehr wohl meint, dass dem nexus finalis Ideen zugrunde liegen, die bestimmen, wozu ein Ding da ist, würde man durch die Mieteinnahmen-Metapher den Status von Vernuftbegriffen der Ideen verkennen.
Vielmehr will Kant auf den Umstand hinaus, dass die Teile eines Naturdings als Zweck und Mittel für die anderen Teile da sind, die sie erhalten und zugleich für das Ganze, das umgekehrt die einzelnen Teile ermöglicht.[82] Oder anders „wenn die Teile des Ganzen umeinander und um des Ganzen willen existieren und das Ganze wiederum um der Teile willen“[83], dann kann man von einem Organismus sprechen. Genauer heißt dies jedoch, dass die Teile sich gegenseitig und das Ganze erzeugen – wenn sie also füreinander und für das Ganze ὄργανον sind. Aus dem bereits angesprochenen Umstand, dass die Naturdinge nur durch innere Zweckmäßigkeit bestimmt sind und dass sie sich gegenseitig hervorbringen kann Kant nun schließen, dass sie ein sich selbst hervorbringendes Gebilde[84] sind. Selbstorganisation – Autopoiesis. Der Transzendentalismus, der das Leben – wie wir schon sahen – einschloss, kommt hier zu seiner vollen Blüte. Denn man braucht den Transzendentalismus, um die Organisation der Natur in der Selbstorganisation zu einem Werkzeug der Einsperrung zu machen. Kantische Autopoiesis lässt sich schließlich immer nur nachträglich feststellen, sie ist eine Nachträglichkeit, die man dem Prozess auferlegt, und ihn damit dem Selbst des Organismus annektiert. Insofern der Prozess aus den Kräften eines Feldes entsteht, sei es genetisch oder embryogenetisch ist, entsteht er aus dem freien Spiel der intensiven Differenzen dieses Feldes. Das Selbst der Organisation entsteht im Prozess der Organisation selbst mit, ohne aber in ihm schon enthalten gewesen zu sein. Nachträglich wird aber in Kants transzendentaler Operation nach der Bedingung der Möglichkeit dieses Prozesses gefragt, die man dem Ergebnis – dem existierenden Organismus – entnimmt und retrospektiv als Bedingung voran stellt. Das Ergebnis bestimmt den Prozess; das ist Kants nexus finalis als Werkzeug der Transzendentalphilosophie, die keinen freien Prozess zulässt, wenn er nicht auf ein Telos gerichtet ist, dass jedoch erst nachträglich dem Prozess aufgedrückt werden kann. Kant macht das Feld dem Körper genetiv[85] – es kann als Prozess nur in den Blick kommen, insofern es den Körper Organismus als Selbst hervorgebracht hat, nur um dann als dessen Bedingung an diesen angeschlossen zu werden. Wozu ein Ding wirklich dient, was es tut, – das Telos – kann zwar erst a posteriori festgestellt werden, was Kant aber nicht daran hindert ihm a priori Status einzuräumen. Das Entstehen von etwas Neuem ist in diesem Zirkelschluss kategorisch ausgeschlossen, weil Kant bemüht ist, den Transzendentalen Käfig dicht zu halten, deren Wächter die Selbstorganisation ist.[86] Die Dinge bilden ihr Telos nicht aus, sondern er ist schon in der Idee angelegt, die den Prozess bestimmt, sie erfinden sich nicht, sondern sind für Kant nur Ausdrücke einer bereits vorhandenen Idee. Jeder Prozess, der aus diesem Käfig ausbrechen will, um zu berichten, dass er das Transzendentale erst schafft, wird sofort zum Schweigen gebracht, indem man ihn als Prozess der Selbstorganisation versteckt. Der sich erst bildende Telos des Organismus wird zur ἀρχή, die sich nicht hinter den Dingen oder temporal unendlich weit zurück aufhält, sondern in ihnen entsteht, sich aber dann als dessen Ziel unverändert erhalten will. Was ein Körper vermag ist nur noch, was er als dieser Körper – als hylischer Rahmen – vermag, nicht als sich wandelnder Körper. Das Feld verschwindet.
Noch haben wir die volle Tiefe der Kantischen Ablehnung einer nicht teleologischen und freien Natur noch nicht erreicht. Denn die sich selbst bildende Natur impliziert für Kant auch eine „bildende Kraft“[87], die diese Bildung leistet; die Bildungskraft. Um diese Implikation jedoch zu verstehen, muss man sich zunächst auf Kants Vorstellung der Materie berufen. Die Aristotelische Vorstellung einer unendlichen und formlosen Materie wurde – bevor sie Kant erreicht – scholastisch gewaschen und Ausdehnung angetragen. Letztlich übernimmt Kant die negativen Bestimmungen der Aristotelischen Materie als passiv und leblos, ohne jedoch die enge Verbindung mit der Form mitzudenken. Für Kant ist Materie nichts weiter als inaktive, passive und leblose Masse[88], die durch die Newtonischen Gesetze durch den Raum geschleudert wird, wie bei Locke. Wenn die Materie nun aber nicht selbst in der Lage ist, sich zu organisieren, geschweige denn in der Weise wie Kant es für Organismen veranschlagt, dann muss es ein weiteres Prinzip geben, dass dieser Materie nicht zuzuschreiben ist. Aber, ist der Bildungstrieb – das Prinzip der spontanen Aktivität – als solcher etwas nicht-materielles, wird er Kants Anspruch gemäß paradox – man kann ihn nicht mehr durch die reinen Verstandesbegriffe erklären. Kant steht hier methodologisch vor einem Scheideweg: entweder man gibt die Unerforschlichkeit des Bildungstriebes zu oder man untersucht ihn als/in Analogien, was aber hieße, eine zu finden, die den vorangegangenen Definitionen nicht widerspricht. Interessanterweise tut Kant beides. Einerseits gibt er offen zu, dass der Bildungstrieb unerforschlich bleiben muss[89], andererseits scheint er nach dem Scheitern anderer Analogien, eine zu finden, die annähernd funktioniert. Die Kunstmetapher scheint die Naheliegenste zu sein, wenn man sie kosmisch aufwertet – Leibniz steht wieder auf. Die Natur uns ihre Zwecke bestimmen sich nach einem großen Künstler-Gott. Zu spekulativ und jedem Anschein von Verstandesbegriffen entrückt scheint jedoch diese These, nicht zuletzt, weil sie unbeweisbar wäre. Aus der Kantischen Definition der Materie disqualifizieren sich auch schon die Ansätze des Monismus in allen Spielarten, da diese der Materie eine lebendige Kraft zuschreiben würden, was ihrem Wesen widerspräche.[90] Zugleich kann aber auch die Aristotelische Definition der Seele[91] nicht als belebendes Prinzip in Frage kommen, da diese wieder eine den Organismen selbst äußerliche Kausalität wäre. Man darf hier nicht die stringente Vorsicht Kants übersehen, den Bildungstrieb nicht der Mechanik zu übereignen, ihn aber zugleich auch nicht als abstrakte Kraft vollkommen von dieser abzuheben. Und diese Vorsicht und der Versuch eines Mittelweges scheint in einer theoretischen Dunkelheit enden zu müssen, wie es auch schon bei Henry von Ghent oder Meister Eckhart der Fall war.
Der letzte Funke zur Lichtung dieses Problems, der gleichzeitig die letzte Hoffnung auf eine Eine-Welt-Physik ist, die Kant immer noch verfolgt, bleibt für Kant eine entfernte Analogie; das „praktische Vernunftvermögen“[92] – die Natur schafft Zwecke, wie der Mensch Zwecke schafft. Diese Analogie ist jedoch, wie bereits die Mieteinnahmenmetapher, gleichzeitig aufschlussreich wie folgenlos. Die Zwecksetzung des Menschen bestimmt sich nach Kant durch die besondere Dialektik, von einem Allgemeinen auf ein Besonderes zu schließen. Die scheint damit schnell geschlossen – die Natur schließt auch von der Idee des Ganzen (Allgemeines) auf das einzelne Teil (Besonderes), welches in seiner Form und Funktion durch das Ganze bestimmt ist. Diese rein abstrakte Verbindung erweist sich aber bald als Pyrrhussieg, denn haben wir die Analogie hergestellt, wird die Bildungskraft fast noch dunkler, da wir die Prinzipien der menschlichen Zwecksetzung nur aus dieser abstrakten Ebene anwenden können. Sobald wir konkreter fragen, wird die Brücke zu brüchig, um hinüber zu gehen. Wollen wir die Verbindung konkret nutzen, müssen wir die drei Arten von praktischer menschlicher Zwecksetzung bedenken; die pragmatische, die technischer und die moralische.[93] Sofort verschwindet die Technik als vernünftige Analogie, da wir hier dem Künstler-Kunstwerk-Problem – welches wir vorher sahen – gegenüber stehen. Mit in Kauf genommener Ausdehnung der Intension des Begriffs Pragmatik, die für Kant bedeutet, dass man sich selbst Zwecke setzen kann, die für den Ausgang förderlich sind – wie auch die Natur sich Zwecke setzen könnte, die Eigenschaften auszubilden, die für ihr bestehen und gedeihen förderlich sind. Die offensichtliche Schwierigkeit ist hier, dass die Analogie nichts erklärt, sondern nur ein neues spekulatives Element einbringt, das aus den Dingen selbst, wieder nicht erklärt werden kann. Um diese Analogie zu halten, müsste man ein Postulat einführen, dass durch nichts gestützt werden kann als durch sich selbst. Moralische Zwecksetzung, das heißt die Zwecke frei so zu wählen, dass man der praktischen Vernunft nach handelt und sich moralisch-sittlich entfaltet. Ob und wieso die Natur sich sittlich verhalten sollte, bleibt zwar offen für eine Debatte, doch das verbindende Element scheint hier zu sein, dass beiden – dem Menschen und den organisierten Naturdingen – eine Freiheit zugeschrieben wird, die Zwecke moralisch zu setzen oder unfrei zu handeln.[94] Und genau an dieser Stelle wird die Analogie auch wieder problematisch, da man die Freiheit des Menschen nachweisen kann, die Freiheit der Natur nicht nachvollzogen oder vernünftig postuliert werden kann. Interessant ist hier nicht nur die Argumentation, sondern die Stoßrichtung noch ein Refugium in der Moral zu finden, wenn alle anderen Bereiche versagt haben. Nicht zuletzt bereitet diese Adäquation den Weg für Fichtes spätere Naturrechtsphilosophie. Und dann eben doch: Vitalistische Sackgasse: dunkles Leben oder lebloses Licht. Kants betonen, das Leben ließe sich durch keine andere Art der Kausalität erklären lasse, um es vor der Mechanisierung und dem Anorganischen zu schützen und gleichzeitig der Versuch, es nicht als mystische unerklärliche Kraft zu degradieren, muss scheitern. Der Mythos vom Organismus gegen den Mechanismus – den Kant nicht erfand, aber doch fundamentiert, rächt sich methodisch. Kant kann noch nicht sehen, dass es kein Zwischen von Organismus und Mechanismus gibt, sondern nur ein Jenseits; die Maschine. Kant schafft den rettenden Schwung von seinem „vital materialism“[95] zu einem materialist vitalism nicht.
Und damit zerbricht die Welt – nicht in Ideen und Abbilder – sondern in das träge Totenreich des Anorganischen und die lebendige Welt der Organismen. „In other words, as we have already found, the basis of two-world physics: the inert, inorganic world of external nature, and the organic world from which ‘nature has withdrawn her hand’, leaving humanity free to articulate the organic body.”[96] Es wird für Kant keinen “Newton des Grashalm”[97] mehr geben, denn in seiner Nachfolge entwickelt sich diese Anti-Physik zu einem triumphalen Zeugnis organischer Herrlichkeit, von dem sich das Recht der Natur und das Leben selbst abzuleiten hat. Der Mythos, den Kant konsolidiert, Organismus gegen Mechanismus wird zudem die Philosophie heimsuchen und den gesamten Vitalismus inspirieren und gleichzeitig einschränken. Man wird noch in der organischen Philosophie Bergsons die unhinterfragte These finden, dass sich Mechanik und Organik nicht im Grad, sondern der Art nach unterscheiden, während er gleichzeitig vielleicht der Einzige unter den Vitalisten ist, der – gelegentlich fast verzweifelt – das Leben des Organischen und des Anorganischen wieder zusammen zu führen versucht. Driesch wird dem Kantischen Riss ein biologisches Fundament geben und ihn laut und strategisch gegen seine Feinde und Zweifler verteidigen. Die paradoxe Operation Kants wird weitergetragen, gemäß der es das Anorganische überhaupt nicht gibt, außer als die Negation des lebendigen Prozesses der organisierten Naturdinge. Der Riss bleibt permanent – er erhält sich selbst; der Riss des Organischen wird selbst organisch – das Anorganische verschwindet.
Anorganisch = organisch. Mehr hat Kant nicht über das Anorganische zu sagen.
Einschub – die Phänomenologie
Die Phänomenologie wird die Kantischen Konsequenzen noch einmal rekapitulieren: die Innerlichkeit, die Autopoiesis, double bind, die regulative Reflexionsmaxime, den Somatismus, die Unerforschlichkeit des Lebens – kurz das organische Paradigma, methodisch wie thematisch. Husserls Kantisches Projekt, eine Phänomenologie zu entwickeln, die der Transzendentalphilosophie neuen streng wissenschaftlichen Grund[98] geben sollte, verschleiert das Paradigma des Organischen jedoch erneut. Husserl quasi-internalistischer Rückzug auf die Intentionalitätsstruktur, die Untersuchung des Korrelationsapriori als der Erfahrung unterliegende Struktur von Noesis und Noema richtet Kants Blickrichtung nur neu aus, ist aber keine grundlegende Kritik an ihm. So kehren auch alle Merkmale in ihr, wenn auch differenziert wieder. Insofern sich der Gegenstand der Untersuchung ändert, bleibt das Ziel und der Endpunkt, die Bedingung der Möglichkeit möglicher Erfahrung zu finden das Gleiche; das transzendentale Subjekt. Alles was die erfahren werden kann, wird sich in den Grenzen dieses transzendentalen Rahmens einordnen lassen. Zu keiner Zeit ist dieser Rahmen jedoch unproblematisch gewesen, niemals hat man ihm ganz blind vertraut, sondern „man hat der Phänomenologie von vornherein mehr aufgebürdet und mehr zugetraut.“[99] Nicht nur die Sprache, die Mitmenschen und die Geschichte werden für diesen totalen Rahmen zur ständigen Probe, sondern auch die Doppelfunktion des Leibes. Einerseits als Erfahrung, andererseits als Verkörperung der Erfahrung. Wie Berührung und Berührtes, wie Empfindung und Empfundenes der sich berührenden Hände[100], die Husserl anführt, verhält es sich auch für die Phänomenologie mit dem Leib. Gerade hier im und am Leib können wir den phänomenologischen Kampf mit dem Paradigma der Organizität am besten verfolgen.
Husserls Aschenbecher war schon immer nur von einer Perspektive aus zu sehen – nie in seiner Totalität. Schon immer hatte jemand eine Position im Raum, um ihn zu betrachten. Schlicht und elegant beginnt sich die Perzeptionsanalyse Husserls dem Raum zu nähern. Insofern also immer schon eine Perspektive in der Erfahrung eingenommen wird, muss es auch jemanden geben, der im Raum präsent ist. Dieses kinästhetische, und inkarnierte Subjekt, dass sich durch den Raum bewegt, gelegentlich gegen die Dinge stößt und ihre Tiefe erfährt, nennt Husserl Leib; der das Subjekt ist, anstatt ihn nur zu besitzen. Unbemerkt hat Husserl hier aber schon eine Hierarchie eingeschleust, die sich aus der transzendental-phänomenologischen Methode ableitet: Man ist zuerst und immer schon lebendiger und spontaner Leib und hat nur in zweiter Instanz einen mechanischen und toten Körper.[101] Eben gerade erst, wenn der athletische Körper – wie ihn Merleau-Ponty beschreibt -, der sich flüssig und fast gleitend durch den Raum bewegt, gestört ist, durch Krankheit, Schmerz oder Immobilisierung, kommt überhaupt der Körper in den Blick. Als schwebten sonst Geister durch den Raum, die die Dinge mit ihrem Bewusstsein streifen und plötzlich zum Körper materialisierten. Keineswegs ist dies die ontologisches Behauptung des intentionalen Leibbegriffs Husserls (und auch des frühen Merleau-Ponty), sondern die Konsequenz der epistemologischen Wende, in der der Körper nur entweder als verhinderter Leib oder als Erscheinung und Erfahrung für den Leib in den Blick kommen kann. Aufgrund dieser Wende, begegnen wir bei Husserl der gleichen double bind Bewegung wie bei Kant: insofern Erfahrung immer schon als organisierte Erfahren wird, muss es Bedingungen dieser Ordnung geben. Findet man diese Bedingungen auf, müssen alle anderen Möglichen Erfahrungen ebenfalls durch diese Bedingungen bestimmt sein; double bind. Insofern Erfahrung stattfindet – die Korrelation von Noesis und Noema – wird durch die Intentionalität nicht irgendwie wahrgenommen, sondern immer etwas wahrgenommen[102], auf dessen Gegenstandskonstitution sich das Wahrnehmungsfeld und die Bedingungen gruppieren; Somatismus. Sogar wenn wir der dieser Konstitution noch eine genetische Perspektive antragen, wie es Husserl in seiner späteren Philosophie versucht hat, wird das Feld, der sich organisierenden Perzeptionen, nur auf einen Gegenstand hin begriffen und erklärbar. Der Gegenstand der Wahrnehmung macht sich das Feld zum Genetiv; die Erfahrung des Gegenstandes. Autopoiesis. Organische Erfahrung, die die eigene Organisation auf die transzendentale Organisation zurückführt. Organischer Zirkelschluss.
Leiblichkeit
Zwei Polizisten fahren jeden Tag mit dem Fahrrad zur Streife. Als Verlängerung ihrer Glieder reiben sie sich am Sitz, ihre Hände umfassen den Lenker, massieren das Metall des Rahmens durch zufällige Bewegungen ein. Werden sie Fahrräder, wird das Fahrrad ein Polizist? Und wenn ja, wie sollte es behandelt werden oder wie verdienen es die Polizisten behandelt zu werden, die auf molekularer Ebene schon immer Partikel mit dem Fahrrad getauscht haben, ohne auf molarer Ebene Fahrräder zu sein. Kann man das Vehikel spüren, spürt es einen. Der dritte Polizist von Flann O’Brien hört nicht auf diese Frage zu stellen. Und doch, wird diese Frage fast nie gestellt; in der phänomenologischen Tradition bleibt sie ganz versteckt, weil sie die Hierarchie zwischen erster und dritter Person in Frage stellt, nicht durch eine Bubersch oder Lévinassche zweite Person, sondern durch „die Stimme der vierten Person Singular, mit der niemand spricht und die dennoch existiert.“[103] Eben dadurch, dass sie niemand spricht, bleibt sie für die Phänomenologie dunkel und unerforschlich. Die Innerlichkeit der ersten Person beginnt bereits mit Husserl, aber letztendlich mit Scheler die Unpersönlichkeit der vierten Person zu verdrängen, in seinem Anspruch „organisches Leben nach seiner objektiven und subjektiven Seite hin verständlich“[104] zu machen. Auch wenn die Naturwissenschaften die objektive und vermeintlich mechanische Seite der Organismen betrachten können, bleibt ihre subjektive Seite ausgespart. Offensichtlich scheinen wir hier aber an die Kantische Kritik zu stoßen, dass eben in den Naturprodukten diese subjektive Teleologie nur behauptet, aber nicht sicher ausgewiesen werden kann. Gerade dieses starke Argument führt nicht zur Auflösung der Behauptung der Innerlichkeit des Lebens, sondern zu dessen Verschärfung. Alles, worüber jetzt noch gesprochen werden kann ist die Erfahrung des Lebens, die uns voll zugänglich zu sein scheint, unser Erleben des Lebens. Oder wie der Zoologe Portman meint, man untersucht das Leben von dem aus, „was wir aus eigenem Erleben am besten kennen […] Innerlichkeit.“[105] Die kritische Position Kants verkehrt sich in ihr hyperkritisches Spiegelbild – sollte die Vorsicht Kants noch die Möglichkeit einer nicht menschlichen Natur freihalten, wird nun durch die Radikalisierung der Kantischen Prämisse alles von der menschlichen Innerlichkeit her gedacht.
Doch die Frage nach dem Ort dieser Innerlichkeit beginnt sich aufzudrängen. Doch spätestens mit Merleau-Ponty wird sie zur transzendental-phänomenologischen Frage, inwiefern der Leib gerade der Ort dieser Innerlichkeit ist; spontan, selbstbewegt, athletisch. Auf den ersten Blick scheint auch diese Verortung die plausibelste, da sie einerseits der Innerlichkeit Schutz bietet, durch ihren Außenbezug aber auch die von Husserl versprochene Durchbruchswirkung der Intentionalität erfüllt. Zur-Welt-Sein durch den Leib – statt der Welt gegenüber sein. Diese Kreuzung von Leib und Innerlichkeit als Ort des Lebens wird zur uneingeschränkten reflexiven Bewegung, da im „menschlichen Leib die Naturbeziehung zu einer Selbstbeziehung des Menschen wird.“[106] Das Erleben des Lebens wird zu dessen Grenze. Niemand hat dieses Paradigma deutlicher ausgedrückt als Hermann Schmitz, der nicht nur die leibliche Erfahrung als die Erfahrung des Lebens unter der Rationalität freilegen will, sondern auch die Personalität des Leibes betont, der immer und zuerst mein Leib ist. Das Leben ist jeweils mein Leben als mein Leib. Absoluter organischer Narzissmus. Aber auch die Gegenrichtung von Waldenfels, der den Leib als ursprüngliches Responsivitätsphänomen bestimmt – man empfängt seinen Körper vom Anderen – kann von dieser Position aus, das, was sich der Organisation dieses Körpers wiedersetzt nur als das Fremde, definieren von dem aus sich ein Leib generiert. Transzendenter Organizismus der zweiten Person. Die dritte Person aus der ersten oder die erste Person aus der zweiten zu betrachten, löst sich beides nicht von der Personalität des Lebens, für die keiner einstehen kann.
Wir erleben das Problem des Anorganischen in der phänomenologischen Leibphilosophie daher als eine Neuauflage der Husserlschen Problematik des Fremdphychischen. Insofern ich das leibliche in den Bereich des transzendentalen aufnehme, wird auch diese Bestimmung zum Raster für alle möglichen Erfahrungen, die ich jetzt nur noch mit dem Anorganischen machen kann, insofern ich sie mir einverleibe. Versuchen wir das Anorganische von unserer innerlichen Erfahrung zu beschreiben – egal wie ausgedehnt wir diese begreifen – bleibt sie bei einem zum Anorganischen stehen oder das Anorganische in uns spüren. Es wird als Stimulanz oder Einfluss auf die Innerlichkeit, erscheint aber selbst nicht als Leben oder Lebendigkeit. Das transzendentale double bind des Leibes besteht nicht darin, dass es das Leben gar nicht zulässt, sondern dass es nur eine ganz bestimmte Art von Leben zulässt; nämlich jenes, dass dem Leib verwandt ist und in ihm gespürt werden kann. Das Leben wird dem Organischen zugeschrieben, weil die Erfahrung des Leibes schon immer als organisch aufgefasst wird – ein weiteres Kantisches Erbe. Besonders an den Versuchen Ian Bogosts, die Innerlichkeit der Dinge zu denken mithilfe der leiblichen Erfahrung dieser[107], sieht man, wie die Phänomenologie an ihre Grenzen stößt, wenn sie das anorganische Leben denken will. Die zwei Einschränkungen der transzendentalen Leiblichkeit in der Phänomenologie für das anorganische sind also: erstens, dass man einen geordneten und funktionierenden und fungierenden Leib voraussetzt, von dem ausgesprochen werden kann. Setzt man diesen als Bedingung von Erfahrung, Bewusstsein und Lebendigkeit an, dann erscheint das Anorganische notwendig als nicht lebendig, da es diesen nicht besitzt. Zweitens, lässt sich das Leben des Anorganischen auch nicht leiblich erleben. Und, insofern dieses leibliche Erleben des Lebens der einzig sichere Ausgangspunkt für das Sprechen über Leben ist, verschwindet das Anorganische leben selbst wieder. „They start out from the fact of animation (self-affection, lived-body). This way they forget about the realm of unanimated matter.”[108] Legt man das Leben auf eine Art der Leiblichkeit fest, was auch heißt es auf eine Art der Physiologie und körperlichen Organisation festzulegen, dann bekommt man nur das Leben dieser Körper zu Gesicht. Es wäre doch eben die interessante Frage, welche Physiologien – außer der unseren – zum (Er-)Leben fähig wären und welche Vitalität sich in diesen finden lassen könnte. Diese anderen, anorganischen Physiologien, muss die Leibphänomenologie ausschließen, die nur den Menschen kennt. Die Phänomenologie ist damit das seltsame Analogon der Häckelschen These, dass das Organische nur aus Organischem folgt.
Es ist gerade Merleau-Ponty – Vater der Leibphänomenologie – der den Kampf mit dieser Innerlichkeit des Leibes aufgenommen hat und am Wendepunkt der Phänomenologie der Wahrnehmung gerade zu einer Ent-Leiblichung gelangt; durch die Betrachtung eines Würfels im Raum – minimalistische Kunst. „Der Würfel ist da, er ruht in der Welt.“[109] Dies ist die Weise in der der Würfel in der natürlichen Einstellung sich gibt – in seiner Würfelhaftigkeit. Erst danach setzt, im Ausklammern der natürlichen Einstellung, die Überlegung über das wahrnehmende Subjekt ein. Nach Merleau-Ponty vollziehen sich in dieser Überlegung vier Reduktionen, die nicht zufällig den Erkenntnisschritten des bisherigen Ganges der Phänomenologie der Wahrnehmung entsprechen. Zunächst wird der Würfel zum Würfel des Sehenden, sobald er sich gewahr wird, dass nur er ihn sieht und so sieht. Richtet sich die Konzentration noch mehr auf den Wahrnehmungsvorgang wird schnell klar, dass man nur die Hülle des Würfels sieht, ein Spiel aus Farben und Licht, nicht aber die Materialität des Würfels selbst. Ist dies erst einmal klar, dann wird dieses Spiel auf die perzeptive Grundlage dieser Erscheinungen zurückgeführt und in einem vierten Schritt auf das Empfinden, welches im Leib wurzelt, reduziert. Und hier wechselt Merleau-Ponty die Leserichtung seiner Analysen, „denn die Erfahrung des Dinges nimmt nicht durch all diese Vermittlungen ihren Durchgang […].“[110] Musste die Erfahrung diesen Weg beschreiten und notwendig sich auf den Leib reduzieren lassen, so „setzt[e man] an die Stelle des Dinges selbst in seinem originären Sein eine vollkommene Nachbildung des Dinges aus subjektiven Flicken.“[111] Der Leib rekonstruierte das Ding in sich und darin wurde es ganz aufgehen. Die Evidenz des Dinges an sich wäre der Preis dafür. Es geht in der Rückwärtslektüre der Analysen gerade darum die Punkte freizulegen, in denen das Ding nicht „Pol einer persönlichen Geschichte“[112] wird, indem es seine Materialität[113] nicht verliert, sobald man sich der Ansicht der Hülle bewusst wird. Das Ding als Ding Erst nehmen, heißt es nicht in der Repräsentation versinken zu lassen, sondern gerade die eigentümliche Schwere der Dinge in ihrer Präsentation zu behaupten. Dieses Problem ist Spiegel der zugrunde liegenden Problematik der Differenz, die gerade die Rückkehr zum Ausgangspunkt vermeiden wollte. Solange das Ding nur als leibliche Repräsentation seiner selbst gelten darf, kehrt alles zum Leib und damit zum Menschen zurück. Erst die Freilegung der Präsentation – durch das Einklammern des Leibes – verschafft der Differenz den Raum zu
erscheinen. Sie erscheint aber gerade als Einklammerung des Leibes. Was Merleau-Ponty zeigt, ist nicht weniger als die Nicht-Existenz des Anorganischen in der Leibphänomenologie, das nicht nur eine Negation des Lebendigen wäre. Die Univozität des Seins, in der Ich, das Organische, nur „eine Höhlung, eine Falte, die sich im Sein gebildet hat und auch wieder verschwinden kann“[114] bin, bildet genau die Grenze der Phänomenologie.
Man muss den organischen Leib einklammern, kann sich nicht mehr auf die ursprüngliche Erfahrung des Leibes verlassen, um das Anorganische wieder in den Blick zu bekommen. Solange wir phänomenologisch und in Kantischer Manier, die Frage des Lebens auf die Zugangsfrage verkürzen oder mehr noch durch die menschliche Erfahrung definieren, wird man nur diese Postulate als Antwort zurückbekommen. Die Phänomenologie bleibt zu organisch. All die Zitteranfälle Lévinas[115], die Delirien Marions[116] oder die Ipseität des Lebens Henrys[117] haben es nicht geschafft die Phänomenologie von innen her zu brechen – sie haben sie nur der „Phrenesis der Grenze“[118] ausgesetzt, ohne sie hinter sich zu lassen. Wir werden wohl sagen müssen, dass die Phänomenologie nicht falsch liegt, jedoch über das Anorganische und das Leben einfach nichts Interessantes zu sagen hat. Kants „logic of appearence depose ontology“[119]
Das organische Bild des Denkens
Kant jedoch kennt und bewundert das Anorganische, trotz allem. „[I]m 18. Jahrhundert veröffentlicht Kant bis zu seinem 46. Lebensjahr nur 11 ‚philosophische’ und 14 Schriften über Erdbeben, Winde, das Feuer, die Erdrotation und andere physikalische, astronomische und geographische Gegenstände.“[120] So sehr auch die vorkritische Philosophie von den Vulkanen und Wellen bewohnt wird, verschwinden sie aus den kritischen Schriften wieder. Wir kennen bereits die Steine aus denen Kant das Gericht der Vernunft erbaut. Aber eigentlich ist es kein Gebäude, kein Bauwerk, sondern ein Organismus. Obwohl der Organismus erst in der Kritik der Urteilskraft eine ausführlichere Besprechung bekommt, wirkt er doch schon als Idee und Ideal durchs Kants gesamtes vorheriges Werk. Nur heißt er hier noch sensus communis, eben jene zugrundeliegende Einheit der Vermögen, so sehr sie auch auseinanderstreben mögen, am Ende für „die Erkenntnis eine größte systematische Einheit“[121] zu garantieren. Will man die verschiedenen Vermögen nicht als zufällig harmonisch, oder durch Leibniz’sche prästabilierte Harmonie geordnet, beschreiben oder gar eines herausgreifen, welches alle anderen verbindet, wie Heidegger[122], dann muss man ein ordnendes Prinzip zu Grunde legen. Eine Einheit, die die Teile zu Gunsten des Ganzen arbeiten lässt, welches wiederum die einzelnen Teile in ihrer Aufgabe bestimmt und sie somit teilt.[123] Sensus communis ist die Idee des Ganzen, dass seine Teile bestimmt, welche wiederum das Ganze bilden. Aufwärts und Abwärts. Der Organismus des Denkens. Es ist eben diese geheime Einheit der Vermögen, die auch noch der Phänomenologie Husserls und Merleau-Pontys zugrunde liegt. An welcher Stelle sich nun aber die entelechialen Vorstellungen Kants mit dem Denken treffen, zeigt das Architekturkapitel der Kritik der reinen Vernunft, wenn es die Genesis eben jener Architektonik der Begriffe bespricht:
„Die Systeme scheinen, wie Gewürme, durch eine generatio aequivoca, aus einem bloßen Zusammenfluß von angesammelten Begriffen, anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig gebildet worden zu sein, ob sie gleich alle insgesamt ihr Schema, als den ursprünglichen Keim, in der sich bloß auswickelnden Vernunft hatten, und darum, nicht allein ein jedes für sich nach der Idee gegliedert, sondern noch dazu alle unter einander in einem System menschlicher Erkenntnis zweckmäßig vereinigt sind […]“[124]
Auch das Denken als Ganzes ist also nicht organisiert wie ein Bauwerk, welches man von unten nach oben aufbaut, sondern wie ein Organismus, bei dem die Zusammenschlüsse der Teil mehr und mehr das Ganze enthüllen und das Ganze immer schon die einzelnen Teil bestimmt und zusammenhält. Der Keim, das Gewürm – Organizität des Denkens. Denken, für Kant, heißt immer dieser doppelten organischen Kausalität zu gehorchen, die Teile durch die Vernunft bestimmen zu lassen – ihr zu folgen – und gleichzeitig durch die Teile und einzelnen Erkenntnisse langsam die Vernunft näher zu bestimmen. Es bedeutet die Begriffe „bis zu ihren Keimen und Anlagen zu verfolgen“[125] Das ist Kants organisches Bild des Denkens: „System der Epigenesis der reinen Vernunft“[126].
Organismus gegen Leben
In Kants Philosophie des Organischen gibt es jedoch einen unsichtbaren Riss, der sie noch nicht gefährdet, jedoch beunruhigt; der Spalt zwischen Organismus und Lebewesen. Auch wenn es heute fast redundant klingt, von Organismen als Lebewesen und vice versa zu sprechen, ist diese Adäquation bei Kant keineswegs selbstverständlich und eher noch höchst problematisch. Hatte doch Kant die Organismen eingeführt, um die lebendige Natur, die organisierten Naturprodukte zu untersuchen, erweisen sich nun aber nicht alle Organismen als Lebewesen im strengen und nicht einmal im weiteren Sinne.
„Leben heißt das Vermögen einer Substanz, sich aus einem inneren Prinzip zum Handeln, einer endlichen Substanz, sich zur Veränderung, und einer materiellen Substanz, sich zur Bewegung oder Ruhe als Veränderung ihres Zustandes zu bestimmen.“[127]
Diese frühere Definition des Lebens schließt sich scheinbar nahtlos an die spätere Argumentation der Kritik der Urteilskraft an. Fangen wir mit der unteren Schranke an. Insofern die Materie, die Kant im Blick hat, ihren Zustand nicht aus innerem Bestreben ändern kann, sondern nur durch äußere Kausalität, schließt Kant das „alle Materie als solche leblos“[128] ist. „Wenn aber nun die Materie nicht Träger des Lebens sein kann, stellt sich die Frage, ob nicht eine andere Substanz erforderlich ist?“[129] Was wäre eine solche Substanz? Sie müsste immateriell sein, um sich von der Materie zu unterscheiden, sie müsste dauerhaft, damit sie in allen Lebewesen vorkommen kann und sie müsste einfach sein, da sie nicht aus Teilen bestehen, kann sondern vielmehr das Prinzip des Ganzen wäre. Gerade eine solche Substanz diskutiert Kant als Grundlage einer rationalen Psychologie und verwirft sie radikal. Es wäre eine Substanz die die menschliche Seele über die Grenzen des irdischen Lebens ins unendliche „Leben“ tragen würde. Aber schon die Verwendung des Begriffs Lebens, wäre für das Jenseits verfehlt, es liegt jenseits der Vernunftbegriffe. Anstatt sich auf eine solche Substanz zu berufen braucht es nach Kant einen Lebensbegriff, der sich empirisch ausweisen lässt und damit auch physiologisch in einem Körper und psychologisch in einem Bewusstsein verankert ist.
Eine solche Fundierung vermutet Kant nun im Menschen in seinem Begehren und Denken, sowie in seinem Gefühl und Willen. Zweifellos hat er in diesen praktischen Vermögen Leben, indem er sich selbst Zwecke setzen kann, das heißt praktische Vernunft zu anzuwenden. Auch wenn Kant wiederholt betont die praktische Vernunft „ohne besondere Berücksichtigung auf die menschliche Natur“[130] zu bestimmen, legt die wenig später von ihm gegebene Definition des Lebens, „das Vermögen eines Wesens, nach Gesetzen des Begehrensvermögens zu handeln“[131], eher das Gegenteil nahe. Selbst mit dieser überaus schwach und offen formulierten Definition stellt sich die Frage, ob es überhaupt Organismen außer dem Menschen gibt, die man im strengeren Sinne als Lebewesen bezeichnen kann. Setzt das Handeln nach dem Vernunftvermögen nicht schon ein Subjekt voraus, dass auch der Vernunft als Gegenpol fähig ist, da die Gesetze des Begehrensvermögens – so betont Kant wiederholt – nur durch ein vernunftfähiges Lebewesen eingesehen werden können.[132] Schränkt man die Notwendigkeit, die Begriffe des Begehrensvermögens allgemein zu begreifen, ein und meint nur singuläre Begehrensvermögen, so fallen vielleicht auch höhere Tiere darunter. Und so scheint sich dir untere Schranke der Lebensdefinition zu verschieben, denn auch wenn Kant Pflanzen zweifellos den Status von Organismen zuschreibt[133] – man sie sogar so behandeln muss „als wenn die Empfindungen hätte“[134] – sind sie nicht streng lebendig. Selbst wenn wir die schwache Definition des Lebens ansetzen, tendiert die Pflanze noch eher dazu ein organischer Mechanismus zu sein – machina hydraulica, wie Linné sie nennt – als ein Lebewesen, dass seinem Begehrensvermögen handeln kann.
Wie die Bewertung auch ausfallen mag, so zeigt sich der Riss als eigentlich interessantes Problem. Dient die Definition des Lebens in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaften zunächst dazu, das Organische vom Anorganischen zu trennen, so führt sie nun einen Hiatus innerhalb des Organischen ein, der dessen Ordnung im Ganzen beunruhigt. Es scheint die Dreistufung von anima rationale (Mensch), anima sensitiva (Tiere) und anima vegitativa (Pflanzen) wieder plausibel zu machen, wobei die Höheren die jeweils Niederen mit rekapitulieren – eine Spaltung, die Plessner als Systematische Grundlage für seine Philosophie des Lebens verwenden wird. Wie stark dieser Riss durch die Vermögen wirkt, zeigt Heideggers Ausführung des Problems in den Grundproblemen der Metaphysik: „der Stein (das Materielle) ist weltlos, das Tier ist weltarm, der Mensch ist weltbildend.“[135] Im Zuge der Analyse des Begriffs der Welt, welche er über die Offenheit der Seienden in der Welt zur Welt bzw. zu dieser Offenheit definieren will, begegnet uns plötzlich diese Trennung. Heidegger Konzipiert die Welt-Analyse als Vergleichende Studie in der er aus dem Vergleich der Weltoffenheit der Menschen, Tiere und Pflanzen näher an die Offenheit der Welt selbst gelangen will. Dabei fängt er in der Mitte an und vergleicht Tiere sowohl mit den Steinen wie auch mit dem Menschen. Giorgio Agamben ist dabei schon die versteckt konservative Haltung Heideggers aufgefallen, die den Menschen vor der „Vertierung des Menschen“[136] retten soll, indem eben das Tier in eine paradoxe Verrückung gesetzt wird: „offen in einer Nicht-Unverborgenheit“[137]. Es ist nicht in derselben Weise wie der Mensch offen, da es im Offenen steht, aber eben zu der Offenheit als solcher kein Verhältnis hat – denn das „Offene ist das Sein selbst“[138]. Erstaunlicher ist dabei nicht nur die überspitzte Rolle, die Heidegger dem Menschen zuschreibt, sondern die absolute Abwesenheit der Begründung, wieso die Steine eine so abgeschiedene und eingeschlossene Rolle in Bezug auf die Offenheit zunehmen. Obwohl der §47 diese verspricht, erhalten wir nur eine Orgie an Evidenzen, wieso das Tier die Welt entbehrt[139], dies aber immer noch dem Stein überlegen ist, der „dergleichen wie Welt nicht einmal entbehren kann.“[140] Und Heidegger sieht am Wegesrand eine Eidechse sich auf einem Stein Sonnen. Die Eidechse berührt den Stein und fühlt, jedoch der Stein >berührt<[141] die Eidechse nur. Tauschen sie nicht dennoch Hitze und Partikel – wird nicht Eidechse auch Stein wie sie auch Sonne wird? Affizieren sich die beiden nicht wirklich und be- und entgrenzen sie sich nicht, wie das Fahrrad die Polizisten und andersherum? Heidegger – ganz Aristoteliker – geht immer noch von Körpern aus, die interagieren, jedoch sich in ihrer Körperlichkeit nie wirklich beeinflussen. Singular-Sein statt Plural-Sein, beim Denker des Mit-Seins. Inwieweit die Heideggersche Annahme jedoch gerechtfertigt ist, versucht er erst später so zu begründen:
„Aber ebenso wenig ist die Eidechse auch nur neben der Felsplatte und unter den Dingen, z.B. auch der Sonne, vorhanden wie ein danebenliegender Stein, sondern sie hat eine eigene Beziehung zu Felsplatte und Sonne und anderem. Man ist versucht zu sagen: Was wir da als Felsplatte und Sonne antreffen, das sind für die Eidechse eben Eidechsendinge.“[142]
Wieso aber die Eidechse eine Perspektive hat und der Stein nicht bleibt fraglich. Ist nicht auch der Stein, vielleicht in einer niedrigeren Potenz, eine Kraft die andere affiziert und affiziert werden kann, die ein aktives Verhältnis zu Sein hat, insofern es andere Seiende affiziert und damit sehr wohl eine eigene Beziehung zu ihnen hat? Das gleiche gilt für Heideggers letztes Argument für die Angrenzung, die Umwelt. Hat nicht auch ein Stein ein Umfeld, auch wenn er kein Territorium absteckt – verhandelt er nicht auch immer wieder seine Grenzen mit der Umwelt, je nach dem welchen Körpern er begegnet? Tuen dies nicht auch die Pflanzen, die Heidegger ganz auslässt. Und führt uns diese Einteilung nicht direkt zu den fruchtlosen Debatten, wie sie zurzeit geführt werden, ob ein Bakterium oder bestimmte reizbare Mineralien lebendig sind?
Am Ende wiederholt Heidegger die Inkonsequenz von Duns Scotus, mit welchem Heidegger seine akademische Laufbahn begann. Obwohl er die Univozität des Seins fordert, senkt Duns Scotus – wahrscheinlich aus Angst (berechtigt) als Häretiker zu gelten – sein Banner und lenkt ein. Kreatur und Schöpfer sind metaphysisch univok, jedoch physisch analog – sie partizipieren metaphysisch am selben Sein, doch ist dieses Sein physisch nicht für alle das Gleiche. Insofern sie das Offene selbst ‚sehen‘ können, sind sie physisch näher am Sein. Heidegger hierarchisiert die univoke Immanenz des Seins wieder, in der es nicht reicht univok in der Welt zu sein, sondern sich auch zu ihr verhalten muss. Traum einer versteckten Authentizität. Als seien die Ränder von Heideggers Feldweg nicht mit Steinen gesäumt, und als würde ihn auch nicht der mineralische Boden tragen, wenn er zum Sein unterwegs ist.
Kantische Groteske
Was wäre das aber für eine Welt, in der das regulativ-subjektive Prinzip der Natur nicht gelten würde? – wenn die Welt geschehen würde ohne Retroaktivität in der chemischen Gradlinigkeit, die Schelling so liebte. Was wäre, wenn die Welt wirklich eine Idee wäre, die sich wiederum nicht als teleologisch begreifen lässt?[143] Oder ist nicht vielleicht sogar die Umkehrung viel verstörender, dass auch die Steine und Lilien ihre kleinen Hände ausfahren und nach den Lebenden greifen, dass selbst ein Virus nach seinen Zwecken handelt und sie sich setzt, und auch die Autos und sowieso Cthulu. Wenn die Entelechie überall wäre oder wenn sie nirgendwo wäre, wenn sie die Welt nicht mehr Hierarchisieren würde, dann wäre die Welt, wie Aristoteles richtig sagt, monströs. Die Kinder hörten auf, ihren Vätern ähnlich zu sehen – in denen die Mutter über den Samen des Vaters triumphiert, das Grauen des Aristoteles, gar Monster.[144] Ödipale Groteske. Und dann stände der ganze evolutionary trash auf, und würde sich weigern sich in die Zweck-Mittel Ganzheit der Evolution einzufügen, und die Natur würde Sprünge machen – inkommensurable evolutionäre Diskontinuität. All die Missgebildeten würden sich in Kants Garten versammeln und ihm vier blättrige Kleeblätter überreichen – Kant könnte sie nicht zurückdrängen in die engen Räume der Abweichungen. Und dann setzt einer von ihnen auch noch den Kaiser ab. Und das Placebo des Als-Ob der Teleologie hört auf zu wirken. Eine Welt, in der Aristoteles mit langen krausen Haaren geboren wird und erstaunlich befriedigt damit ist. Eine Welt in der nur noch Monster geboren werden und die man allmählich die das alte Ideal vergisst – herrliche falsche Welt. „Die Existenz von Monstern stellt das Leben hinsichtlich des Vermögens in Frage, uns Ordnung zu lehren.“[145] hört man noch einen tausendköpfigen Canguilhem murmeln.
Was wäre das für eine Welt, in der den Künstlern der Kopf fehlte, während ihre Hände weiter formten. Schaffen ohne Intention – die Kunst, die sich selbst schafft. Maschinenkunst. Gerade, wenn die Kunst keine Künstler mehr voraussetzt, die Bilder nur noch Empfindungsblöcke sind, die Musik nur noch anorganische, versteinerte Schwingung der Welt, beginnt man die Bilder und Klänge der Weltmaschine zu fühlen. Und man erhebt den Pinsel und zerstört damit die Leinwand, und man macht Lärm und verkauft ihn auf CDs, die die Leute mit ihren Bäuchen hören. Die Existenz von Lärm stellt die Kunst hinsichtlich des Vermögens in Frage, uns Ordnung zu lehren.[146] lacht Deleuze, der sich zum Spaß als Mensch verkleidet hat und deswegen wie ein Clown aussieht.
Der „Archäologe der Natur“[147] gräbt weiter und weiter. Er findet auf dem Grund nur noch mehr Grund. Wenn er weiter gräbt, wird er den Kern erreichen und das nicht überleben. Doch er war besessen auf der Suche nach etwas geworden, dass er im Brunnen gesehen hatte, einen Stein von Farben, „die von den normalen Spektralfarben völlig verschieden waren“[148], und vermutete seinen Ursprung tief in der Erde. Ein Licht, nicht von dieser Welt, und ein Flüstern, dass allem organischen Leben unbekannt war[149] – und aus den Tiefen des Alls kam; unendlich viel älter als die Ende, unendlich viel tiefer als die Organismen. Kosmische Unmenschlichkeit – die Alten, die Shoggoth – Protoplama mit mathematisch angeordneten Augen. Keine Missbildung – viel zu alt, um noch von irgendetwas abzustammen. Am Grund liegen nur diese Alten, die Formlosen. Am Grund sind nur Synthesen und Disjunktionen. Man kann die „Farbe aus dem All“[150] nicht beschreiben – sie treibt die Vermögen so weit auseinander, dass sie Disjunkt werden. Der Wahnsinn der Wahrnehmung, vor dem Kant sich mit dem Transzendentalen schützen wollte – der Horror des transzendentalen Empirismus. Kant beschwört Chthulu aus unbekannten Dimensionen, der nicht in diese Welt gehört, den das Transzendentale nicht stoppen wird. Der unbeschreibliche, sich ausbreitende Glanz des Meteoriten und die Unmenschlichkeit Chtulus zerrütten den Sensus communis, heben die Sammlung und Innerlichkeit des Körpers aus. Die Körper breiten sich aus, das Leben breitet sich aus – es ist nicht mehr lokalisierbar.
Und wir wollen diese Welt, in der die Maschinen leben – ja das Leben sind. In der sie Missbildungen produzieren, bis jeder ein Monster ist. In der die Differenzen frei sind und ihre Heime, die Entwicklung und die Evolution, zerstört haben. In der das Fleisch von den Knochen rutscht und das elektronische Innenleben freilegt.[151] In der andere Physiologien als die des Menschen, die Wahrnehmung ins Unbeschreibliche treiben. Wir wollen diese monströse Welt, weil sie die einzige ist, die es gibt.
Kapitel 2 – Anorganik
„’the world upon which we live is itself a living organism, endowed, as I believe, with a circulation, a respiration, and a nervous system of its own.’ Clearly the man was a lunatic.”[152]
- Odradek als philosophische Kategorie (Einleitung)
Von all den Namenlose, Transformierten und Untoten, die Kafka aufziehen lässt, entzieht sich einer besonders der Kategorisierung; Odradek. Als gemeiner Hausgast, als Stein des Anstoßes oder blinder Fleck. Odradek ist oberflächlich nicht mehr als eine Zwirnspule, die sich aber scheinbar willentlich und dabei auch noch sehr geschickt auf zwei Stäben durchs Haus bewegt, verschwindet und auftaucht nach eigenem Willen – lacht und rennt, antwortet, aber nie fragt. Doch gerade als solcher verunsichert er die Kategorien von Leben und Tod, Organischem und Anorganischen und schließlich von Ding und Mensch. Man weiß nicht, ob man ihn als Kind oder als das Stück Holz, das er ist, behandeln soll. Und wie behandelt man Holz? Schon seine Gestalt untermalt diese gar ontologische Unsicherheit[153]. Er scheint zu keinem bestimmten Zweck geschaffen, noch einen zu erfüllen und doch ist er fertig, ihm fehlt nichts, obschon sein Lachen das Fehlen der Lunge hörbar macht. Und doch keucht er nicht. Seine Organe sind auf der Oberfläche. Selbst sein Eigenname ist ein blinder Fleck. „Die Unsicherheit beider Deutungen [deutsch oder slawisch] läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“[154] Er hat keine Genesis, keine Herkunft, keine Heimat. Und selbst wenn er sie hat, ist sie längst vergessen, doch man ahnt, dass er keine hat und dass wenn sie vergessen wurde nur dieses Vergessen allein da ist, nichts was vergessen wurde. Odradek ist unbedingt.
Mehr als eben diese Heimatlosigkeit ist nicht zu bekommen, wenn man ihn fragt, wo er wohnt: „Unbestimmter Wohnsitz“[155]. Nicht nur seine Herkunft, seine Vergangenheit, sondern auch seine Gegenwart ist verschoben. Unbedingt und ohne Genese (wir wissen nicht, ob er essen muss, schläft, aber man vermutet: nein) ist er ganz und gar ungleichzeitig mit dem Leben in der Gegenwart – muss sich nicht in jedem Moment neu schaffen durch einen Stoffwechsel schaffen und doch lebt er. Und eben diese ontologische Ambiguität dehnt Odradek bis in die letzte Möglichkeit der Zukunft aus. Der Hausvater weiß nicht, ob Odradek sterben muss oder es zumindest kann, doch „die Vorstellung, daß er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.“[156]
Odradek ist die ultimative Phantasie einer Lebendigkeit der Dinge.
Diese unterscheidet sich jedoch substanziell von den Utopien, die Plessner einst in den Maschinen aufspürte[157], eines Gegenstandes, der die menschlichen Mechaniken so gut imitiert, dass er lebendig würde. Eine Utopie, die die griechische Mythologie um Hephaistos und seine Roboter genauso wie die Terminatorfilme der 1990er Jahre antreibt[158]. Keiner hat diesen Fetisch so eingefangen wie Fritz Lang in Metropolis in der die Protagonistin Maria als dämonischer Roboter das Leben der biologischen Menschen auf globaler Ebene bedroht. Das Fleisch wird durch Metall ersetzt, das industrielle Körper-double geschaffen, von dem die Industrialisierung schon seit der Einführung der Maschine träumte;[159] Wirtschaftswachstum, ohne träges Fleisch, aber als Imitation der ursprünglichen Arbeitskraft. Doch auch diese Maria Maschine ist kein Ding jenseits ontologischer Kategorien wie Odradek, vielmehr ist sie gerade Ausdruck der höchst sexualisierten und geschlechtlichen Beziehung zwischen der Industrie und ihren Subjekten[160]. Nicht zuletzt eine Marxistische Phantasie, die – Hegelscher Geschichtsphilosophie aufruhend – Technologie als treibenden Motor des sozialen Fortschritts sah und dabei gerade die Unmenschlichkeit des industriellen „Anderen“ erfand.[161] Während die Maschinen fragen, inwiefern sie auch organisch oder gar menschlich sind, oder ob wir in ihrem Licht, nicht auch nur „walking, talking minerals“[162] sind, löst sich Odradek von uns, er ist lebendig – ob wir es ihm zusprechen oder nicht. Die Frage des Animismus, der mit jeder neuen Technologie Einzug hält, interessiert hier nicht.
Odradek, als philosophische Kategorie, hat also nichts gemein mit den Bildern eines „Ghost in the machine“[163] oder dem metallischen Doubles des Menschen als Roboter. Während diese das Leben des Menschen imitieren, zeigt Odradek ein Leben jenseits oder unabhängig dieser Bedingungen. Er ist die klassische Figur eines irreduziblen Überschusses, der sich ungleichzeitig entfaltet und damit in der Gegenwart nie aufgeht. Er ist, „was zu nichts dient“[164] und sich doch in der Gegenwart als etwas ankündigt, wie Lacans jouissance oder eben das schon immer entzogene Ding – obwohl sie (a priori) nicht erreicht werden kann, hält sie das Begehren/das Leben gerade am Laufen und verhindert die die endgültige Entspannung (Tod). Kafkas Werk ist voll von diesen Untoten und gerade deswegen lebendigen Figuren wie Odradek; die Wunde des Landarztes, die nicht heilt, aber ihn auch am Leben erhält, der Prozess, in den sich K. verwickelt, ohne die Klage zu kennen, der ihn aber auch nicht gehen lässt oder eben der Messias, der erst kommen wird, wenn es zu spät ist, doch auf den man nicht aufhören kann, zu warten.
Es ist eben jene Lebendigkeit der Dinge, die in den Fokus zeitgenössischer Philosophie gerückt ist und verspicht, den Bann der Trägheit von anorganischen Aktanten zu lösen. Man kann die Spielmarke an uns verschieben, indem man zeigt, wie wir uns selbst immer schon als denkende und empfindende Dinge verstanden haben[165] und wie wir gar selbst Henkel einer gesellschaftlich-kulturellen Kanne sind[166] oder man vergisst uns – im besten Sinn – und wendet sich der Welthaftigkeit der Dinge selbst zu.[167] Es ist jedoch gerade Deleuze – der unfreiwillige Materialist – der die Diskussionen, um eine Philosophie nach Nietzsches Credo, über uns hinaus zu denken, aufs Neue entfacht hat.[168] Eloquenteste Stimmen dieser neuen Bewegung waren vor allem die Object-Oriented-Philosophie, wie der Neo-Vitalismus, die beide eigene Visionen einer nicht-organischen Vitalität zeichnen. Es wird jedoch zu Fragen bleiben, wie weit die Dimensionen der Deleuze’schen Idee des anorganischen Lebens ausgelotet und Möglichkeiten wirklich erschöpfend zu Ende gedacht wurden. Sie werden sich an der Frage messen lassen müssen, wie weit sie der Kantischen Anti-Physik des Lebens entkommen können.
- Object-Oriented-Philosophie (Harman)
„I taught at Gray in the French provinces for a year.” schreibt Latour anekdotisch; “At the end of the winter of 1972, on the road from Dijon to Gray, I was forced to stop, brought to my senses after an overdose of reductionism.”[169] Ein Reduktionismus, der den Dingen ihre Eigenständigkeit raubt und gleichzeitig mit seiner Aufdeckung das Versprechen abgibt, diesem Leben der Dinge wieder gewahr werden zu können. Gegen die Anti-Realistische und linguistisch geprägte Stimmung Frankreichs seit den 60er Jahren, setzt Latour eine erneute Analyse der Wissenschaften, die nicht versucht, sie ausschließlich auf ein Spielfeld von Machtbeziehungen oder Diskursen zu deskreditieren, sondern die besondere Art der Beziehung zwischen Forscher, Wissenschaft und Gegenstand herauszuarbeiten; die Akteur-Netzwerk-Theorie. Bereits seine frühen Schriften wie Laboratory Life, zeigen einen neuen epistemologischen wie ontologischen Zugang zum Gegenstand der Wissenschaften und somit zur Wissensproduktion generell. Jedoch besonders das frühe Werk zeigt den neuen Ansatz Latours, in welchem nicht die Person Pasteur im Vordergrund steht, sondern die verschiedenen Dinge und Kräfte, die mobilisiert werden mussten, um Pasteurs Theorien sowie Heilmittel akzeptiert zu machen. Einerseits betont Latour damit, dass die Akzeptanz einer Theorie nicht nur auf Experiment und Begründung aufbauen, sondern viele zusätzliche Kräfte eine Rolle spielen. Entscheidend ist jedoch die Gewichtung dieser Kräfte. Das Spiel der menschlichen und nicht menschlichen Akteure beginnt schon hier; Mikroben, Heilmittel, Geld, Pasteur, die Öffentlichkeit und (unfreiwillige) Testpersonen, die in einem komplexen Netzwerk nicht nur interagieren, sondern sich konstituieren. Die Dinge erfahren in diesem wissenssoziologischen Kontext implizit eine ontologische Gleichstellung, wie sie in der Post-Kantischen Landschaft fast unmöglich schien. Nicht nur die beteiligten Personen, sondern auch die Mikroben sind die Summe ihrer Siege und Niederlagen mit anderen Dingen.[170] Man kann sie nur in jenem Netzwerk verstehen, dass sie konstituiert und auf die sie wiederum Einfluss nehmen. Eben dieser Impetus, die Dinge als sie selbst zu betrachten, ohne sie auf andere Entitäten, Dynamiken und Begriffe zu reduzieren, ist genau der Anstoß, der die Philosophie Graham Harmans durchzieht. Nur aus diesem Kontext ist das Aufkommen der Object-Oriented-Philosophy zu erklären, die ebenfalls nicht menschlichen Akteuren, bzw. auch nicht organischen Akteuren den gleichen ontologischen Status einräumt. Diese Wende lässt sich – wie schon Latour bemerkte und Harman predigt – nicht ohne eine angemessene Metaphysik konsolidieren. Das Bedenken der Dinge als nicht organische Akteure und individuelle Dinge hat jedoch von Beginn an keinen leichten Stand. Vielmehr war die Philosophie (besonders des 20.Jh.), so Harmans Rundumschlag, damit beschäftigt, die Objekte zu eliminieren oder zu reduzieren, anstatt sie eigens zu bedenken. „Radical Philosophers are all reductionist in character.“[171] Die Tragweite dieser Anschuldigung lässt sich leichter durch die Fülle an gegnerischen Positionen verstehen mit denen sich Harman konfrontiert sieht; hier seien zur Skizzierung nur einige genannt.
Die Kantische Trennung zwischen dem Noumenalen und dem Phänomenalen kennzeichnet gerade den Rahmen und die Unmöglichkeit der individuellen Dinge. Indem das „Ding an sich“ den Phänomenen zwar zu Grunde liegt, jedoch selbst unzugänglich bleibt, kann es für Kant nie Denkinhalt werden. Zunächst scheint diese Position (und auch die verschiedener anderer Idealisten) Harman in die Hände zu spielen; das Ding an sich scheint eine Verschlossenheit vor dem menschlichen Geist zu besitzen, der es als autonomes Ding möglich macht. Dieser Pyrrhussieg würde aber einerseits das Ding ganz aus dem Bereich des Phänomenalen abziehen und alle sichtbaren Dinge nur in Oberflächen oder Illusionen verwandeln. Anderseits, und entscheidender, bedeutet ein „Ding“ hinter den Dingen der Erscheinung zu denken, immer noch, es eben nur zu denken. Es ist immer noch nur, insofern es sich als die Grenze beständig zeigt, die in jedem Phänomenalen mit aufkommt. Man könnte über Dinge eben nur als diese Grenze sprechen – als Korrelat des menschlichen Geistes. Eben diese Grenze, mit der das Ding identifiziert werden muss – oder für die zumindest eine isomorphe Struktur postuliert werden muss, haben wir bereits als Post-Kantische Ausläufer in der Phänomenologie gesehen. Das Vorhaben Harmans, den Dingen gerecht zu werden, wird also teilweise auf der Auflösung der Korrelation von Denken und Sein bestehen, die den Grundpfeiler der Kantischen Philosophie bildet.[172]
Diametral entgegengesetzt scheint die empiristische[173] Position Humes zu sein, bei dem Objekte nicht mehr sind als habituelle Bündel von Qualitäten, die unter einem Begriff zusammengefasst werden. Alles, was das Ding ist, ist zugänglich und tritt offen zu Tage, da es keine Tiefe, keine Eigenheit besitzt. Zwar scheint die subjektive Klippe Kants hier überwunden, insofern der stets delirierende Geist selbst erst ein Subjekt kontrahiert[174] und somit nicht (maßgeblich) entscheidend für die Konstitution des Dinges ist; jedoch jetzt um den Preis, dass das Ding in ein Universum reiner empirischer Qualitäten aufgelöst wird.[175] „Here, the object is nothing more than the habitual linking of red, sweet, cold, hard, and juicy under the single term ‚apple‘.”[176]Während Harman in Kant einen Sinn für die ‚Zurückgezogenheit‘ der Dinge findet, jedoch im Noumenalen ihre Phänomenalität opfern müsste, findet er bei Hume die ‚Offenheit‘ der Dinge, die nicht an einem (transzendentalen oder empirischen) Subjekt hängt; jedoch auf Kosten ihrer Tiefendimension.
Die offensichtlicheren Gegner einer Object-Oriented-Philosophy kommen in Harmans Schriften jedoch – vielleicht gerade wegen ihrer diametralen Opposition – weniger vor; die Prozessphilosophien. Insofern Bergson dem Werden das Primat einräumt gegenüber den Instanzen des Seins, wäre eine Philosophie, die versucht sich um gegenwärtige, und vollständig individuierte Dinge zu gruppieren zwar nicht vollkommen unmöglich, würde sich aber doch nur an den jeweiligen und fliehenden Kristallisationen des Werdens festhalten und damit das Entscheidende verpassen; das Werden. In genealogischer Perspektive würden die Dinge ebenfalls nicht vollkommen ihre Bedeutung verlieren, insofern sie (wie bei Nietzsche oder Foucault) aus der Sicht ihrer Genese und Geschichtlichkeit betrachtet werden. Sie bestimmen sich somit als ihre Geschichte. Auch wenn die Kritik Harmans an dieser Stelle überzogen ist, ist die Bewegung entscheidend: damit Dinge überhaupt sie selbst sein können, müssen sie ihre Herkunft (und auch gegenwärtige Genese) abstreifen. Besonders deutlich wird diese Tendenz bei Harmans umfangreicher Behandlung von Manuel DeLanda, dessen proklamierter Realismus ein (wenn auch nur einseitig gefühltes) Band zwischen beiden knüpft. Deleuze und Simondon[177] aufnehmend versucht DeLanda die Materieströme und deren prozessuale Individuation in semistabile Systeme und Dinge nachzuzeichnen. In einer deleuzianischen Radikalisierung Bergsons ist das Werden bei DeLanda nicht mehr ein homogener Fluss, sondern immer schon in Differenz und durch intensive Differenzen, die produktive Prozesse antreiben und die extensiven Differenzen der Oberfläche (Sein) herstellen, differenziert. Diese extensiven Differenzen wiederum beeinflussen jedoch die intensiven Differenzen, ähnlich wie die Vektoren in einem Vektorenfeld zu Attraktoren streben, diese aber erst durch dieses Verhalten zu Attraktoren werden und sich durch das Strömen verändern.[178] Das Ding, das Harman also gerne als Autonomes untersuchen würde ist bei DeLanda nicht nur zweifach gebunden, sondern ein Ding ist sein Werden und damit seine Geschichte und vice versa. Insofern ist das Ding bei DeLanda sein Werden und damit seine Geschichte durch die Beziehung mit anderen Dingen und den Prozessen, die es affiziert und von denen es affiziert wird. In all diesen Bindungen sieht Harman Einschränkungen der Lebendigkeit und Autonomie der Dinge. Im Kontext des Monismus, ebenso wie in den genealogischen oder Prozessphilosophien taucht ein Name nie auf; Gilles Deleuze. Selbst die spekulativeren Schriften Nancys mit ihrem obskuren „whatever“[179], welches erst durch seine internen Relationen die Form eines einzelnen Dinges annehmen kann, findet Einlass; oder das formlose il y a[180] des frühen schlaflosen Lévinas, dass sich wie ein Alptraum vor denen aufbaut, deren Bewusstsein die Objektkonstitutionen nicht mehr leisten kann; formloses Es gibt, das nur das Bewusstsein zu einzelnen Dingen hypostasiert. Aber nirgendwo wird Deleuze besprochen und doch ist er allgegenwärtig als Weißer Wal Harmans. Deleuze ist gleichzeitig der Philosoph der Relationen und Individuationen, aber eben auch der Denker des Einen; absoluter Monist.
Das Leben und die Eigenheit der Dinge werden, in der reduktiven Bewegung all dieser Philosophien, immer wieder zerstört und verneint. Wenn bereits für Latour der Unterschied zwischen Menschen und Sand nicht der entscheidende ist, will Harman diese These noch radikalisieren. Er gibt Latour vollkommen recht, dass „discovering objects is more important, than eliminating them“[181], will die Dinge jedoch noch aus ihrer soziologischen-relationalen Verklammerung bei Latour lösen. Denn, insofern wir bereits sagten, dass die Dinge die Summe ihrer Siege und Niederlagen sind, „we could say that Latour wants to eliminate objects in favor of their effects.“[182] Sind die Dinge nur Effekte ihrer (affektiven) Relationen, kann ihre Identität und Eigenheit nie aus ihnen selbst erklärt werden; sie lösen sich in diese auf – eine erneute Reduktion. Paradoxerweise beginnt Harman seine Suche nach dem Leben der Dinge genau bei den Wurzeln Latours: Heidegger und Whitehead. Mit der Frage: „will philosophy continue to lump together monkeys, tornadoes, diamonds, and oil under the single heading of that-which-lies outside?”[183] began Harman bereits 1999 von einer Object-Oriented-Philosophie zu sprechen. Kaum zu überhören ist der phänomenologische Impetus dieser Frage, die Husserl bereits in abgewandelter Form stellte, inwiefern man über die Objekte als eine mengentheoretische Gruppe sprechen kann. Niederschlag und Echo findet diese Frage prominent in Heideggers Zeug-Analyse in Sein und Zeit, die ohne große Umschweife zu verlieren, gleich nach der Exposition zum dritten Kapitel „Die Weltlichkeit der Welt“ als dessen Kern ausgefaltet wird. Hier wird die – für unsere Untersuchung wichtige – Blickrichtung deutlich, „wenn wir untersuchen fragen: welches Seiende soll Vorthema werden und als vorphänomenaler Boden festgestellt werden? Man antwortet: die Dinge.“[184] Insofern die Dinge aber nur als res in den Blick kommen ist ihr ontologischer Charakter verfehlt, sie kommen als bloße Dinge in den Blick, denen in unerklärlicher Weise Werte und Gebrauchsweisen „anhaften“. „Die Griechen hatten einen angemessenen Terminus für die »Dinge«: πράγματα, d. i. das, womit man es im besorgenden Umgang (πρᾶξις) zu tun hat.“[185] Das Zeug selbst als Einzelding „ist“ nicht, insofern es sich selbst verbirgt in seinem „Um-zu“; der Boden auf dem man geht, oder der Hammer, mit dem man hämmert, sind strenggenommen nicht im Bewusstsein – sie erscheinen nicht als Vorhandenes. Sie sind in ihrer Anwesenheit als Zeug gleichzeitig abwesend, stehen gleichzeitig immer schon in einer Zeugganzheit (doppelte Unmöglichkeit eines res als ontisch). Diese gibt den Dingen ihre Charakteristik als Zeug, wird gleichzeitig aber auch durch diese bestimmt – bis hin zu Harmans Behauptung: „The displacement of the tiniest grain of dust on Mars alters the reality oft he system of objects, however slightly.“ Kurz: Dinge sind schon immer und zuerst (a-präsent) zuhanden als (präsent) vorhanden. Erst wenn sie nicht mehr richtig funktionieren, sich ungewohnt gebärden oder simple nicht da sind treten sie und ihre Vorhandenheit ins Bewusstsein. Ansonsten bleibt das Leben der Dinge geheim, a-präsentisch und versteckt.
Einschub: Stromausfälle (Coole)
Hier steht man offensichtlich an einer Kreuzung, was die Nutzung der Zeug Analyse angeht. Dass das Leben der Dinge nicht gegenwärtig ist und die Vorhandenheit auf ontischer Stufe aufwiegt oder ihr vorausgeht, lässt zwei methodische Wege zu dieser vitalen Dimension der Dinge zu: Auf den Moment der Aufdeckung der Zuhandenheit im Übergang zur Vorhandenheit setzen oder die Zuhandenheit als Untersuchungsobjekt selbst annehmen. Der erste Weg stellt insofern eine methodische Erweiterung zum Heideggerschen Ansatz dar, insofern es hier nicht um Zeugganzheiten oder Räumlichkeit in Verbindung zum Platz der Dinge geht[186], sondern gerade um jene, von Heidegger nur kurz angesprochenen, Momente geht, in denen der Platz verfehlt, der Zeugganzheit widersprochen und dem „Um-zu“ entsagt wird. Die Phänomene, die hier in den Blick kommen, bestätigen zwar die Zuhandenheit, aber eben durch dessen Brechung. So ist bei Phänomenologen wie Hermann Schmitz nicht der athletische und griechische Körper Merleau-Pontys der Protagonist, sondern der vom Schmerz entstellte Körper[187], der Stuhlgang oder die Lähmung; da wo der Körper aufhört zu funktionieren beginnt Schmitz. Immer wieder tritt bei Benett der Stromausfall[188] als globales Ausfallen der Zeugganzheit auf, der uns an die Eigenständigkeit und Unberechenbarkeit der Dinge erinnert. Das gleiche Phänomen hat auch Žižek wiederholt im Auge, der hier den Durchbruch des Realen gegen die symbolische Ordnung sieht. Und nicht zuletzt ist das philosophische Universum von Jane Bennett bevölkert vom Übergewichtigen, denen das zuhandene Essen jede Lebensqualität nimmt. Am eindringlichsten konfrontiert uns Bennett jedoch mit dem Müll, dem unauslöschlichen Vorhandenen, dass sein „Um-zu“ abgelegt oder verspielt hat, sich aber gerade deswegen in Massen aufdrängt. Dieser Ansatz untersucht den Wiedereintritt des Vorhandenen ins Bewusstsein. Wie wir aber bereits bei Merleau-Ponty sahen, macht dies sie Dinge erstens ontologisch dunkel oder opak, insofern sie nur noch als das „Andere“ oder die Ausnahme ihre Wahrheit enthüllen. Nur wenn die Dinge widerstehen, können wir sie bedenken und ihrer Eigenheit gerecht werden. Inwieweit dieser Ansatz aber die grundlegende ontologische Hürde einer Neubewertung von Zuhandenem und Vorhandenem bestehen kann, ist fraglich. Wenn wir die Dinge aus dem Aufkommen ihrer Vorhandenheit beschreiben wollen, dann setzen wir die Zuhandenheit nicht nur voraus, sondern machen diese kontingent mit ihrer Vorhandenheit, was am Ende etwas und jemanden (Dasein) voraussetzt, der diesen Dissens bemerkt und ontologisch bewertet. Die Epistemologie (Zuhandenheit durch Vorhandenheit erkennen) frisst die Ontologie.
Ende des Einschubs:
Den anderen Weg geht Harman, indem er die Heideggersche These der dem Dasein begegnenden Dinge als Pragmata noch radikalisiert. Er behauptet: „But in fact equipment [Zeug] in Heideggers sense is global; beings are tool beings“[189] Und tatsächlich scheint Heidegger in Sein und Zeit dieser globalen These des Zeugs zuzustimmen, was sich vor allem an seinen späteren Überlegungen über Kunst zeigt, in denen er damit ringt, ob Kunstwerke Zuhandenes oder Vorhandenes (als einzige ontologische Kategorien aus Sein und Zeit) seien[190]; er entscheidet keines von beiden. Doch folgen wir für einen Moment der Harmanschen Radikalisierung: Seiendes ist Zeug, insofern Zuhandenheit ein ontologischer Begriff ist. Lesen wir dafür Heideggers Frage am Beginn von Sein und Zeit einmal neu: „An welchem Seienden soll der Sinn von Sein abgelesen werden, von welchem Seienden soll die Erschließung des Seins ihren Ausgang nehmen?“[191] Heidegger antwortet: Dasein. Insofern nun das Dasein, zwar kein Ding unter Dingen ist im Sinne von res, bestimmt Heidegger es als Seiendes und damit der globalen These des Zeugs folglich auch als Zeug. Ist das Dasein also auch ein Zeug, so ist es ebenfalls in die Zeugganzheit eingelassen, die es zwar mit konstituiert, aber nie ganz expliziert. Vielmehr noch ist Dasein nur eine mögliche Explikation einer ganz und gar unmenschlichen oder undaseinshaften Implikation, an der alles Zeug gleichberechtigt teilnimmt. Anstatt die Zuhandenheit zu bestimmen, wird das Dasein selbst durch die Zeugganzheit bestimmt. Ergo, wenn die Zeugganzheit das Dasein als konstitutiv, aber in keiner Weise notwendig (als unmenschliche Implikation) hervorbringt, ist das Dasein nicht notwendig für die Konstitution der Zeugganzheit. Hier geht Harman weit über Heidegger hinaus, indem er Heidegger unterstellt eine Struktur durch das Dasein freizulegen, die aber keinesfalls am Dasein hängt. Sogar „the dualism between tool and broken tool actually has no need of human beings, and it would hold perfectly well of a world filled with inanimate entities alone.”[192] Die Dinge haben ein Eigenleben, das den Menschen nicht braucht, sie jedoch nicht mechanisiert; sie sind nicht länger auf das Dasein reduzibel. Gegenüber den Tendenzen der Heideggerauslegung im 20.Jh. liest Harman ihn als strengen Realisten, der auf der unabhängigen Existenz der Dinge besteht.
Dies führt zu einer zweifachen Befreiung der Dinge. Erstens, „things happen“ in der reduktionistischen Philosophie „only vertically by retardation, contraction, or emanation from some primal layer of the world. There is little room for horizontal interactions, as when fire burns cotton or rock shatters window.”[193] Reduziert man Dinge auf eine Tiefendimension verschwinden sie ganz. Wie nun Dinge (als sie selbst) interagieren können, wird unbegreiflich. Durch Harmans Radikalisierung des Zeugs werden Dinge zunächst autonom vom Dasein, das mit ihnen umgehen kann, aber nicht muss. Betrachten wir hier wieder Harmans Beispiel, welches er aus dem Qur’an entnimmt: Feuer verbrennt Baumwolle. Nehmen wir die globale Zeugthese an, heißt dieser Vorgang, dass sich die Baumwollen und das Feuer in ihrer Begegnung gegenseitig bestimmen – sie treten beide in eine Art hermeneutischen Zirkel ein. Das Bewusstsein kann natürlich auch in diese Bestimmung eintreten, aber eben als Ding unter Dingen. Insofern das Bewusstsein mit den Dingen umgeht, verändert es diese, bestimmt sie, während es von ihnen bestimmt wird. Demnach kann das Bewusstsein niemals die letzten Tiefen des Dinges ausloten. Das gleiche gilt aber auch für die Dinge selbst. Die brennende Baumwolle hat nie vollen Zugang zu allen Qualitäten des Feuers, so wie auch das Feuer nie volles Wissen über die Baumwolle erlangt, selbst wenn es sie verzehrt. Zweitens erhalten die Dinge auch eine Zusatzdimension in Bezug auf ihre generative Kraft. Nur auf einer tieferen Dimension beruhend oder in dieser enthalten, haben Dinge keine Kraft etwas, von sich aus zu verändern, das nicht schon in der tieferen Dimension angelegt wäre. So gibt es bei Bruno nichts, was nicht schon in der Materie angelegt wäre[194], oder bei Newton nichts, was nicht schon durch die mechanischen Kräfte entschieden wäre.
Das Zusammenwirken dieser zwei Punkte führt Harman nun wiederum zu einer weiteren Distanzierung von Heidegger. Halten wir fest, was Harman behauptet: Alle Seienden sind Zeug.[195] Alles Zeug wird bestimmt durch und bildet Zeugganzheit. Aber Zeug bestimmt sich gegenseitig in der Begegnung, jedoch erhält das eine Zeug nie vollständiges Wissen vom anderen. Wenn aber alle Dinge sich durch die Begegnung bestimmen, wie erklärt sich dann das Reservoir an Tiefe in den Dingen? Heidegger, wie auch Whitehead – der die nicht beseelte Welt viel offener als Heidegger begrüßte – hegen beide eine tiefe Abneigung gegen Substanzen im Aristotelischen Sinne, die sich der Zeitlichkeit und Relationalität widersetzen.[196] Wir haben schon durch Harmans überspanntes Beispiel des Staubkorns auf dem Mars gesehen, dass er meint für Heidegger würde sich durch die Veränderung eines Körpers das Ganze ändern – ein Wimpernschlag ändert alles. Weder Heidegger noch Whitehead, würden das behaupten, aber eben jene Überspitzung macht den Impetus klarer, den Harman briachial verfolgt: „the obvious tendency always to grant philosophical primacy to the network of entities rather than to isolated individuals”[197] in beiden Positionen. Das Leben der Dinge als sie selbst ist darin nun bedroht, als sie im System vollkommen aufgehen, sich zu Einem zusammenfügen (Zeugganzheit), und damit alle Eigenschaften eines Dinges an der Oberfläche, nämlich in den äußeren Relationen liegen würde. Also muss Harman die Dinge abkapseln, ohne klar sagen zu können, was ein vereinzeltes Individuum sein soll.[198] Die Produktivität/Leben der Dinge würde sich vom Inneren (Tiefe) der Dinge, auf das Außen verschieben. In gewisser Weise wiederholt dies mutatis mutandis den Alptraum Humescher Exteriorität der Relationen, in denen das Ding aufgeht. Gleichzeitig führt es aber dazu, das zeitliche Überdauern eines Dinges nicht mehr als Kriterium für seine tatsächliche eigenständige Existenz (als Substanz) zu akzeptieren.
Der Schritt hin zu einzelnen Substanzen scheint zunächst nicht so gravierend, betont doch auch schon Aristoteles, dass auch Substanzen endlich sein können.[199] Erst mit Bruno und später mit Spinoza werden Substanzen die unendlichen und ewigen Entitäten, die man Aristotles vorhält, doch selbst hatte er schon ein feines Gespür für die Vergänglichkeit des zu Grunde liegenden. Daher hört Harman hier auch noch nicht auf und versucht die Rückzugsbewegung der Dinge aus ihrer Relationalität weiter zu augmentieren – wieder im Rückgriff auf Aristoteles. Stellen wir uns einen Plutoniumstab vor, der noch vor seiner Halbwertszeit heiß glühend in der Wüste liegt. Auch wenn kein Tier ihn berührt, würde er doch jedes Lebewesen töten.[200] Der Rückgriff auf die aristotelischen Potenzen schafft hier nun das Problem zu fragen, sind diese Potenzen aktual oder virtuell. Die Frage nach der Aktualität des Tödlichen des Plutoniums wirft wiederum die Frage auf, was am aktualen Ding das Tödliche sein soll; seine Atome, sein Gewicht etc.? Um tödlich sein zu können, benötigt es eine Relation, die jetzt nicht aktual ist. Gleichzeitig ist das Plutonium ja auch schon potenziell tödlich, auch wenn es diese Relation nicht eingeht. Das Tödliche scheint also weder auf dem aktualen Plutonium allein zu beruhen, sowenig wie nur auf seiner Relation. Das Deleuzesche Problem der Virtualität drängt sich hier auf. Wie aber schon in der Betrachtung der Potentialität des Aristoteles gezeigt wurde, lässt sich die Möglichkeit nicht nie von seiner Aktualisierung trennen und ist überhaupt nur, wenn es in actu realisiert wird; wie der Körper der nur potentiell lebensfähig sein kann, wenn er auch in actu lebendig ist. Harman spielt mit der Linie einer Metaphysik, die Möglichkeiten von ihren Realisierungen löst und als präexistente Gebilde postuliert.
Das Leben der Dinge liegt, so Harman, in den Dingen, jedoch nicht als materielles[201] Leben, sondern als substanzielles. Zusammenfassend, Harmans Position in eigenen Worten:
„My own version has not just one, but two basic principles:
- Individual entities of various different scales (not just tiny quarks and electrons) are the ultimate stuff of the cosmos.
- These entities are never exhausted by any of their relations or even by their sum of all possible relations. Objects withdraw from relation.”[202]
Einschub: Spinozas Gespenster (Onticology)
Hegel machte in seinen Vorlesungen gelegentlich einen Witz über Spinozas allzu passenden Tod.[203] Gestorben an Schwindsucht; über die langsame Zersetzung von innen heraus in ein allgegenwärtiges Außen. Als löste er sich auf vom Besonderen ins Allgemeine – vom Modus in die Substanz. Aus der Perspektive der Substanz zu sehen, heißt vollkomme Auflösung – erleuchtete Sicht und verlorenes Objekt. Sub specie aeternitatis als Organon der Auslöschung.[204]
Und doch gibt es bei Spinoza den produktiven Tod nicht. „Der freie Mensch denkt über nichts weniger als über den Tod; seine Weisheit ist nicht ein Nachdenken über den Tod, sondern über das Leben.“[205] Er entspricht damit den Körpern, die im Sein verharren wollen, ja sie sind durch nichts anderes bestimmt. Conatus. Der Tod kommt immer von außen: „Jedes Ding kann nur von einer äußeren Ursache zerstört werden.“[206] Nichts strebt nach eigener Natur nach dem Tod – alles strebt sich zu bejahen. Insofern scheint Hegels Witz unangebracht. Als sei Spinoza am Tod selbst gestorben, am Zersetzen, das in den Modi selbst steckt. Hegel will Spinoza einen „konzeptuellen Tod“[207] sterben lassen, als sei Spinoza aus Prinzip, nämlich dem Prinzip der Negativität in den Modi, gestorben. Doch die Modi sind keine fliehenden Erscheinungen, die man wegwischen könnte, sie halten sich im Sein. Noch sind sie zerfallende Gebilde, sie halten an sich selbst fest. Wenn jedoch Spinoza am konzeptuellen Tod gestorben wäre, dann wäre dieser Tod auch der Tod des Konzepts selbst gewesen. Die Substanz verneint sich selbst – bringt sich immer nur als zerfallendes Gebilde selbst hervor. Am Ende stirbt der Tod selbst; die Negation negiert sich selbst. Übrig bleibt die absolute Leere, die zugleich absolute Fülle ist. Sein und Nichts sind identisch;[208] dies ist Hegels Spinozistische Phantasie ohne Spinoza.
Nichts verdeutlichte dies für Hegel wie die ultimative Komödie[209] der Kenosis. Der Gottessohn verkörpert sich, er wird Fleisch. Aber ebenso inkorporiert sich der Geist in den Knochen und dem Fleisch des Menschen, wie das unheimliche Schädelkapitel der Phänomenologie des Geistes erzählt.[210] Bei Hegel taucht die Frage aber häufiger im Umkreis der christlichen Mystik auf. Die theologisch entscheidende Frage war dabei immer, inwieweit Gott menschlich ist, wenn er sich als Sohn in einen Körper inkarniert. Während sich die Diskussionen bei Chemnitz, Benz und anderen darum drehten, wie die Differenz der Naturen des Göttlichen und Menschlichen zu trennen seien in diesem Ausnahmefall, oder inwieweit Gott der menschlichen Natur überhaupt unterliegt (die Schreie am Kreuz und die menschliche Verzweiflung ) geben die Pythagoreer indirekt eine andere Antwort. Sie fragen nicht nach der Natur der Trennung oder Einheit Gottes mit dem Menschen, sondern wie Gott zum Menschen wird. Es ist eben diese Übergangszone, die Hegel interessiert; die Paradoxe Einheit von Endlichkeit und Unendlichkeit in ihrem unendlichen Übergang. Diesen Übergang zu denken, war der klassischen Theologie jedoch nicht möglich, weil sie einseitig – in einem verkürzten Verständnis der Aristotelischen Physik – Gott als reine Aktualität dachten, der die Welt als Potentielle gegenüber stand. Gott war vollkommen, vollständig aktuell – die Welt was unfertig und unvollkommen, potenziell. Jedoch bedachten sie nicht die Rolle des actus purus als jenes Sein, welches notwendig nicht aus einem anderen/Möglichen entstanden sein konnte, womit bei Aristoteles die Möglichkeit aus der Wirklichkeit folgt und nicht anders herum. Die Welt als das Mögliche und Unfertige darzustellen, unterschlägt den Ursprung dieser Möglichkeiten in der bereits vollständigen Wirklichkeit. Heidegger wirft der Tradition der abendländischen Philosophie, aber besonders der Scholastik, im Bezug auf Gott als actus purus vor, zwischen dem ipsum esse und dem ens ab alio überhaupt unterschieden zu haben, wodurch sie die tieferliegende ontologische Differenz verdeckten.[211] Und dann ist da Luthers Hymne, die singt: „Gott selbst liegt tot.“[212] Hegel war bereit, diese Radikalisierung Luthers ernst zu nehmen. Luthers Übersetzung des Begriffes κένωσις mit ‚Entäußerung‘ veranlasste Hegel die Richtung der Frage zu ändern. Anstatt nach der Vereinbarkeit der göttlichen und menschlichen Natur zu fragen, machte er aus der Kenosis etwas, dass das Sein Gottes selbst betrifft. Gott wird Fleisch und Gott stirbt am Kreuz. Er muss diesen Tod und die Auferstehung auf sich nehmen, um von seiner abstrakten und unwirksamen Allgemeinheit in das konkrete und wirksame des Besonderen dieser Welt, eingehen zu können. Er entflieht seiner Gebundenheit an ein reines Konzept.[213] In das Wesen Gottes trägt sich, entgegen der vollkommenen, aber wirkungslosen Aktualität als Wesen, die Potentialität ein. Man versteht Hegel jedoch falsch – wie viele seiner Zeitgenossen es aber taten – wenn man diese Potentialität nur als Mangel versteht.[214] Gott wird bei Hegel nicht unvollkommener und versuchte diesen Mangel auszugleichen, sondern ist vielmehr eine positive Eigenschaft. Die Kritik an Hegels These der Potentialität Gottes reibt sich an der traditionellen Deutung von Aktualität und Potenzialität auf, die in den nicht verwirklichten Potenzen einen Seinshunger oder einen Drang zur Verwirklichung sehen will, also einen Mangel. Hegel hingegen hat eine Umdeutung der Potenzialität im Auge, die genau den negativen Kern trifft, insofern die Potenzen Gottes keine Mängel sind, sondern eine Virtualität als aktualer Potentialität.[215] Es ist das Wirken Gottes, das in der Zukunft stattfinden wird und stattgefunden hat – es ist immer verschoben; reines Werden. Deleuzianischer könnte Hegel hier nicht sein.[216]
Nun liest Hegel jedoch die Spinozistische Konzeption der Substanz mit dem Gedanken einer nicht auf Mangel basierenden Negativität zurück. Insofern es auf der Ebene der Substanz keine Negativität gibt, sondern nur Limitation, wie Spinoza behauptet[217], kann es für Hegel auf der Ebene des Seins auch nichts Neues geben. Nur wenn das Sein sich durch etwas verneinen könnte, wäre es in der Lage sich zu verändern, was Spinoza – so Hegel – jedoch kategorisch ausschließt. Hegel besteht jedoch, um sein Argument vorbringen zu können, nicht nur auf der negationslogischen Dialektik des Werdens, die Deleuze angreifen wird, sondern auf einer Trennung von Substanz und Modi, die Hegel zunächst einzeln betrachten will, um sie später zusammen zu denken. Spinoza geht aber den umgekehrten Weg, indem er sie als nicht trennbar, ja die Modi als Ausdruck der Substanz, die nur darin ist, definiert. Das Beunruhigende ist daher, dass das Sein selbst – die Substanz – in gewisser Weise selbst nie ist, sondern immer nur wird, oder wenn überhaupt nur ihr Werden ist. Sie ist nur, insofern sie sich in den fliehenden Modi ausdrückt und sich damit nicht nicht verändern kann – das heißt sich verändern muss und nichts als diese Veränderung ist. Sich auf diese absurde Welt einzulassen hieße – wie Kojéve schon bemerkt – verrückt sein oder verrückt werden.[218]
Nichts bringt diese Unabhängigkeit der Substanz gegenüber den Modi – wenn man Spinoza mit den Augen Hegels liest – besser zum Ausdruck als Spinozas Lehrsatz 29 des 1. Buches: „In der Natur gibt es nichts Zufälliges (contingens), sondern alles ist aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, in einer bestimmten Weise zu existieren und etwas zu bewirken.“[219] Das Entstehen der Modi und ihr Zerfall wirken selbst nicht auf die Substanz zurück, die den Verlauf der Produktion bereits enthält. Wöllte, so Hegel, die Substanz in ein Selbstverhältnis treten, dann könne sie das nur, wenn sie sich in den Modi selbst negiert und sich durch diese Negation wieder auf sich selbst wirft. Da aber Spinoza die Negativität auf der Ebene der Substanz nicht zulässt, kann die Substanz nicht auf sich selbst wirken. Die Beziehung scheint monokausal, solange man das Hegelsche Paradigma akzeptiert, dass Kausalität immer einen Bezug auf etwas Anderes bedarf und man Selbstverursachung ausschließt.
Inspiriert von Harman finden wir bei Levi Bryant eine weitere Spielart der Object-Oriented-Philosophy, das sich genau an diesen Punkten aufreibt; Onticology. Ebenso wie Harman schreibt Bryant zwar gegen einen Reduktionismus in der Philosophie an, der sich gegen Dinge richtet, doch vielmehr als ihre Autonomie zu sichern, ist Bryant an den Prozessen ihrer Erhaltung interessiert. Daher schließt er an die Studien Luhmanns und Varelas/Maturanas an Im Anschluss an diese spricht auch er von Dingen als Systemen oder autopoietischen Maschinen. Auf den ersten Blick Deleuzianisch beschreiben Maturana/Verela diese die autopoietische Maschine:
“is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production (transformation and destruction) of components that produces the components which (i) through their interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that produced them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in the space in which they (the components) exist by specifying the topological domain of its realization as a network.”[220]
Es handelt sich also um Maschinen, die durch ihre Fähigkeit die Komponenten des Systems zu reproduzieren, die Homöostase des Systems gewährleisten können, um sich prozessual selbst zu erhalten. Mit eben dieser Definition setzt Bryant seine Philosophie der Dinge an, als „ unity of a system is what I call the system’s “endo-consistency”.“[221] Obwohl Bryant im selben Buch Spinoza diskutiert und lobt[222], unterlässt es doch, jenes Konzept Spinozas zu verwenden, welches seinem Projekt den ontologischen Unterbau verleihen würde; Conatus. Insofern die Dinge im Sein verharren wollen, müssen sie nicht all ihre Teile materiell erhalten, sondern ihre Form, d.h. auch Teile nachbilden, reproduzieren oder in die Nähe des Körpers bringen – genau dies leistet der Conatus.[223] Er erhält die Form durch Reproduktion der Teile. Mit dieser synchronen Emergenz eines homöostatischen Organismus, der sich selbst reproduziert, kann man Deleuze Gedankengang in Bezug auf organische Individuation sogar teilweise parallelisieren. Die Probleme entstehen in der Konsequenz, die Bryant selbst benennt: “Autopoietic machines, systems, or substances are unique in that not only are they unities, not only are they operationally closed to the rest of the world, but they also constitute their own elements.“[224] Nimmt die Endo-Konsistenz eines Systems/Dinges zu, nimmt die Umweltspezifität proportional ab – bis sich die Illusion einstellt, das System operiere unabhängig von seiner Umgebung; eine transzendentale Illusion. Genau hier wird ein Rückzug möglich, der sie in aktuale und selbstreferenzielle Systeme verwandelt, die nicht mehr die diachrone Fähigkeit zur Veränderung haben. Sie sind, so Deleuze, nur noch eine spezielle Aktualisierung einer virtuellen Mannigfaltigkeit.[225] Insofern sie nur ihre Konsistenz waren, ist die einzige Möglichkeit zur Veränderung eine invasive Intervention des Außen in Bezug auf das System. Nicht ohne Grund, war es Kant, der die Autopoiesis als Kennzeichen des Organismus zementierte. Bei Bryant werden alle Systeme/Dinge organisch. Wir haben nichts über das Anorganische gelernt.
Es war aber eben Spinozas Conatus, der als Echo bei Bryant wieder auftrat und das organische Paradigma der Autopoiesis und Endokonsistenz ausmachte. Die Tatsache, dass bei Spinoza nicht selten anorganische Protagonisten die Hauptrolle spielen, befreit ihn nicht von diesem Vorwurf. Denn, insofern ein Stein als conativ begriffen wird und nach Homöostase strebt, ist er auch organisch. Die enge Verbindung des Conatus, der Reproduktion und der Kontinuität der Organismen, war auch Hans Jonas wohl bewusst, der gerade betont, das Organismen nicht nur einen Metabolismus, sondern auch Regeneration brauchen,[226] um aus dieser Autonomiebewegung einen kantischen Freiheitsbegriff zu formulieren.[227] In der Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes wird dagegen eher physikalisch als biologisch gesprochen; der Conatus ist noch nicht eingeführt. Seine systematische Einflechtung findet der Conatus erst in der Ethik, in welcher er ohne großes Aufsehen im 6. Lehrsatz des 3. Buches eingebracht wird. Das dritte Buch – in Ton und Thema sehr verschieden von den anderen Büchern – versucht die Affektionen in geometrischer Weise zu untersuchen. Obwohl die Affekte bei Spinoza als Kritik an Descartes bereits eine zentrale Rolle spielten, ist das Projekt der Ethik breiter angelegt. Nach der ontologischen und epistemologischen Propädeutik soll nun die Struktur des Menschlichen Handelns und Denkens im Ganzen untersucht werden. Die dafür als strukturelles Gleichgewicht zu Gott und Geist eingeführten Affekte als „Affektionen des Körpers durch die das Tätigkeitsvermöggen des Körpers vergrößert oder verringert, gefördert oder gehemmt wird; zugleich auch die Ideen dieser Affektionen“[228] reichen dafür nicht aus. Sollen sie strukturelle Begründungen liefern, müssen sie selbst erst begründet und gegründet werden, indem erklärt wird wieso die Affekte überhaupt hemmend oder fördernd sein können, und wieso diese es in immer der gleichen Weise sind. Die geometrische Methode steht und fällt mit der Stringenz und Rigorosität der Ableitung aus den Axiomen – es darf nichts zufällig sein. Barocke Welt. Hier hat der Conatus als neue Linse der Betrachtung seine strategische Rolle, als jenes Prinzip der Selbsterhaltung, dass bei Verstoß die negativen Affekte (Trauer) und bei Zuarbeit die positiven (Freude) produziert, wobei Freude und Trauer in einer Art Feedback wiederum als Hemmung oder Stärkung wirken können. Cook hat in seiner Ahnenreihe dieses Gedankens sehr treffend festgestellt, dass es vor allem Denker der (homöostatischen) Selbsterhaltung wie Cicero, Duns Scotus, Dante, Thomas von Aquin und Hobbes sind, die Spinoza nicht nur in der Idee, sondern auch in der Ausdrucksweise inspirierten.[229] „Infolge einer natürlichen Notwendigkeit, nicht geringer als die, durch welche ein Stein zur Erde fällt“[230], vermeiden wir den Tod, schreibt Hobbes. Die Vermischung des griechischen νόμος mit dem lateinischen lex[231] und ordo führt dabei zu einer Variante des Naturrechts, das sich als Naturgesetz präsentiert.[232] Diese physikalische Redeweise eines biologischen Prinzips trägt Spinoza zu neuer Blüte.[233] Nicht nur will Spinoza dieses Prinzip in die Dinge setzen, sondern die Dinge sind dem Wesen nach dieses Streben, sie sind nicht unterschieden.[234] Leben ist Überleben.
Deleuze versucht sowohl Hegels Aporie einer von den Modi losgelösten statischen Substanz bei Spinoza, die keine Negativität kennt, sowie Spinozas Beschränkung auf Selbsterhaltung der Modi umdenken. Noch ist aber nicht klar, wieso das Prinzip der reinen Selbsterhaltung als Wesen der Dinge problematisch ist. Betrachten wir dafür zunächst Deleuze Lösung für das Problem des Neuen auf der Ebene der Substanz. Die Antwort Deleuze‘ auf die Aporie der unmöglichen Selbstbezüglichkeit der spinozistischen Substanz klingt erstaunlich nach Hegel. Hatte dieser das Sein bereits als Substanz und Subjekt hergeleitet[235], also die Identität in der Differenz zwischen Produktion und Produkt, so versucht Deleuze diesen Schritt zu wiederholen, wenn er die Substanz als diese Selbstproduktion beschreibt. Was sich aber eigentümlich bei Deleuze verkehrt ist, dass diese Selbstproduktion nicht durch Negation geschieht, in der sich, wie bei Hegel, das Sein als anderes setzen würde, sondern das Sein/Substanz setzt sich in sich selbst als die Modi. Die Substanz ist nur, insofern sie sich selbst als die Modi setzt – keine Schicht vor den Modi, keine Gestalt hinter ihnen.[236] Damit ist für Spinoza die Substanz schon immer verschoben, immer in Differenz, insofern sie nie als reine Form auftritt, sondern immer schon modifiziert als sie selbst in Verschiebungen. Die Substanz ist ihr eigener Ausdruck in den Modi – und doch nicht formal identisch.[237] Kein Modus, auch nicht die Sammlung der Modi macht die Substanz aus, da diese dadurch nur als hypostasiertes Sein begriffen wäre. Hegels Vorwurf, Spinoza hätte eine Substanz Causa Sui propagiert, ohne diese aber zu Ende – das heißt bis zur Negativität – gedacht zu haben, entpuppt sich in Deleuze Interpretation als Taschenspielertrick, der darauf beruht, Spinoza durch die dialektische Methode laufen zu lassen. Nur wenn Selbstbezug Negativität einschließen muss, wäre Spinozas Substanz aporetisch. Deleuze jedoch beginnt einen Differenz und damit auch einen Selbstbezugsbegriff zu entwickeln, der keine Negativität braucht. Ganz besonders Etienne Balibar hat diese These, die Substanz sei nur in ihren Modifikationen radikal ausformuliert,[238] vergisst dabei aber auch nicht zu erwähnen, dass diese Interpretation, obwohl nach Spinozistischen Vorlage, doch genuin das Werk Deleuze‘ ist. Paradoxerweise musste Spinoza erst durch Hegel gehen, um durch Deleuze voll aktualisiert zu werden. Hegel bleibt Deleuze‘ Weißer Wal.
Hier wird die Schwierigkeit der Selbsterhaltung ontologisch dringlich. Insofern alle Modi nur nach dem Verharren im Sein streben, beruht die Bewegung der Substanz als Modifikation auf einer ständigen Stabilisierung der Modi und damit seiner selbst; auch wenn die Modi niemals vollständig ins Gleichgewicht geraten. Deleuze versucht mit Nietzsche in einer Bewegung – hin zur Differenz (vor der Identität) – in zwei Weisen, gegen die Spinozistische Deutung des Conatus als Selbsterhaltung vorzugehen. Erstens, Wille zur Macht; zweitens, die Unmöglichkeit eines ‚Weltkörpers‘. WILLE ZUR MACHT: zerstört das Bild des homöostatisches Körpers als Organismus. Das primäre Streben eines Körpers, so Nietzsche, liegt nicht in der Erhaltung einer strukturalen Integrität, sondern gerade in der Überschreitung; wie Heidegger richtig erkennt: „Weil Nietzsche sagt: Wollen ist über sich hinaus Wollen, kann er, im Blick auf dieses Über-sich-hinaus-sein-im-Affekt sagen: der Wille zur Macht ist die ursprüngliche Affekt-Form.“[239] Schon in den rudimentären Formen der organischen Existenz zeigt sich dieses Verhalten als „die ursprüngliche Tendenz des Protoplasma, wenn es Pseudopodien ausschickt und um sich tastet. Die Aneignung und Einverleibung ist vor allem ein Überwältigen-wollen.“[240] Strebte bei Spinoza der Conatus noch im Sein zu verharren, das heißt seine Form möglichst (materiell) zu wiederholen, wiederholt bei Nietzsche das Lebewesen seine Form immer mit einer Differenz, ohne primär notwendig zu einer Homöostase zu streben – dieses Streben kommt erst später als emergente Funktion auf der „ursprünglichen“ Affektform. Die ewige Wiederkehr Nietzsches, die bei Spinoza als conative Kraft ihre stabilisierende Wirkung ausübte, lässt nun bei Deleuze nichts mehr von der Identität übrig als eine Oberflächenschicht, die vielmehr wird die Integrität der Form nur zu einer notwendigen Voraussetzung, um den Willen zur Macht wirken lassen zu können.[241] Mit diesem Streben zur Differenz treffen wir wieder auf das autopoetische Paradigma, welches Bryant in spinozistischer Manier für die Endo-Konsistenz der Dinge heranzog. Diese beruht eben auf der Tendenz eines Systems, synchrone Emergenzen bilden zu können, die einer Homöostase zustreben; Conatus à Autopoiesis à Endo-Konsistenz à Homöostase. Deleuze richtet nun aber den Blick auf die diachronen Emergenzen, die gerade nicht nach Stabilität streben, sondern gerade diese zu Gunsten einer Differenz zerstören. Bei Ljapunow werden Ströme Turbulenzen, bei Prigogine aus stabilen ab einem Bifurkationspunkt dissipassive Systeme, bei Pointcare die Planeten unberechenbar – nicht durch eine dem System äußere Einwirkung, sondern aus den Strukturen und Kräften des Systems selbst. Die Winde müssen nur schnell genug, die Systeme nur Energie geladen oder die Planeten mehr als zwei sein. Diese Wirkungen, wie das System einen instabileren, aber differenzierteren Zustand aus dem System erzeugt und damit die Homöostase aufgibt, ist Deleuze Ankerpunkt. ἐξίσταται γὰρ πάντ’ ἀπ’ ἀλλήλων δίχα.
Würde Deleuze den Spinozismus affirmieren, so wie Hegel ihn darstellt, dann wäre Žižeks Vorwurf des Hylozoismus gegenüber Deleuze voll gerechtfertigt.[242] Dies hieße aber den ödipalen Körper des Kapitalismus – wie ihn der Anti-Ödipus beschreibt – als Körperideal zu denken und den organlosen Körper als utopischen aber unwirksamen locus imaginarius zu degradieren. Anders als Spinoza, der die Genese und Erhaltung der Form als philosophisch vorrangig betrachtet – daher auch den Conatus einführt – versucht Deleuze den Fokus auf die kontingente Genese aus der Materie zu legen. Was bei Spinoza schon angelegt war, nämlich die generative Kraft der Materie, die mit den Gesetzen des Conatus im Einklang stand, wird in Deleuze späteren arbeiten zur zentralen Verschlingung; Materie bringt Form hervor gemäß den Eigenschaften, die sie durch Formen besitzt. Die Substanz faltet sich nach ihren Regeln in die Modi aus, die wiederum die Substanz sind und diese Regeln gestalten. Spinozas individuelles Gesetz. Eben hier zeigt sich die Bruchstelle, an der Spinoza selbst das barocke Bild durchbricht. Hatte Leibniz noch Gott als letztes Refugium der Harmonie unter den Welten und Formen der Aktualisierung in Anspruch nehmen können, so kann Spinoza mit dem Zusammenfallen von Gott und Natur keine solche regulative Instanz mehr bemühen. Gott ist ausgedehnt. Inkompossible Welten fallen zusammen.[243] Ohne den harmonisierenden Gott gerät die Welt aus den Fugen – der Cardo löst sich aus – und die Welt beginnt sich selbst zu schaffen. Gerade diese Disharmonie beschreibt Spinoza, wenn er sagt: “Die Dinge sind insofern von entgegengesetzter Natur, d.h. sie können insofern nicht in ein und demselben Subjekt sein, als das eine das andere zerstören kann.“[244] Die Substanz erschafft die Modi nicht in Harmonie und nicht in statischer Absicht. Die Substanz selbst verändert sich mit jedem Modus durch den sie sich definiert. Substanz : Modus. Indem sie sich aber durch die unharmonischen Modi ausdrückt, wird sie selbst körperlos, anorganisch. Sie wird ein organloser Körper, deren Teile nicht zusammenarbeiten um ein stabiles Austauschsystem zu bilden, noch um seine Form zu erhalten. Die Substanz ist daher das Prinzip der Produktivität – natura naturans – weil sie sich nicht als reproduzierenden Organismus erschafft. Die Substanz als Organismus wäre eben die starre und statische Welt, die Hegel in Spinozas Philosophie sieht. Doch sie ist anorganisch; kreativ als organloser Körper. Die Welt ist kein Organismus, kein regulierter Körper – überhaupt kein Körper.
Die Substanz ist anorganisch.
Das Leben in den Dingen ist außerhalb der Dinge
In Harmans Philosophie wird alles organisch. Anstatt dem Anorganischen durch die Dinge neues Leben zu verleihen, subsummiert er alles unter das organische Paradigma, wie es Kant etablierte.
Betrachten wir zunächst ein Problem, ein wiederkehrendes Problem, das als Inflexionspunkt immer wieder die Object-Oriented-Philosophie antreibt. In Bezug auf Heidegger klingt es so:
„A glacier that grinds through rock and soil does not make contact with all the features of these entities any more than our geological theories or practical use of the soil is able to. In this way real objects turn out to be radically non-relational. Admittedly, Heidegger seems to say just the opposite. He tries to convince us that whereas objects of the mental sphere seem to be discrete individuals cut off from one another, the real objects of the pre-conscious landscape are entirely defined by their mutual interrelations. But if this were true then objects could never break, nor could they surprise us in any way at all.”
Und er schließt die entscheidende Pointe an:
„Objects would be entirely defined by their relations with all other objects hic et nunc, and there would be no reason for anything ever to change from its current state.”[245]
– als seinen alle Relationen immer schon harmonisch oder neutral – die digitale Welt Harmans. Interessanter jedoch als die Frage nach der Richtigkeit der Anschuldigung an Heidegger ist Fragen mit welcher Intention Harman diese orchestriert. Wir können hier den Streit von Hegel und Spinoza im Hintergrund hören, den wir bereits ansprachen. Nehmen wir an, alle Dinge sind durch ihre gegenseitigen Relationen (positiv) bestimmt und es gibt keine Negativität – wie wäre dann überraschende Veränderung möglich?[246] Dass dies wirklich ein Problem für eine affirmative relationalistische Philosophie ist, zeigt sich daran, dass auch Manuel DeLanda (in Deleuze Nachfolge) mit diesem Problem ringt. Denn auch an Deleuze müsste man die Frage stellen, wie genau das Neue in der differenziellen Wiederholung auftritt. Kants Argumentation gegen den Mechanismus, die auch bei den kritischen Vitalisten (Driesch, Bergson) noch jede Denkbewegung vorgab, ist auch hier federführend. Die verschränkten Fragen nach der Spontanität einerseits und der Teleologie andererseits finden ihr Echo eben auch in diesen Diskursen.
Der Prinz der Netzwerke[247] hatte dieses Problem bereits erkannt. Dinge als vollständig relational zu beschreiben, ließ zu sie synchron als heterogenes relationales Feld zu beschreiben, sowie sie diachron entweder als homogene Entwicklung oder als heterogene Geschichte mit unerklärlichen Brüchen zu beschreiben. Die Geschichte schien jedoch immer wieder Diskontinuitäten aufzuweisen, die sich nicht aus den aktualen Relationen ableiten ließen und wenn dann nur nachträglich. Foucault, den dieses Problem genauso traf, musste sich daher von Sartre sogar zum Geologen der Geschichte denunzieren lassen, der die Schichten, aber nicht ihren Zusammenhang aufzeigen würde. Wie aber die vulkanische Linie in den Schichten wiederfinden und ihre Durchdringung und Abfolge plausibler machen?[248] Wie also auch dieses geologische anorganische Leben der Geschichte freilegen? Latours Antwort ist: „plasma, namely that which is not yet formatted, not yet measured, not yet socialized, not yet engaged in metrological chains, and not yet covered, surveyed, mobilized, or subjectified.”[249] Jenes Gebilde – πλάσμα – verleiht den relationalen Dingen eine Zusatzdimension, wie man sie in der Physik als leitendes Gas findet, in dem Ladungen ausgetauscht werden können. Analog ist dies aber keine Hinterwelt, sondern eine eingebettete Dimension, entsprechend kommentiert Latour: “They [sociologists] were right to look for ‘something hidden behind’, but it’s neither behind nor especially hidden. It’s in between and not made of social stuff.”[250] Als Zwischen steht das Plasma inmitten der Dinge und verbindet sie in nicht vorhersehbaren Weisen, ohne selbst sozial konstituiert zu sein. Die Tragweite, die Latour diesem Plasma bemisst ist gewaltig, insofern nahezu alle Unvorhersehbarkeiten und geschichtlichen Diskontinuitäten ihm zugerechnet werden. Dies scheint eine Nähe zu Deleuze Begriff des Virtuellen und seiner vulkanischen Kraft, sowie zur Quasi-Kausalität nahezulegen, verbringt doch Deleuze auch erstaunlich viel Zeit damit, Geschichte vom Werden zu trennen. Dies vor allem durch das Konzept der Quasi-Kausalität, die eine Verbindung zwischen der Vergangenheit (als Bedingung) und der Gegenwart (als Bedingtes) immer nur retrospektiv möglich macht, was gleichzeitig der Vergangenheit ein nicht-aktualisiertes virtuelles Potenzial gibt, sowie der Gegenwart eine exzessive Qualität, insofern es die Vergangenheit retrospektiv konstituiert. Diese Verbindung ist jedoch nur scheinbar – wird aber von Harman als gegeben angenommen.
Diese erneute Evakuierung der kreativen Potenziale jenseits der aktualen Beziehungen in eine Dimension zwischen den Dingen entfernt sie wieder aus den Dingen heraus. Das überraschende Zusammenbrechen von Systemen oder die überaschende Kraft der Dinge wäre hier etwas außerhalb der Dinge selbst. Harman überschätzt jedoch Latours Hingabe zum Plasma, da er zu glauben scheint, dass es sich hier um eine ontologische These handelt. Aber wenig später berichtigt dies Latour schon: „It is not hidden, simply unknown.”[251] Das Plasma ist keine ontologische These, sondern eine epistemologische. Für eine Untersuchung der Geschichte ist es wichtig, dieses Konzept anzunehmen, ob es metaphysische Bedeutung hat ist für Latour jedoch nicht wichtig. Entsprechend groß ist daher auch Harmans Verblüffung über den Latourschen Ausweg, da er ihn als ontologische Fluchtlinie liest. Seine Reaktion ist dementsprechend radikal. Für ihn ist klar, dass Latours Plasma nichts erklärt, sondern die Frage nur deutlicher macht. Vielmehr müsste die kreative Kraft in die Dinge zurück verlegt werden; schöpferische Substanzen. Was Harman evoziert ist eben die Aristotelische Untersuchung der Substanzen wieder aufzunehmen, die nach ihren essentiellen Eigenschaften auch unabhängig von ihrer Umgebung befragt werden können. Die Stoßrichtung führt hier natürlich einen Schritt weg, von der Aristoteles hin zu seinen Interpreten, für die der Aspekt des zeitlichen Überdauerns über einen langen Zeitraum entscheidender war. So argumentiert eben Leibniz, dass zwei Diamanten, egal wie nahe man sie aneinander führt, nie eine Substanz bilden würden; selbst Leim könnte sie nicht zu einer Substanz binden. Denn, wenn diese zwei aneinander geklebten Steine eine Substanz wären, dann doch auch Vogelschwärme oder Menschen die einander an den Händen halten; Leibniz, das Individuum. Gerade eben in der Tendenz, diese und ähnliche Argumente zu ignorieren, findet man laut Harman die Wurzel des Vergessens der Dinge im 20.Jh., in der nahezu alles ein Ding werden konnte, wenn es nur in Relation trat. Das Seh-Ding (aus Gegenstand und Betrachter), das Kauf-Ding (aus Ware und Käufer).
Sogleich läuft Harman in das nächste Paradox, dass der Substanzphilosophie nicht ganz fremd war, nämlich, wie die Relationen überhaupt zu erklären seien, wenn alles in-sich-geschlossene Substanzen sind. Zwei Möglichkeiten drängen sich auf: Entweder haben die Dinge Beziehungen und diese beruhen auf inneren Eigenschaften der Dinge oder die Dinge haben an-sich keine Beziehung, und sind nur durch ein Medium verbunden. Die erste These war, wie Deleuze auch aufzeigt, entscheidend für die Entwicklung der antiken griechischen und römischen Metaphysik. Nur wenn die Dinge in sich eine Ordnung besaßen, könnten sie – je nach dieser Ordnung – in Beziehung treten. Diese Möglichkeit gibt dieser Ordnung der Dinge jedoch das Primat über die Dinge und ihre kreative Kraft; es ist wenig überraschend, das Harman diese ablehnt. Bedenken wir die andere. Hume war fasziniert mit den Schriften Malebranches. Das Nebeneinander von Leib und Seele, die keine direkte Relation und keine Kausalität kannten[252], schien so nahtlos auf die Billardkugeln übertragbar zu sein. Wenn schon Geist und Körper nicht zusammenpassten, waren sie doch in einem Körper vereint, wie sollten dann so fremde Dinge wie Billardkugeln, Steine oder gar Gestirne kausal interagieren? Was Hume als Ausweitung der Thesen Malebranches vom Leib-Seele-Dualismus kartesianischer Prägung auf den Kosmos verstand, ist gewissermaßen eine regressive Bewegung betrachtet man Malebranches Quellen. Bereits al-Ghazālī befasst sich im 11.Jh. mit eben diesem Problem als er die menschliche Freiheit mit der göttlichen Determination zu vereinen sucht. Entscheidend ist dabei seine aus dem Qur’an entstammende Auffassung, dass es keinen Schöpfer neben Gott geben dürfte. Das Problem war auf der basalen Ebene nicht einmal die Freiheit des Menschen, sondern die schöpferische Kraft der Materie und der Dinge, insofern sie in Kontakt treten. Die Nähe der Dinge zueinander, so die Lösung, macht es nur möglich, dass Gott eingreifen und die Dinge beeinflussen kann; kein Ding affektiert ein anderes. Nur Gott agiert. Diese These scheint weit entfernt, doch sie trifft genau das Herz der europäischen Tradition der Kausaltheorien, wie sie im 17.Jh. aufkommen und bis heute bestimmend wirken. Allein der Fokus der Lösung, sowie der Fragestellung, nicht aber das Problem haben sich geändert. Radikal wird diese Frage jedoch erst, wenn man sie im realistischen Kontext betrachtet, in den Harman auch Heidegger stellen will. Aufbauend auf seinen Ausführungen über die Zeuganalyse aus Sein und Zeit, stellt sich die Frage erneut: „What Heidegger actually shows is a complete disconnetion between things, never able to touch each after fully, since they withdraw behind all human access and even behind all inanimate contact.“[253] Während die Dinge bei Husserl noch vollständig im Bewusstsein präsent waren, ist es gerade die Entzugsbewegung die Harman bei Heidegger stark machen will. Damit fällt aber auch das Bewusstsein als kausaler Verursacher oder Medium zwischen den Dingen weg. Insofern, die Dinge nicht durch das Bewusstsein zusammengehalten werden, da sich die Zeugganzheit von diesem emanzipiert und die Dinge im gleichen hermeneutischen Zirkel im Bezug aufeinander stehen, wie der Mensch zur Welt, gibt es eine Seite der Dinge die niemals in den aktualen Beziehungen erschöpft wird. „Everything is not connected.“[254] ist demnach Harmans Antwort auf die drohende okkasionalistische Frage. Eine unsichere Zwischenposition, die einerseits meint: “not everything is connected“[255], da Dinge nicht holistisch gedacht werden dürfen, aber doch Relationen zwischen ihnen bestehen müssen, insofern sie sich gegenseitig bestimmen. Aber auch „everything is disconnected“[256], da auch in diesen Beziehung nie das ganze Ding präsent ist und es damit selbst in der Beziehung unverbunden ist. Das Leben der Dinge braucht für die Object-Oriented-Philosophy beides – Relation und Vereinzelung, Affektion und Rückzug. Berührten sich die Dinge ganz, ginge ihr Geheimnis, ihr Leben verloren, sie würden, mit Agamben gesprochen, profan.[257] Man muss sie verschlossen halten oder ontologisch verschließen. Verschließt man den Tempel fest genug, fällt noch nicht einmal auf, dass er manchmal leer ist.
Der Abbruch der Relation zwischen den Dingen, um ihre epistemische Souveränität zu sichern, ist jedoch keine notwendige Konsequenz, auch wenn Harman darauf besteht. Deleuze Analyse des Irrtums bei Spinoza zeigte uns bereits, dass auch in der Relation ein Körper dem anderen nie ganz zugänglich ist, da jede Idee im Geist von einer Mischung der Körper (also der Relation) ausgehen würde und damit nicht den anderen Körper an sich erfasst. Diese tiefen und individuellen Substanzen/Dinge halten jedoch eine ganz eigene Differenzphilosophie bereit. Die Welt besteht für Harman aus unendlich vielen und irreduziblen Substanzen, die alle zueinander in Differenz stehen ohne jemals auf einen gemeinsamen Grund reduzierbar zu sein, noch auf einem dieser Dinge als Grundbaustein aufbauen. Atome haben die gleiche Wirklichkeit wie Galaxien oder Tränen. Auch wenn Handschuhe aus Atomen bestehen, sind sie doch nicht auf diese reduzibel; man muss Boote genauso untersuchen wie Quarks. Doch auch in den Dingen findet man eine Differenz, zwischen dem, was ein Ding in Beziehungen zeigt und was es zurückhält. Diese Differenz ist jedoch nicht nur die symmetrische und extensive Differenz der Dinge unter sich, sondern eine intensive Differenz im Ding. Dass aber auch diese intensive Differenz in Wahrheit eine extensive ist, kann man sehen, wenn man nach der Tiefe der Dinge fragt, die Harman meint, im Kontrast zu dem, was Deleuze mit der Tiefe der Dinge meint. Sowohl in Logik des Sinns als auch in Differenz und Wiederholung wird der Tiefe eine besondere Stellung eingeräumt. Merleau-Ponty hatte bereits die zwei Alltagsauffassungen angegriffen, nach denen die Tiefe entweder von gleicher Art wie Länge und Breite ist, oder sogar aus diesen nur resultiert. Dagegen setzte er eine optische Tiefe aus der Länge und Breite erst synthetisch erwachsen.[258] In Analogie betrachtet Deleuze die Tiefe als Spatium, bevölkert von Intensitäten, aus dem das Extensum, als ausgedehnter und von ausgedehnten Dingen ausgefüllter Raum, entsteht.[259] Das Spatium ist aber nur als produktiver Prozess, insofern es ein Extensum hervorbringt, mit dem es koexistent aber nicht koextensiv ist, d.h. nicht identisch. Es ist kein anderer Raum, lässt sich nicht vom ausgedehnten Raum trennen, ist aber gleichzeitig nicht mit diesem identisch und übersteigt diesen immer als immanenter Exzess. Harmans innere Differenz (Tiefe) ist hingegen zunächst einmal formal bestimmt als das, was sich den Relationen entzieht, also bereits Teil oder Komponente des Dinges ist, ohne offen zu sein. Auch bei Harman scheint die produktive und kreative Kraft aus dieser Tiefe zu kommen. Aber während bei Deleuze die Tiefe an das Ausgedehnte gebunden war und vice versa, scheint das Verhältnis bei Harman anders zu sein. Anstatt das Ding hervorzubringen ist es etwas, das zum Ding gehört und ihm angehört. Es ist ein zweiter immer verborgener Bereich, der das Ding in zwei Bereiche spaltet, die aber nur durch eine formale Analyse überhaupt im selben Ding vereint sind.[260] Die Frage ist, wieso diese versteckte Dimension überhaupt zum Ding gehören sollte. Verfolgen wir diese Frage kurz, um zum organischen Paradigma Harmans zu kommen.
Der philosophische Fetisch Heideggers zu den Dingen blieb bereits Adorno nicht verborgen: „Bei Heidegger überschlägt sich Sachlichkeit: er ist darauf aus, gleichsam ohne Form, rein aus den Sachen zu philosophieren, und damit verflüchtigen diese sich ihm.“[261] Das Denken aus den Sachen[262], den Seienden, lässt Heidegger nicht nur die Form/Methode verlieren, sondern vergisst das entscheidende, das Nicht-Identische, da es das Bewusstsein, so Adorno, in realistischer Manier direkt in Kontakt mit den Dingen setzt. So haltlos und philosophisch umstritten der Vorwurf Adornos auch sein mag, zeigt sich an ihm eine wichtige Tendenz einer gewissen Heidegger-Interpretation. In Sein und Zeit war das Ding als Kritik an der abendländischen Philosophie, die das Zeug zugunsten der vorhandenen Dinge vergaß, in Stellung gebracht worden. Im Ursprung des Kunstwerkes jedoch wird der Begriff des Dings koextensiv mit dem des Zeugs und dem Vorhandenen, welche beide vom Kunstwerk überstiegen werden. Harman möchte, obwohl neuere Arbeiten auch am Geviert ansetzen, an Heideggers Zeugbegriff festhalten. Hier kann man Adornos Kritik zumindest teilweise ansetzen, insofern Heidegger diese selbst erkannte und nach der Kehre umsetzte. Seine Faszination mit Dingen und sein Bestreben in ihnen beispielsweise das Geviert zu erkennen, ist zwar unverkennbar, steht dahinter jedoch immer die ontologische Grundintention das Sein selbst zu denken. Gerade diese Dimension des Seins, will Harman immer vergessen, um auf den Dingen/Seienden bestehen zu können. Deutlich zeigt sich dies am der Auslegung des Heideggerschen Entziehens bei Harman. „Being is what withdraws behind all presence, meaning all relations of any sort, always capable of disrupting these relations.“[263] Soweit auch die klassische Heidegger-Auslegung. Insofern sich das Sein entzieht, ist es genau die erhoffte Dimension, in der Harman seinen Entzug der Dinge beschwören kann. Wieso haben wir dennoch gerade behauptet, dass Harman das Heideggersche Sein vernachlässigen will? Kurz: Sein ereignet sich. Heidegger bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung von a-letheia:
„Wenn wir aletheia statt mit »Wahrheit« durch »Unverborgenheit« übersetzen, dann ist diese Übersetzung nicht nur »wörtlicher«, sondern sie enthält die Weisung, den gewohnten Begriff der Wahrheit im Sinne der Richtigkeit der Aussage um- und zurückzudenken in jenes noch Unbegriffene der Entborgenheit und der Entbergung des Seienden.“[264]
Insofern die Seienden sind, sind sie schon der Verborgenheit als Unverborgenheit abgerungen. Da der Blick in der abendländischen Philosophie nur auf die Seienden fiel, entging ihnen der Ab-grund, aus dem sie stammen. Heidegger besteht also darauf, dass die Lichtung und Offenheit schon immer auf dem Verbergen des Seins „gründet“. Diese verborgene Dimension bezeichnet aber gerade keinen zweiten, „versteckten“ Bereich, sondern prozessual gesehen die formale Differenz (mit Duns Scotus gesprochen) zu den Seienden. Das Sein ist nicht nur epistemologisch, sondern ontologisch dunkel. Hier zeigt sich Heideggers genetische Dimension der Ontologie – jedes Seiende ist dem Verborgenen abgerungen. Eben in diesem Spiel von Offenheit und Verbergung ereignet sich Sein. Eben genau diese genetische Dimension versucht Harman auszuschließen, um sie in die Dinge selbst zu legen. Denn Heidegger geht noch weiter:
„Ein Geben, das nur seine Gabe gibt, sich selbst jedoch dabei zurückhält und entzieht, ein solches Geben nennen wir das Schicken. Nach dem so zu denkenden Sinn von Geben ist Sein, das es gibt, das Geschickte. Dergestalt geschickt bleibt jede seiner Wandlungen.“[265]
Die verborgene Dimension ist also keinesfalls eine Tiefe oder statische Entzogenheit, sondern sie ist die Genese des Seienden, das was im Gegebenen nicht aufgeht; die Gabe selbst. Anstatt auf ein Reservoir in den Dingen hinaus zu wollen, beschreibt Heidegger etwas, was die Dinge ausmacht, ohne in ihnen zu liegen. Die Genese ist immer anonym, namenlose Gabe, Es-gibt.[266] Harman versucht diese unpersönliche Prozessualität ins Innere der Dinge zu verlegen und sie zu Dingen sui generis zu machen; und verfehlt damit den Kern der Heideggerschen Ontologie.
Anstatt aus sich selbst heraus zu sein, evoziert er, ohne ihn doch genau zu benennen, den Ungrund aus dem die Dinge aufkommen, der wiederum nicht auf diese reduzibel ist.
Jedes Ding hat ein Antezedens. Es ist gerade die Wurzel der Object-Oriented-Philosophy, die die Stabilität und Selbstgenügsamkeit der Dinge untergräbt. Anstatt auf eine aktuale Tiefe referieren zu können, die in den Dingen liegt, sprechen Heidegger (und Deleuze) von einer Tiefe die sich virtuell ereignet und eben in diesem Ereignis das Ding ermöglicht, ohne selbst zu diesem Ding zu gehören; anonymes prozessuales Sein.[267]
Iain Hamilton Grant, als Schelling-Deleuzianer von Harman des Untergrabens der Dinge bezichtigt, formuliert diese Spannung zwischen seinem und Harmans Ansatz so:
„The difference lies between two conceptions of actuality, one of which I will call the depth model, and which consists either of objects all the way down or of a single ground from which all emerge; and the other, the genetic model, which makes depth regional with respect to anteriority.”[268]
Damit trifft er den Kern des Problems, der nicht nur in der Affirmation oder Negation von Dingen liegt, sondern in den Prämissen und Konsequenzen eines solchen Schrittes für die Konzeption der Aktualität. Harmans Bestehen auf den irreduziblen Dingen sui generis, muss die genetische Dimension in die Aktualität der Dinge selbst holen, da jedes mögliche Antezedens zu ihnen, das nicht in der Aktualität selbst läge, die Dinge untergrabbar machen könnte. Haben die Dinge eine Bedingung, die nicht in ihrer eigenen Aktualität gegenwärtig ist, so könnten sie auf diese reduziert werden oder würden zumindest teilweise ihre Kraft zu affizieren an diese virtuelle Dimension abgeben. Wir finden hierin die Wurzel für Harmans Kampf mit dem Okkasionismus, der als Frage erst aufkommt, wenn alles, was man als ontologisch gesichert annimmt aktuale Dinge sind. Sofort stellt sich doch die Frage, wie diese Körper überhaupt, wenn es doch außer ihnen nichts gibt, interagieren können. Wie der Stein das Fenster zerschlägt, wird genau dann zur Frage, wenn man vollständig aktuale Dinge annimmt, ohne eine Dimension außerhalb dieser Aktualität. Erst aus diesem Grund kommt das Argument des Mediums zwischen den Dingen auf, das Harman – erst einmal durch die Aporien in seinem eigenen Denkweg aufgekommen – paradox gegen die Philosophien der Relationalität richten will. Gleichzeitig finden wir hier den Stab Plutonium wieder, der in der Wüste liegt und potenziell tödlich ist. Inwiefern der Stab potenziell tödlich ist und welche Eigenschaften oder Relationen diese Qualität effizient machen, liegen allein in der Konzeption von Aktualität, die man an ihn ansetzt. Harmans Problem wird genau da dringend, wo man sich fragt, ob der Stab aktual tödlich ist, wenn er doch keine Relationen eingegangen ist, die töten. Will man keine Virtualität annehmen und die Aktualität zu einer universalen Dimension erklären, dann ist Harman nur konsequent, sich gegen Relationalität und für Substanzen auszusprechen. Wie wir jedoch schon am Beispiel des Heideggerschen Grundes der Object-Oriented-Philosophy sahen, ist diese Annahme der Universalität der Aktualität, in der eine mysteriöse Tiefe waltet, nicht begründbar. Heidegger selbst ist es, der genau einer solchen These widerspricht, insofern er sogar dem Sein selbst eine genetische Dimension gibt und die Aktualität notwendig begrenzt, das heißt durch ein Antezedens bedingt, beschreibt. Wahrheit ist Unverborgenheit, die einer Verborgenheit erst abgerungen wurde; Sein ist geschickt, Zeit gegeben, beide „gibt Es“ – sie ereignen sich. Aktualität gibt es nur als Entborgenes, welches in der Entbergung auf das Verborgene verweist, aus dem die Aktualität stammt, wobei sich diese Verborgenheit ebenfalls nur in der Entbergung ereignet. Sein gibt es nur in actu.
Klarer wird diese Problematik, wenn wir sie in Harmans anderer Quelle – Whitehead – untersuchen. In gewisser Weise scheint die hier aber Harmans Aktualismus durch die aktualistische Prozessontologie Whiteheads gestützt zu werden, denn Harman erkennt ganz richtig Whiteheads radikal realistischen Impetus, insofern er auf eine selbstständige und nicht von unserem Denken abhängige Realität besteht; weder nominalistisch (Kantisch) noch empiristisch (Humesch) aufhebbar.[269] Dieser Realismus unterscheidet sich gerade von den empiristischen Manövern, in denen Schelling, Deleuze und Grant in diese unabhängige Realität denken wollen. Die Realität eines Dinges als Körper wäre bei Deleuze auf das Zusammenspiel der Intensitäten reduzibel, die es konstituieren, sowie den Intensitäten, die es freisetzen kann: Die physikalischen Kräfte, die es ausmachen im Zusammenspiel mit virtuellen Strukturen, die diese leiten, sowie die Effekte, die es hat und haben könnte. Das Ding ist seine Ereignisse, gleichzeitig sein Körper, als ereignishaftes Zusammenspiel von intensiven Kräften. Der aktuelle Körper wäre darin aber eben kein Ding, das diesen Beziehungen – oder seinem Ereignis – zu Grunde läge. Hinter dem Trugbild gibt es kein Bild mehr – der Körper ist seine Effekte, insofern eben jener Körper auch ein Effekt ist. Anders würde Whitehead zwar diese Effekte als real unterstützen, jedoch auf dem Ding bestehen, das seinen Effekten zu Grunde liegt. Der realistische Impetus Whiteheads stammt dabei von seiner Wende gegen Kant, die Realität nicht nur durch das Problem des Zugangs zu ihr zu beschreiben oder sie auf eine Konstruktion, samt notwendiger Apprehension und Identifikation zu reduzieren. Seine Lösung hierfür ist das Bestehen auf der Realität jenseits unseres Erkennens – auch wenn unser Erkennen als Element der Realität eine Rolle spielen kann – die für ihn, um konsistent zu sein, auch wirkliche Dinge enthalten musste. Ob diese ontologische These den noumenalen Bereich Kants nur aktualisiert oder Kant ganz umgeht sei hier dahingestellt. Das Entscheidende für uns wird diese These in Bezug auf Harman sein. Es ist eben genau diese These, dass es wirklich-wirkliche gibt, die Harman retten will, ohne jedoch die These der Relationalität dieser Dinge annehmen zu wollen. Doch diese Ablehnung scheint zunächst vollkommen Paradox, enthält doch auch den ersten Blick Whiteheads Denken der „publicity“ aber auch „privacy“ der Dinge in Relationen, genau die Tiefe, die das gewünschte Innenleben der Dinge sichert. Betrachte man nur:
“[I]n the analysis of actuality the antithesis between publicity and privacy obtrudes itself at every stage. There are elements only to be understood by reference to what is beyond the fact in question; and there are elements expressive of the immediate, private, personal, individuality of the fact in question. The former elements express the publicity of the world; the latter elements express the privacy of the individual.”[270]
Es scheint so, als gewähre Whitehead den Dingen eine Tiefe, die wiederum nicht in der Relation aufgeht, die sich in den Individuen verbirgt. Es ist diese „privacy“, die Harman ebenfalls gerne reservieren würde, jedoch nicht tut; aus gutem Grund. „Whitehead is indeed sensitive to the hidden inner life of things that so preoccupies Harman”[271], jedoch ist er gleichzeitig unendlich weit entfernt von Harmans Aktualismus. Individuelle Dinge oder konkrete Dinge – wie Whitehead auch sagt – sind gleichzeitig ‚actual entities‘ und ‚actual occasions‘.Eine Doppelnatur, die den Gang von Process and Reality und Modes of Thought bestimmt, im Versuch beide aufrecht zu erhalten und den Dualismus zwischen ihnen auszuräumen. „These two modes of being are different, and yet they can be identified with one another, in much the same way that ‘matter has been identified with energy’ in modern physics.”[272] Nicht vollkommen ineinander überführbar, sind sie doch nicht vollkommen verschieden voreinander, ähnlich wie Spinozas Körper und Denken oder Duns Scotus Schöpfer und Schöpfung; formale Differenz, keine numerische Verschiedenheit; intensive Differenz statt extensiver Unterscheidung. Ein konkretes Ding bei Whitehead ist Entität und als solche Prozess und ist Prozess und als solcher Entität. Eben genau diese Dimension will Harman ausschneiden, da er sich vor dem kosmischen Humor, der temporalen Ironie als Konsequenz dieser These fürchtet. Denn in seiner Doppelnatur steigt die „privacy“ auch an die Oberfläche der „publicity“; Als solche sich ereignenden Entitäten sind Dinge in die Zeit gegeben, die – nach Whiteheads britischem Humor – immer schon eine zerstörende und transitorische ist. Nicht nur werden Dinge durch andere ersetzt, sondern Dinge insofern sie als Ereignisse geschehen, ersetzen sich selbst ständig, denn „objectification involves elimination. The present fact has not the past fact with it in any full immediacy.”[273] Dies ist die Welt der dritten Synthese der Zeit von Deleuze. Die Gegenwart ist koexistent mit der Vergangenheit, doch gerade dadurch kann die Gegenwart nie seine volle virtuelle Vergangenheit enthalten. Die Whiteheadsche Konklusion ist, in Bezug auf die aktualen Beziehungen von Dingen, dass nie ein Ding von einem anderen die volle Natur erkennen kann, da diese Natur schon im Moment der Objektivierung verloren sein wird, ein Ding der nicht aktualen Vergangenheit. Mit einem Lachen schreibt daher Whitehead eben, dass die Reduktion des Zustandes einer Entität auf ein einziges vollkommen aktuales „datum“ – so wie Harman es auch gern hätte – „objective immortality“[274] sei. Die Unsterblichkeit eines Dinges, das schon lange tot ist. Versteinerung, Mumifizierung, Gefrieren – das ist die Welt der „objective immortality“, die sich die Object-Oriented-Ontology wünscht. Obwohl auch bei Whitehead, die Dinge eine „privacy“ besitzen, die den anderen Dingen keinen vollständigen Zugang zu ihnen erlaubt, das heißt Dinge eine Art inneres Leben haben, resultiert es bei Whitehead gerade aus der Doppelnatur von Entität und Ereignis. Diese verweist gerade auf die genetische Dimension der Aktualität und nicht auf einen ganz verschlossenen oder gesonderten Bereich der Tiefe in der Aktualität, den Harman sich wünscht. Die schiere Bedingtheit der Aktualität, die sie begrenzen würde, beziehungsweise nötig machen würde sie um eine genetische Dimension zu erweitern, ist Harmans Angst. Die Tiefe wird das Refugium vor dieser alles reduzierenden Bedingtheit. Es ist hier, wo sich endlich das organische Paradigma Harmans enthüllt.
Im 18.Jh. beginnt die Frage der organischen Formen in zunehmend dynamischer Weise gestellt zu werden. Während die taxinomia von Linné und Tournefort immer noch Gültigkeit behielt, versuchten Lamarck und Caroll, lösen sie die statische Ordnung der Merkmale durch eine nicht weniger rigide Organisation der Tiere ab, die in der Lage war, ihre Transformation über die Zeit aus der nicht repräsentierbaren Struktur zu erklären, die sich auf den repräsentierbaren Elementen gründete.[275] Die Epigenese, bereits Grundstein des Aristotelianismus ringt hier bereits mit der Preformationslehre, um die Seele der Wissenschaften des 18.Jh. Obwohl auch Geoffrey Saint-Hilaire diese Transformationen anerkannte, war es die Ordnung dieser, die die Sicherheit und Invarianz der Tiere sicherstellte. Insofern nur Organismen aus Organismen folgten, würden sie über alle Zeit das bleiben was sie waren, für immer mit sich identisch, gesichert durch die Hand des „emboîment infini“[276] Obwohl, durch die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie, genau diese These, die den Weg ins 20. Und 21.Jh. gefunden hat, das Organismen nur aus Organismen hervor gehen. Doch gerade hier treffen wir das Problem der Genese und ihrer Negation doppelt an – einerseits versucht dieser Organizismus seine eigene Genese aus anorganischen Materialien zu verneinen, und andererseits stellt sie in Frage, dass die Formen, in denen sich die Organismen entwickeln und wachsen, geworden sind. Als seien sie einfach aus den Händen des Schöpfers übergeben, spottet schon Kant. Analog versucht Harman nur Dinge aus Dingen folgen zu lassen, die ihre Form innerlich enthalten, anstatt dass sie entstehen. Damit ist nicht gemeint, dass Harman jede Transformation eines Dinges ausschließt, doch das er diese Transformationen und ihre Bedingungen ganz in die Aktualität verlegt. Hegels Antwort auf Kants Frage nach der Ewigkeit der Welt ist hier erhellend. Anstatt eine positive oder negative Antwort zu geben, versucht er die Frage selbst zu eliminieren:
„die Ewigkeit ist nicht vor oder nach der Zeit, nicht vor der Erschaffung der Welt, noch wenn sie untergeht; sondern die Ewigkeit ist absolute Gegenwart, das Jetzt ohne Vor und Nach. Die Welt ist erschaffen, wird erschaffen jetzt und ist ewig erschaffen worden“[277]
Deswegen ist für Hegel die Geologie nicht nur nutzlos, sondern gefährlich, da er der konstante Nachweis einer Bedingtheit der Aktualität der Erde ist, ja sogar für die Entstehung der Erde selbst. Die gemeinsame Bewegung von Harman und Hegel ist das Eliminieren einer Bedingtheit der Aktualität und die Ausweitung auf alle Gebiete des Universums. Harmann – vielmehr als Geologe und Chemiker denn als Biologe – setzt mit Schelling dagegen: „Die Ding sind nicht die Prinzipien des Organismus, sondern der Organismus ist das Prinzipium der Dinge.“[278] Keinesfalls ist hier die These eines riesigen Organismus als Natur ausgesagt, wie Hartmann meint[279], sondern gerade das Gegenteil, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass Schelling auf der Suche nach dem Un-Ding der Natur ist.[280] Die Natur, die produktive Kraft, natura naturans ist kein Ding; sie ist anorganisch.
Harman geht es nicht darum diese Kraft ganz zu tilgen, sondern sie in die Dinge zu verlegen und sie zum Teil der Dinge zu machen. Damit verwandelt er die anorganische Kraft in organische Kräfte – Kräfte zur Selbsterhaltung und Produktion aus sich heraus. Eine seltsame topologische Asymmetrie stellt sich ein, in der das Produkt die Produktion übersteigt, oder der Inhalt das Gefäß. Die Dinge im Raum wollen den Raum selbst ausfüllen, ihn ganz ausmachen – so wie Leibniz sich den Raum nur als Abstraktion vorstellte, so will Harman die Dinge den gesamten Kosmos ausfüllen lassen. „Orgisch zu werden und das Ansich zu erobern ist der höchste Wunsch des Organischen“[281] schreibt Deleuze. Die organische Repräsentation, mit ihren extensiven und vierfach verwurzelten Fesseln[282] will sein außen ganz in sich aufnehmen, sich über die Welt der Intensitäten stülpen und diese Verdauen, wie eine Amöbe. Besonders deutlich wird diese Bewegung in den Versuchen Hegels und Leibniz‘, die Repräsentation von ihrer endlichen organischen Struktur ins Unendliche zu heben, sie orgisch zu machen. Hegels Bewegung zum unendlich Großen in der Kontradiktion und Leibniz Vizediktion zum unendlich Kleinen[283], versuchen selbst im Chaos und der Trunkenheit des Unendlichen die Identitäten, Gegensätze, Ähnlichkeiten und Analogien zu sichern, die die organische Repräsentation ausmachen.[284] Sie überdecken die intensiven Differenzen, die immer zu groß oder zu klein sind, um organischen und repräsentierbar werden zu können; verstellen sie nicht nur, sondern drängen sie aus dem Sein.[285] Nietzsche versucht dagegen zu setzen: „In der anorganischen Welt scheint sie zu fehlen, in der organischen beginnt die List: die Pflanzen sind bereits Meisterinnen in ihr.“[286] Die organische Repräsentation ist diese List, deren Trick gar nicht ihre Existenz ist, sondern das Überdecken des Subrepräsentationalen. Doch schon Hegel und Leibniz sucht die Katastrophe an jeder Stelle der Durchmessung des Unendlichen heim – der Tod, der Wahnsinn, der Unsinn. „Zeugt nicht gerade die Differenz als Katastrophe von einem irreduziblen aufrührerischen Untergrund, der unter dem scheinbaren Gleichgewicht der organischen Repräsentation fortwirkt?“[287] So wie Geoffrey Saint Hilaire die Missgeburten[288] anführt oder Steffens die geologische Linie, evoziert auch Deleuze ein Brodeln unter den verteilten Qualitäten und Ausdehnungen, die sub-repräsentational in der Tiefe weiterwirken und in affirmativer Wiederholung diese erst hervorbringen. Es ist eben dieses Brodeln der freien Intensitäten, der zu kleinen und zu großen anorganischen Differenzen, das Harman verschwinden lassen muss, indem er es topologisch verlagert. Anstatt erst die Bedingung der Dinge zu sein, macht er es zum Bestandteil des Dinges, zur unsichtbaren Erweiterung des Dinges. Hegel und Leibniz ziehen sich in Harman zusammen; keine Bedingungen und keine Grenzen für Dinge. Das Universum wird vollständig von Dingen im ganz Großen ausgefüllt und besteht im ganz Kleinen nur aus Dingen, die wiederum andere Dinge aufbauen – perfekte organische Repräsentation. Man muss nur rechtzeitig aufhören im Unendlichen, die Bewegung still stellen, damit die Dinge die intensiven Differenzen überdecken und als selbsterhaltendes Vieles erscheinen. James Huttons Theory of the earth verkörpert dieses plötzliche Anhalten der Bewegung des Unendlichen. Hegel herausfordernd untersucht er die Schichten der Erde und weist für die gegenwärtige Welt ein Antezedens auf, welches sich in den älteren Gesteinsschichten der Erde zeigt. Die Erde ist diese Schichtung, jede aus der vorherigen hervorgegangen, durch ein komplexes Spiel von Kräften mit „no vestige of a beginning – no prospect of an end.“[289] Erst am Ende setzt Huttons Missfallen gegen Fragen der Kosmogonie ein, indem er die wissenschaftliche der spekulativen Betrachtung vorzieht. Er schließt, dass die letzten Steine die letzten einer Reihe sind, die die Erde ausmachen und, dass damit die Geschichte der Erde abgeschlossen sei. Obwohl Hutton sich erfolgreich gegen den Aktualismus richtet, verfällt er ihm am Ende doch, indem er den letzten Stein als letzte Stufe, als kleinste Differenz zum Anfang betrachtet. Die Entstehung der Erde, die Bedingung des ältesten Steins bleibt ungedacht. Genauso verfährt auch Bruno, der in seiner Untersuchung der Kräfte der Natur tiefer und tiefer in die Materie eindringt, die den ganzen Planeten ausmacht, nur um im letzten Moment auf Aristotelische Substanzen auszuweichen.[290] In gleicher Weise muss Harman nur weit genug ins Kleine oder Große gehen und am Ende die Unendlichkeit mit einem Postulat überspringen: Wenn alle endlichen Dinge, Dinge waren, dann ist das Unendliche auch aus ihnen zusammengesetzt.
Das ist das organische Modell der universalen Tiefe der Dinge. Zu sagen, dass die Object-Oriented-Philosophy dem Anorganischen das Leben wiedergibt, heißt zu sagen, dass dieses Leben nur als Derivat des organischen Lebens auch in anorganischen Dingen bestehen kann. Die Extension des Begriffs Leben hat sich geändert und kann jetzt auch auf anorganische Materialien angewendet werden, doch die Intension erfährt keine Änderung. Lebendig zu sein bedeutet nichts anderes als schon bei Kant. Wir haben nichts Neues gelernt. Alles ist organisch geworden.
Huttons letzter Stein muss aber nicht der letzte sein.
Ihn zu hinterfragen hieße jedoch, das Prinzip des Antezedens nicht bis zur nächsten aktualen Instanz zu denken, sondern der Aktualität als solcher eine genetische Dimension zu verleihen. Insofern jedoch die Aktualität der Dinge selbst eine virtuelle (also genetische) Dimension enthält, füllen die gegenwärtigen Dinge zu keinem Zeitpunkt das Universum aus.[291] Stattdessen muss nach den Bedingungen für die Entstehung (und Geschichte) dieser Dinge gefragt werden, welche sich jedoch unendlich rückwärts aufeinander verweisen und den Anfang, den Ursprung unendlich verschieben – die Bedingung ist daher nicht der Grund der Dinge, sondern ihr Ungrund. Die Bedingungen für ein Ding, sind nicht die Bedingungen des Dinges – sie gehören dem Ding nicht, sondern können als Dativ erst retrospektiv, mittels Repräsentation, den Dingen zugeschrieben werden. Diese effektive Nachträglichkeit verdeckt das Antezedens zu sich selbst, nämlich, dass das Ding Bedingungen für seine Entstehung hatte, noch bevor es das Ding und damit die Möglichkeit einer Zuschreibung gab. Die einzige Möglichkeit, die Zugehörigkeit der Bedingungen zu den Dingen zu retten, wäre eben zu behaupten, dass das Ding schon angelegt gewesen sei, also in einer gewissen Weise schon subsistiert hatte, bevor es wirklich seinen genetischen Prozess durchlaufen hat. Dies ist exakt die These der Preformisten, die gegen die Epigenetiker des 18.Jh. immer wieder Präexistenz behaupteten, um die organische Repräsentation (die Invarianz der Arten aus Gottes Hand) zu retten. Durch Harmans Kampf mit diesen genetischen Kräften, die er durch Dingkräfte in der Tiefe ersetzen will und dessen Aporien und Missverständnisse haben wir bereits gesehen, dass sie nicht radikal genug ist, um dem Anorganischen Leben wiederzugeben. Man muss die Bedingungen vom Organismus/Ding lösen. Dies heißt zu nicht zu bestreiten, dass es Steine, Menschen, Burger oder Ideen gibt, sondern es heißt zu sagen, dass, da es diese Dinge gibt, es notwendig auch ihnen vorausgehende Geogonie, Ontogenese, Fleischverarbeitung und Ideation geben muss. Diese Vorgänge wiederum sind konstituiert und angetrieben durch ihr Antezedens, ihre Bedingungen, die sich wiederum nicht in ihnen erschöpfen und nicht zu ihnen gehören. Intensitäten sind immer unpersönlich. Es heißt zu sagen, dass die Intensitäten, die die Erde hervorbrachten auch Menschen, Atombomben und Ideen hervorbrachten. Unpersönlich.
Und so finden die Bedingungen keinen Halt mehr in den Dingen, in keiner Substanz und in keinem letzten Sub-Stratum. Sie sind ungegründet; allgemeiner Ungrund. Ab-Grund.
Neovitalismus (Einleitung) / Anorganische Biologie
Es existiert eine anorganische Chemie; kohlenstofffreie Verbindungen. Sie wird begrenzt durch die organische Chemie, der Studie jener Verbindungen, die Kohlenstoff enthalten und lebendige Systeme bilden. Diese scheinbar taxonomische Einteilung läuft jedoch parallel mit einer zweiten, eher biologischen Verschiebung, wie der Chemiker Williams feststellt:
“For many years most scientists have looked upon living systems as a growing and self-reproducing matrix. Such a view is a natural development from the separation of the animal and vegetable from the mineral kingdom. The distinction, perpetuated in the educational divisions of inorganic and organic chemistry has forced inorganic chemistry more and more towards physical science and organic chemistry toward life sciences.”[292]
Diese diskursive Verschränkung ist Ausdruck einer Doxa[293], die sich als denkkonstitutives Axiom präsentiert[294]. Lagrangepunkt zwischen diesen Diskurskörpern bildet die Metallorganische oder organometallische Chemie. Ein Metallatom bindet sich an eine organische Verbindung – eine Ununterscheidbarkeitszone bildet sich. Niemand weiß, ob dieses Gebiet zur organischen oder anorganischen Chemie gehört – eine Sache des Blickwinkels, nicht der Taxonomie; aber eben auch des dazugehörigen Diskurses. Als Echo der vielen neuen Ununterscheidbarkeitszonen in den Naturwissenschaften und Mathematik(en) hat sich ein neuer Realismus entwickelt, der die Essenzen zurückweist und trotzdem die Vagheiten des Anti-Realismus nicht annimmt. Vorreiter dieses neuen Materialismus ist Manuel DeLanda geworden, der mit Deleuze versucht, der modernen Wissenschaft endlich ihre Metaphysik zu geben.
Wir können uns einen Planeten vorstellen aus nur einem Element[295]; Silikon. Eine Wolke aus elektrisch geladenen subatomaren Teilchen mit unglaublich hoher Temperatur (Plasma) bildet einen Protostern[296], ein zunächst noch loses Gebilde als Wiege des Planeten. So beginnt DeLandas Deleuzianische Geogonie. Sie beginnt mit einer formlosen Masse, einem reinen Fluss von Energie in Form subatomarer Teilchen. Und doch sind diese Teilchen nicht nichts, sondern tragen, so DeLanda, bereits die Bifurkationen und Singularitäten in sich, die später die Differenzierung der Materie leiten werden. Der Protostern kühlt langsam ab, da er Energie an die Umgebung abgibt – es ist kalt im All. Unterschreitet die Temperatur eine gewisse Grenze aktualisieren sich die virtuellen Strukturen (die angelegten Bifurkationen) und bilden eine ganz neue Energielandschaft aus – neue Attraktoren erscheinen, indem sich die Materie an einigen Stellen verdichtet, gleichzeitig wird dieser Differenzierungsprozess der Materie von den neuen Attraktoren geleitet. Kerne beginnen zu entstehen. Und mit ihm bilden sich erneut neue virtuelle Strukturen aus, die unter bestimmten Gegebenheiten realisiert werden können. Allen voran die kleinen Orbits, die durch die Ladung der Kerne bestimmt wird[297], werden bald von Elektronen ‚bewohnt‘. Hat der Kern seine Schalen gefüllt, hat es eine stabile Form angenommen; ein Atom. Aus der formlosen Masse einer Plasmawolke steigt ein stabiles Teilchen hervor ohne dass irgendetwas von außen hinzutreten muss; die Bifurkationen sind virtuell bereits vorhanden, realisieren Attraktoren, die wiederum stabile Formen realisieren[298]. Kein Gesetz von außen, nur Regeln aus dem inneren der Materie. Nomos statt Logos.
Dieser Ein-Element-Planet kühlt weiter ab und zu der bereits bekannten Schwelle (Temperatur) kommen weitere hinzu – wie zum Beispiel Druck und Volumen. Offensichtlich werden diese Prozesse, durch die unterschiedliche Verteilung von Masse und Temperatur der Materie, nicht überall auf dem Planten auf die gleiche Weise ablaufen. An einigen Stellen wird durch die rapide Zunahme an Masse eine immense Wechselwirkung mit anderen Teilchen herrschen, die in der Lage ist, Materie weiter zu verdichten oder unter extremen Bedingungen unter der Einwirkung von Druck wieder zu schmelzen. Einige Orte werden dichte Gebirge gebildet haben, sobald sich die Atome eine molare Stabilität gewonnen haben und erst flüssig, dann solide geworden sind. Über weite Flächen werden sich unter schneller Verdichtung gewaltige Landschaften aus Glas gebildet haben, die durchsetzt sind von kleineren Flächen aus Kristallen, die sich langsamer verdichtet haben[299], verhangen durch immer noch gasartige Plasmawolken. Eine ganze Welt mit unendlich vielen Variationen ist entstanden und wird weiter entstehen, da die intensiven Differenzen immer neue Prozesse antreiben werden. Wir haben einen ewig sich wandelnden und unendlich differenzierten Planeten aus nur einem Element erdacht. Kein Bewusstsein, kein Organismus war hier nötig.
Der explizit Deleuzianische Ansatz DeLandas findet in diesem Szenario aus seinem Paper Nonorganic Life konkrete Gestalt: Realismus, Anti-Essentialismus, Morphogenese/Expressivität, Selbstorganisation. Das geologische Zeitalter aus DeLandas A Thousand Years of Non-Linear History beginnt mit den Städten. „Human population began mineralizing again, when they developed an urban exoskeleton“[300] und rekapitulierten damit die Entwicklung ihres Endoskeletts, einer Mineralisierung der fleischigen Materie-Energie in ein neues Material; Knochen. Geologie findet nicht nur auf der Erdkruste statt. Sie fügte vor 500 Millionen Jahren den Muskeln, Nerven und anderen weichen Geweben eine unterliegende Struktur hinzu – und es wird Jahre dauern bis Bacon diese wieder freilegen wird, bis das Fleisch von den Knochen rutscht. All diese Vorgänge brauchen nicht nur nicht den Menschen, sondern auch kein Bewusstsein (geschweige denn ein Selbstbewusstsein), das sie steuert. Die Anwesenheit der Erbauer des Exoskeletts Stadt als Bewusstsein, macht es noch nicht konstitutiv, sondern nur akzidentiell, insofern sie demselben Prozess entstammen wie die Städte selbst. Insofern für die Realität der Inhalt des menschlichen Bewusstseins keine konstitutive Rolle spielt, kann man DeLanda – wie er selbst auch häufig – einen Realisten nennen. Dabei ist bereits die Deleuzianische Änderung der Blickrichtung in Bezug auf den Realismus angedeutet in einer Trennung von Ontologie und Epistemologie. Der Diskurs um den Naiven Realismus, dass das postulieren einer Realität auch gleich dessen Erkennbarkeit implizieren würden sind abgelegt. Dies waren nur epistemologische Fragen, doch die ontologische Problematik ist entscheidend.[301] Realismus impliziert weder uneingeschränktes Wissen der Realität (epistemologische Frage), noch eine Totalität der physischen Realität (idealistischer ontologischer Vorwurf) oder gar die Identität der Realität (ontologischer Einwand Derridas) – ganz im Gegenteil wäre es, so DeLanda, erst einmal an den Anti-Realisten[302] zu zeigen, wieso eine realistische Position all diese Zugeständnisse notwendig machen müsste. Das Wichtigste geschieht immer in unserer Abwesenheit.
Dieser Realismus scheint jedoch vielmehr eine problematische Sphäre erst neu zu eröffnen, anstatt etwas zu erklären:
„Idealists have it easy. Their reality is uniformly populated by appearances or phenomena, structured by linguistic representations or social conventions, so they can feel safe to engage in metaphysical speculations knowing that the contents of their world have been settled in advance. Realists, on the other hand, are committed to assert the autonomy of reality from the human mind, but then must struggle to define what inhabits that reality. […] a materialist metaphysician can only be a realist about immanent entities, that is, entities that my not subsist without the connection to a material or energetic substratum.”[303]
Realismus impliziert mehr eine Suche und Experiment als ein Wissen und beschreibt damit noch vielmehr eine Praxis oder Verpflichtung an keiner Stelle einer ratio picra zu verfallen, sondern immanent zu bleiben. Diese Suche benötigt neue Modelle der Erklärung auf alte Probleme. Insofern nur immanente Entitäten akzeptiert werden, bleibt die Frage, wie überhaupt für die Stabilität der Entitäten (wenn auch nur relativ) gebürgt werden kann. Die klassische Aristotelische Antwort hierauf – die jedoch genauso heute noch nachwirkt – sind Essenzen. Der wachsweichen Materie wird von außen eine Form aufgetragen; Hyle-Morphismus. Für DeLanda kommt nun aber dieses Außen der Form, die sich selbst jedem genetischen Prozess und vor allem damit der Zeit entzieht, nicht mehr in Frage. Wir begegnen hier derselben Frage wie bereits in der Diskussion von Harmans Object-Oriented-Philosophy, insofern dieser ebenfalls an einer Äußerlichkeit der Form arbeitete, die sich der Genese entzieht. Gegen diesen Substanzialismus und Essentialismus setzt DeLanda eine Formgebung, die aus dem immanenten Raum entsteht, anstatt von außen auf diesen oktroyiert zu werden; Morphogenese. Anstatt einer trägen Materie, die erst geformt werden muss, setzt DeLanda ein Modell „In which matter is already pregnant with morphogenetic capabilities, therefore capable of generating form on ist own.“[304] Die Identität einer Seifenblase – in ihrer sphärischen Gestalt – lässt sich damit auf zwei Wegen erklären. Erstens könnte man sagen, dass sie durch ihre Essenz bestimmt ist, die die Form der Seifenblase durch Formung der Materie sichert – Aristoteles und seine Anhänger. Die zweite Deleuzianisch-DeLandaische Antwort ist sehr viel komplizierter: Die Materie selbst kann nicht einfach als träge Masse betrachtet werden, sondern muss eher als ein Materie-Energie-Fluss gesehen werden, der noch keine feste Form besitzt. Die Sphäre entsteht nun nicht durch eine äußere Einwirkung durch ein Gesetz, sondern durch einen Problem-Lösungs-Komplex in den die Seifenlauge eintritt. In einem Phasenraum dargestellt sieht man wie sich die Seifenlauge auf einen singulären Punkt in diesem Möglichkeitsraum hin organisiert; der Punkt an dem die freie Energie am geringsten ist und die Form damit am stabilsten.[305]
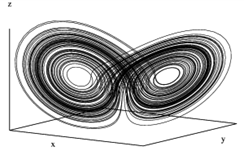 Phasenraum-Diagramm mit Strange Lorenz Attractor
Phasenraum-Diagramm mit Strange Lorenz Attractor
Diese Singularität ist dabei nicht das Gegenteil des Plurals, sondern des Gewöhnlichen. Die Seifenlauge durchläuft verschiedene mögliche Stadien im Möglichkeitsraum, der wiederum durch die Mannigfaltigkeit (wie beschrieben von Riemann) strukturiert ist und die Regelmäßigkeiten im morphogenetischen Prozess erklärt.[306] Nach einigen gewöhnlichen Punkten tendiert die Lauge zum singulären Punkt der minimalen Oberflächenspannung (d.h. des Minimums an freier Energie) – einer Kugelform. Sie wird also von keiner äußeren Kraft auf diesen Punkt „geschoben“, sondern „findet“ von allein – durch die ihr inhärenten Bifurkationen und Anziehungspunkte – zu diesem stabilen Zustand.[307] Damit kann Deleuze behaupten, dass sie Singularitäten „eher topologisch als geometrisch implizite Formen sind.“[308] – auch wenn Deleuze den Begriff der Singularität nicht immer gleich gebraucht. [309] Der Materie-Energie-Fluss tendiert damit zu einer stabilen und sich wiederholenden Realisation einer Möglichkeit, oder er durchläuft rhythmisch immer wieder die gleichen Stadien (oszillierender Attraktor) und nimmt so ein Form an. Keine Essenz nötig. Komplexitätstheorie statt Chaos-Theorie.
Damit verändert sich aber der ontologische Status ihrer Identität vollkommen, die nun nicht mehr durch ihre Eigenheit, verbürgt durch ihre Essenz, definiert ist, sondern durch ihren morphogenetischen Prozess. Deleuze, wie auch im Anschluss DeLanda, sprechen hier von diagrammatischen Strukturen, die den morphogenetischen Prozess leiten. Diese Diagramme unterscheiden sich von Strukturen im klassischen Sinne:
„Das Diagramm manifestiert sich hier im Unterschied zur Struktur, insofern die Allianzen ein dehnbares und transversales Netz weben, das senkrecht zur vertikalen Struktur steht, eine Praxis, ein Verfahren, oder eine Strategie definieren, die verschieden sind von jeder Kombinatorik, und ein instabiles, in permanentem Ungleichgewicht befindliches physisches System bilden anstelle eines geschlossenen Austauschsystems.“[310]
Während das System das Gleichgewicht der Kräfte ausdrückt, das sich selbst erhält, stellt das Diagramm diesen Anspruch auf Abgeschlossenheit nicht. Daher arbeitet es weniger mit notwendiger Kausalität als mit Tendenzen und Trends. Wieder Regel statt Gesetz. Anstatt die selbsterhaltenden Formen des Tausches abzubilden, zeichnet das Diagramm genau jenes anorganische Leben, dass die Struktur erst möglich macht – um diesen Verlauf zu sehen, muss man seine Hände in den Materialien haben[311]. Das Diagramm zeigt genau den Prozess an, der zu den aktuellen Produkten führt von denen die Struktur nur eines ist. Es zu vergessen heißt wieder die Genesis zu Gunsten der Stabilität auszuschneiden; Man vergisst das Diagramm, man vergisst das anorganische Leben. Insofern nun aber das Diagramm einen Problem-Lösungs-Komplex ausdrückt – also auch darstellt,[312] wie beispielsweise die Seifenlaugemoleküle das Problem der Oberflächenspannung lösen (nicht durch eine Struktur, sondern durch eine Tendenz, die das Diagramm ist), braucht es weder ein Gesetz noch ein anderes ihm äußeres, dass es bestimmt – vor allem kein Bewusstsein.[313] Roboter, Bäume, Steine, Plasma – sie alle sind Lösungen auf Probleme durch die Strategie des Diagramms. Hier schließt sich der materialistische Realismus von DeLanda. Keine äußere Kraft (Bewusstsein, Sprache, etc.) ist mehr nötig, keine Entitäten ohne Verbindung zur Materie mehr übrig. Doch diese topologische Wende ist noch nicht erschöpft damit. Gleichzeitig bricht es auch die Notwendigkeit der (organischen) Repräsentation für das Denken, wie Gilles Châtelet klar feststellt:
„The dotted line [of the diagram] refers neither to the point and its discrete destination, nor the line of its continuous trace, but to the pressure of virtuality […] that worries the already available image in order to create space for a new dimension: the diagram’s mode of existence is such that its genesis is comprised in its being. We could describe this as a technique of allusions.”[314]
In dieser Technik der Andeutung – ähnlich der Metapher – schafft sich das Diagramm einen Eigenraum, zugleich eine Eigenzeitlichkeit[315], in dem das Denken nicht mehr in den alten Bahnen laufen muss, sondern neue Assoziationen eingehen kann. Die Hand greift ins Denken ein; Zeichnen=Denken. Das Diagramm als Eigenraum legt die ursprüngliche Intensität unter den festen Strukturen und Gesetzen der Natur frei und erlaubt das Erschaffen neuer Konsistenzen, die die Struktur sogar unterlaufen.
Vorgeführt wurde diese ontologische Dringlichkeit der Diagrammatik durch den Chemiker B.P. Belusov, der 1958 eine chemische „Uhr“ erschuf; ein Gemisch, das spontan im 5 Sekundentakt den Säuregrad wechselte. Im Lichte der damaligen geltenden thermodynamischen Gesetze (oder Konventionen) sollte dies jedoch unmöglich sein, da die Chemikalien nach ihrem Energieaustausch in einen Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts zurückkehren sollten. Es ist nicht verwunderlich, dass man Belusov zunächst für einen Betrüger hielt, da seine Uhr den geltenden Gesetzen widersprach.[316] Anstatt des statisches Gleichgewichts schien sie auf ein dynamisches Gleichgewicht hinzudeuten – das vor allem den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu überwinden schien. Erst als Ilya Prigogine Belusovs Forschung in Mathematik übersetzte und zeigte, dass man eine konsistente Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik konstruieren kann in der die Gesetzte der klassischen Thermodynamik nicht uneingeschränkt gelten, fand der Gedanke anklang (und Prigogine erhielt einen Nobelpreis). Die Wissenschaft muss immer erst von der minoritären zur royalen werden, bevor sie ein Paradigma ausbilden kann. Genauer bewies Prigogine, dass es in einer Situation weit entfernt vom thermodynamischen Gleichgewicht Bifurkationen gibt, die dazu führen, dass sich dissipative Strukturen bilden, die das System irreversibel verändern und neue Energielandschaften bilden. An diesen singulären Punkten zeigt sich die nichtlineare Natur der Funktionen, die diese Vorgänge beschreiben. Um dies zu erkennen, braucht es jedoch das Diagramm und damit das Experiment, das diese Punkte findet anstatt sie abzuleiten – man kann die Singularitäten nicht erschöpfend errechnen. Insofern kann auch die Organisation, die sich durch diese Bifurkationen, wie im Fall der Belusovschen Uhr, nicht abgeleitet werden. Diese Organisation bezieht sich nur auf sich selbst, ist affirmative Selbstreferenzialität; der Ausdruck der Substanz in den Modi. Als solche ist sie Selbstorganisation. Ein beeindruckendes Beispiel für diese Form der Selbstorganisation sind die Soliton-Wellen. Bereits 1834 beobachtete der Schiffs-Ingenieur John Scott Russel eine Wassermasse im Kanal von Edinburgh, die sich als Welle mehrere Kilometer konsistent fortbewegte, obwohl sie nach einigen Dutzend Metern hätte verschwinden müssen. Obwohl schon 1892 mit der Kortweg-De Vries Gleichung die mathematische Grundlage zur Untersuchung solcher Phänomene gegeben war, dauerte es bis in die 1960er, dass die Soliton-Wellen durch die Tsunami-Forschung zureichend beschrieben wurden.[317] Welche Formen die Natur noch hervorbringen wird, das weiß noch keiner. Es handelt sich um Wellenpakete, die – obwohl sie sich durch die Zunahme an Entropie eigentlich schnell verschwinden sollten – über weite Distanzen ihre Form und sich in einem dispersiven und nichtlinearen Medium (z.B.) Wasser bewegen. Diese zwei Formen – chemische Uhren und Soliton-Wellen konstituieren jedoch nicht nur anorganische, sondern auch organische Systeme. Rhythmische Oszillation findet sich beispielsweise im menschlichen Metabolismus als der regulierende Faktor bei der chemischen Umwandlung von Glukose in Energie[318] Ebenso findet man Non-Periodische Oszillation bei der Regulierung des Herzschlages und der Ausschüttung einiger Hormone.[319] Auch die Frage, wie bestimmte Impulse ohne immensen Energieverlust durch den Körper gesendet werden, könnte durch die Soliton-Wellen erklärt werden.[320] Das anorganische Leben scheint also dem biologischen Leben nicht fremd zu sein und wirkt – trotz seiner Unberechenbarkeit – konstitutiv auf den Organismus. Gerade diese Unberechenbarkeit der intensiven Prozesse der Selbstorganisation, die die stabilen Gebilde wie Organismen erst ermöglichen, legen die Tiefendimension des organischen Lebens frei, das schon immer auf dem anorganischen aufbaut; wenn die Organismen Freiheit haben, dann ist es diese Unberechenbarkeit des Anorganischen in ihnen.
Das anorganische Leben ist unberechenbar. Laplace Dämon ist tot.
Einschub: Die Innenseite der Atome (Bennett und Shaviro)
Jane Bennett begegnet einem Handschuh, einer Ratte und einer Mütze[321]; sie bewohnen die Straße. Doch bleiben sie nichts rein Äußerliches. Sie affektieren sie, lassen sie in Verbindung mit ihnen treten, lassen sie ein Gefüge mit ihnen werden, solange der Blick nicht weicht. Jeder Körper, der andere affektieren kann, ist umgekehrt in der Lage affektiert zu werden, insofern sie alle nur Modi derselben Substanz sind. Alle Körper sind damit in der Lage mehr oder minder stabile heterogene Assemblagen zu bilden – je mehr desto besser. Der entscheidende Gedanke für eine politische Ökologie, die Bennett verfolgt ist dabei, dass die Modi bei der Bildung der Verbindungen nicht nur nicht hierarchisch verfahren, sondern auch ontologisch univok sind. Nichts schreibt a priori vor, welche Verbindungen förderlich oder hemmend sein werden. Mensch und Pferd bilden den Nomaden, Soldat und Gewehr den Musketier und Mensch und Computer den Hacker. Das Anorganische und das Organische sind gleichberechtigt, da sie in der gleichen Weise Modi der Substanz sind. Es ist banal zu erwähnen, dass das Anorganische schon immer das Organische bewohnt, doch der Gedanke des Bruches der ontologischen Hierarchie gehört eher zur Gegengeschichte zur abendländischen Tradition. Der Conatus zieht die Körper zusammen ohne Beachtung der Trennung zwischen Mensch und Stein, zwischen Sand und Baum.
Was verhindert nun aber, dass wir bei Bennetts ebenfalls auf Conatus und Selbsterhaltung zentrierten Ansatz einer „material vitality [that] congeals into bodies, bodies that seek to perserve or prolong their run“ in die Probleme des Bryantschen Ansatzes laufen. Während DeLanda durch die Phasenräume[322] oder auch Michel Serres in Anlehnung an den Climanen Lukrez‘[323] ein intensives Feld oder zumindest ein aleatorisches Moment einführte, so besteht Bennett auf einem Conatus, der die Dinge konstituiert und gleichzeitig die Dinge bewohnt. Er wird als wertvolles Postulat angenommen – ebenso wie er bei Spinoza technisch strategisch eingeführt wird – um im Zirkelschluss zu zeigen, dass er die Konsistenz des Systems bestätigt. Wenn Bennett nun über den Conatus sprechen will, dann kann sie dies nur über die Körper tun, die diesen exemplifizieren. Um gerade das Unberechenbare dieses Conatus hervor zu heben, wählt Bennett das paradoxeste Objekt; das Metall. Konträr zu der oberflächlichen Erscheinung der soliden metallischen Objekte, sind sie voller Imperfektionen, vor allem Löcher in der Gitterstruktur der kristallinen Form, die das Metall ausmachen – „intercristelline spaces.“[324] Diese Zwischenräume, sind jedoch nicht akzidentiell, sondern substanziell für die Eigenschaften des Metalls. In diesen Zwischenräumen spielt sich das unpersönliche Leben – so Bennett nach DeLanda – ab. Bricht das Metall, dann zuerst an den Stellen der Lücken, an denen die strukturale Integrität am geringsten ist – jedoch gerade deswegen in dynamischer statt deterministischer Weise. Die komplexen Dynamiken der Brüche zeigen das unpersönliche Leben oder weisen es auf, da
„[t]he line of travel of these cracks is not deterministic, but expressive of an emergent causality, whereby grains respond on the spot and in real time to the idiosyncratic movements of their neighbors, and then to their neighbors response to their response, and so on, in feedback spirals.”[325]
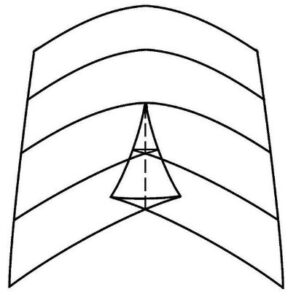 Schwalbenschwanz-Katastrophe nach René Thom
Schwalbenschwanz-Katastrophe nach René Thom
Diese rekursive Kausalität lässt sich auch als Singularitäten beschreiben, die in einem nicht-linearen System Umbrüche und Veränderungen einleiten, die das ganze System als solches in neue Konfigurationen hebt. Die Linie wird unberechenbar und bewegt sich nach einer eigenen Logik, die dem berechenbaren Gesetz nicht mehr entspricht, jedoch nicht vollkommen zufällig ist. DeLanda nennt dies Tendenz, Deleuze und Guattari bezeichneten es als Nomos der Materie[326] und Bennett – auf beide anspielend – Nomadismus der Materie. Zur quasi-kausalen oder rekursiv emergent kausalen Linie gesellen sich bei Deleuze die Linie Paul Klees, der die Inflexionspunkte aufzeigt, die der Falte unendliche Krümmungen und Variationen verleihen – sie ins Unendliche faltet, um sich dann in diesen Faltungen zu verbergen[327]; die katastrophischen Kurven und Transformationen Thoms[328]; die nomadische Linie des Nomaden auf der Suche nach einem provisorischen Ankerpunkt, die diagrammatische Linie der angewandten Wissenschaften, die von der Repräsentation der ewigen Gesetze befreit; die 1,261859 dimensionale Kurve Kochs[329]; die Linie einer Zeichnung, die „die Gewalt eines nicht organischen Lebens“[330] ausdrückt; und nicht zuletzt die nordische Linie Worringers, die eine Lebendigkeit und Unberechenbarkeit zeigt, da sie sich keiner darstellenden und abbildenden Funktion zuordnen lässt, sondern eine nicht gebundene Vitalität zeigt. Überall Linien. Die Linie, die DeLanda und Bennett beschreiben, scheint jedoch eine ganz neue Problematik aufzuzeigen. Philosophisch-methodisch fragt sie doch: Wie zeigt sich das unpersönliche Leben? Die gegebene Antwort –die die Bennett-DeLanda-Linie von denen von Deleuze unterscheidet – ist ihr Einsatz als Strategie gegen das Monopol des organischen Lebens. Hatte Kant dem Leben gerade im Gegensatz zum Anorganischen Spontanität zugeschrieben, so versuchen nun Bennett-DeLanda zu zeigen, dass auch Steine durch rekursiv emergente Kausalität sich selbst ein Gesetz geben können. Der Stromausfall als unberechenbares anorganisches Ereignis ist nicht zufällig eines von Bennets Hauptbeispielen. Kants Rahmen wird eingehalten, man versucht nur innerhalb diesem die Dinge anders anzuordnen. Insofern aber auch anorganische Dinge Spontanität besitzen, könnte man entweder sagen, dass sie auch organisch sind – im Kantischen Sinne – oder wir sagen, dass die Spontanität nicht exklusiv dem Organischen zusteht; damit aber subsequent die Intension des Begriffs „Organismus“ aufweichen. Alles ist Organismus – nichts ist Organismus.[331] Egal.
Eine weitere Variation dieser neovitalistischen Gefangenschaft im Kantischen Rahmen des Denkens zeigt sich bei Shaviro, der eine Modulation von Whitehead als panpsychistische Alternative zur Kantischen Konzeption anbieten will. Whiteheads Universum wird bevölkert von Atomen, die fühlen und Teilchen, die man nach ihrer persönlich erlebten Geschichte fragen könnte; auch wenn diese zugegebener Maßen nicht sehr spannend ausfallen würde. Der besondere Dreh des Whiteheadschen Panpsychismus besteht dabei vor allem im Verschieben des klassischen Lokus des Denkens. Euler exemplifiziert diese Position am besten, wenn er argumentiert, wieso Dinge nicht denken können. Das Denken, so Euler, besteht vor allem in der Spontanität, die eine gerichtete Handlung nach sich zieht. Da die Dinge solche Handlungen nicht erkennen lassen, können sie nicht gedacht haben.[332] Whitehead umgeht dies, indem er das Denken nicht in die Dinge verlegen will, sondern Denken im Gegenteil gerade dann geschieht, wenn Dinge zusammentreffen. Aber auch Deleuze findet sich in dieser paradoxen Lage wieder, gemäß dem Spinozistischen Naturalismus der Materie eigene Bildungskraft zuzuschreiben, dies jedoch nur über den Humeschen Geistbegriff kann.[333] Insofern also beim Zusammentreffen Denken stattfindet, kann Whitehead Teleologie – als Zeichen einer Seele der Dinge – nun auch für alle Dinge behaupten, die zusammenstoßen können. Dieses Denken macht es möglich, dass Objekte die mechanische Ordnung ihrer Wechselwirkungen durchbrechen und zielgerichtet handeln[334] – wie zum Beispiel sich selbst zu organisieren. Auf diesem Weg versucht Whitehead nun mit dem Begriff der Appetition einen zielgerichteten Hunger nach Neuem einzuführen[335] und damit eine Lebendigkeit zu postulieren, die sich nicht im Widerstand gegen den Tod erschöpft. Aber auch dieser Versuch über den Panpsychismus zur Teleologie[336] zu kommen, verbleibt im Kantischen Bild des Denkens, insofern es ja gerade Kant ist, der das Organische als jene lebendigen Lebewesen auszeichnet, die der allgegenwärtigen mechanischen Ordnung eine organische Zweckmäßigkeit hinzufügen. Damit führt eine direkte Linie von Kant – der Blumenbach für den Bildungstrieb dankt – über die kritischen Vitalisten wie Driesch und Bergson, die die Formel ‚Physik+X‘ ergründeten zu Whitehead und damit auch Shaviro. Wieder ist alles organisch oder nichts.
Die Thesen, dass alles eine Form von Spontanität besitzt oder dass alles beseelt ist, bringt uns nicht weiter an das Leben heran, das zwischen dem Kantischen Leben steht und dieses übersteigt. Bereits sprachlich deutet sich diese Einschränkung an, insofern Bennett, wie auch DeLanda Begriffe wie inorganic life, material vitality, non-organic vitality, metallic vitality und impersonal vitality vollkommen synonym verwenden und damit die Dimensionen und Möglichkeiten eines anorganischen Lebens jenseits von anorganischen Materialien fallen lassen. Auch die Neo-Vitalisten verbleiben im Kantischen Bild des Denkens, das gezielt – in Aristotelischer Tradition – fragt welche Art von Körpern lebendig ist. Nur die Antwort ist anders als die Kantische – die Frage jedoch bleibt die Gleiche. Russels Verwirrung, die Eigenschaften – selbst das Schöne und Lustige an ihnen – gehörten den Dingen selbst[337], trägt sich im alleinigen Sprechen über Körper und ihre Kräfte weiter. Es sind jedoch die Felder, nicht die Körper, nicht die Dinge und ihre Eigenschaften, sondern die Landschaften, nicht die Gegenstände, sondern ihre Genese, die das Herzstück von Deleuze Ontologie bilden.
Deleuzianische Kreuzungen
Diese Vagheiten finden sich jedoch auch schon bei Deleuze, der vom anorganischen Leben sowohl im Diagramm als auch im Metall spricht.[338] Die Frage, wie sich das anorganische Leben zeigt, wurde von Bennett mit einer Spontanität der anorganischen Materialien und von Shaviro mit einer besonderen Art von Teleologie beantwortet. Beide Antworten kann man auch bei Deleuze finden; sie sind Deleuze‘ innere Kantische Grenze des Denkens. Sie verweist auf den Weg mit Hume und Spinoza an Kant vorbei, der bei Deleuze nicht selten in Aporien endet. Man kann diese Linie bei DeLanda jedoch genauso verfolgen, dessen Werk in großen Teilen ein Kampf mit einem einfachen Deleuzianischen Problem ist: „Man erinnere sich, dass Platon von den Materialisten sagte, sie wären intelligent, wenn sie vom Vermögen statt der Körper redeten. Umgekehrt trifft es zu, daß die Dynamisten, wenn sie intelligent sind, zunächst vom Körper reden, um das Vermögen zu denken“.[339] Mit dieser Problemstellung stoßen wir wieder auf das bereits besprochene Problem der kleinsten und infinitesimal kleinen Körper, dass wir bereits bei Harman sehen. In DeLandas Denken bilden die Körper letztlich die äußere Grenze des Erklärbaren – ohne sie kann man die Kräfte nicht erklären – die sich aber dann als innere Grenze des Denkens herausstellt. Einige Anmerkungen zu Selbstorganisation, Virtualität, Empirie und die damit zusammenhängenden Gegenstände.
Die Entdeckung der dissipativen Strukturen jenseits des thermodynamischen Gleichgewichts durch Prigogine, läutete keine neue Ära der Selbstorganisationstheorien ein, sondern setzt eine Tradition fort, die ihre naturwissenschaftlich begründeten Wurzeln bereits im 18.Jh. hat. Peirce und Whiteheads spekulative Kosmologien, die die Ordnung der Natur als tendenzielle Annährung an sich selbst organisierende Muster (bzw. Gewohnheiten) beschrieben, wie auch Hakens Theorie der Synergetik[340] sind Echos dieser Anstöße. Zyklisch bewegten sich die Selbstorganisationstheorien, die bei Peirce, Whitehead oder Schramm noch kosmologische und universale Dimension hatten, zurück zu ihren Ursprüngen; die Erklärung des organischen Lebens. Der universale Anspruch der Spekulation wird zurückgefaltet in die organischen Strukturen und Muster, deren Entstehung die einzig ernstzunehmende Frage scheint.[341] Von den „Ursuppenexperimenten“ zur selbstorganisierenden Lebensentstehung der Urey-Schule und den Theorien der Hyperzyklen der Selbstorganisation in Organismen von Eigen[342] führt eine diagrammatische Linie zu den kritischen Vitalisten und von ihnen direkt zu Kant.[343] In der entschiedenen Betonung der bildenden Kraft der Organismen verweist Kant nicht ohne Grund auf die Fähigkeit der Organismen sich selbst auf sich abzustimmen:
„Man sagt von der Natur und ihrem Vermögen in organisierten Produkten bei weitem zu wenig, wenn man dieses ein Analogon der Kunst nennt; denn da denkt man sich den Künstler (ein vernünftiges Wesen) außer ihr. Sie organisiert sich vielmehr selbst und in jeder Species ihrer organisierten Produkte.“[344]
Jede noch so kunstvolle Maschine erfährt ihre Abstimmung artifiziell – von außen – während für Kant eine natürliche Organisation aus dem Inneren kommt. Die Dinge erhalten sich selbst. Dieses Paradigma haben wir bereits untersucht. Entscheidend für die neuen Variationen auf das alte Thema ist nun aber, dass diese Fähigkeit der Selbstorganisation, die Kant für „unerforschlich“ hielt, jetzt selbst zum Gegenstand der Befragung wird.[345] Kant und Hume waren beide vor dieser Frage und dem sich auftuenden Abgrund des infiniten Regresses zurückgewichen. Hume schweigt; Skepsis,[346] Kant weicht aus; Gottesgericht.[347]
DeLanda = Kant : Hume. Kantische Selbstorganisation ohne den transzendenten Ordner, der Gericht über die Spezies hält. Dennoch bleibt die Frage, wer das Selbst der Selbstorganisation ist bestehen. Wenn die Frage auf den ersten Blick als falsch gestellt erscheint, weil das Selbst das prozessual Hervorgebrachte der Organisation selbst ist, dann entbindet dies noch nicht von der methodischen Fragestellung, die wir schon wiederholt stellten; nämlich wie philosophisch für die selbstorganisierenden Kräfte gebürgt werden kann. Ist die Selbstorganisation die Organisation von Körpern, die sich manifestieren oder ist es die Wirkung eines Kräftefeldes, dessen Organisation gelegentlich, aber nicht notwendig in Körpern stattfindet. Bei DeLanda finden sich beide Antworten gleichermaßen. In seinem früheren Werk Intensive Science and Virtual Philosophy liegt der Impetus sehr viel stärker auf dem kontinuierlichen Feld der Virtualität, dessen Aktualisierungen die Körper sind, die es bewohnen. Aufbauend auf Riemanns Mathematik schafft er eine virtuelle Topologie, die eine unendliche Varietät an Körpern hervor bringen kann, ohne jemals darin aufzugehen. Die virtuelle Topologie hängt dabei nicht von ihren Aktualisierungen ab, womit er die notwendige Mensch-Welt Beziehung unterminieren will. Die Welt ist nicht nur mehr, als ihre Aktualisierung im menschlichen Geist, sondern auch ganz und gar unabhängig von dieser. Auch wenn es sich nicht um eine Zwei-Welten-Theorie handelt, wie Harman behauptet[348], ist dabei doch der Impetus DeLandas zu erkennen, einen abgeschlossenen Virtualitätsbegriff zu konstruieren. So ersetzt er beispielweise den Gedanken der direkten Kausalität der Körper untereinander durch einen virtuellen Kausalitätsbegriff. Das aktuale Verhalten eines Vektors „will be determined not by its previous states […] but by the type of attractor itself.“[349] Die kausale Kraft der aktualen und individuierten Körper wird an die virtuelle Dimension der Attraktoren in einer Mannigfaltigkeit abgegeben. Diese Autonomie wird vor allem von der mathematischen Struktur getragen, wie der Minima und Maxima, die in den Materialien liegen und nicht von aktualen Fakten abhängen. Bedenklich wird diese extreme Position erst, wenn DeLanda zwar behauptet, dass „multiplicities should not be considered the capacity to actively interact with one another“[350] aber diese dann doch durch Echos und Resonanzen kommunizieren lässt, da die kausale Struktur sonst unerklärlich bliebe. Es scheint jedoch keine grundsätzliche Schwierigkeit zu sein, die Abgeschlossenheit der virtuellen Mannigfaltigkeiten zu öffnen, wenn man aktualisierte Körper (oder Gedanken) selbst als Elemente des Vektorfeldes sieht, die einen asymptotisch stabilen Punkt erreicht haben und die Struktur des Feldes dadurch ändern. Die Aktualisierung verändert die virtuelle Struktur. Die Dramatisierung bringt das Drama hervor.
In der Änderung des Verhaltens eines Vektors seinem Typ nach, gibt DeLanda jedoch bereits eine Antwort auf die Frage, wie sich das „Brodeln der Tiefe“[351] der Kräfte zeigt. Es zeigt sich in den Verhaltensweisen der Kräfte selbst. Jedoch findet sich wenig später eine ganz andere Antwort. Nun zeigt sich die Kraft nicht mehr selbst, sondern als Spur des morphogenetischen Prozesses am Ding. Alles, das ist, zeigt in gewisser Weise, dass es gemacht ist. So wie die Ausrichtung an der Virtualität das Problem mit sich brachte, dass die aktualen Dinge keine kausale Kraft mehr besaßen, so bringt auch der Weg hin zur Ausrichtung an den Körpern einige Probleme mit sich. Assemblage Theory markiert dabei den Weg zu einer materialistischeren Konzeption, die Materialien nicht mehr nur als topologische Gebilde, sondern als aktuale Verbindung von Dingen ernst nehmen will. An die Stelle der kontinuierlichen Mannigfaltigkeiten tritt eine endlose Reihe von Formen, die nie vollständig aktualisiert sind, jedoch an die Aktualisierungen binden. Im Zusammenführen von Bhaskars realistischer Ontologie[352] und Deleuze Idee der Assemblagen will er nun die Welt als real quantifizierte Ansammlung von Dingen beschreiben. Wie Harman legt er also wieder Wert auf die Irreduzibilität der mittleren Dimension auf die des sehr Kleinen oder Großem. Einmal konstituiert in einem morphogenetischen Prozess haben diese Dinge eine emergente Dimension, die sich nie in den jeweiligen Umständen erschöpft. Anstatt einer kontinuierlichen Virtualität unter allen Dingen, tritt nun eine heterogene virtuelle Dimension als Kehrseite der aktualen Dinge. Diese Bewegung von einem homogenen kontinuierlichen Virtuellen zu einem quantifizierten heterogenen zeigt DeLandas Probleme mit dem ontologischen Status des Virtuellen als Grundthema seiner Arbeiten. In seiner Unterscheidung von „Properties“ (aktual) und „Capacities“ drückt sich dies besonders deutlich aus:
„Let’s use a knife as an example. Its properties include its length, weight and sharpness. These properties characterize the more or less enduring states of the knife and are therefore always actual: at any one point in time a knife is either sharp or blunt. A sharp knife, on the other hand, also has capacities, like its capacity to cut. Unlike sharpness, the capacity to cut need not be actual, if the knife is not presently cutting something, and may never become actual if the knife is never used.”[353]
Obwohl er versucht, das Virtuelle als noch offenen Raum zu charakterisieren, der von den aktualen Zuständen abhängt, sich jedoch nicht in diesen erschöpft, scheint die Trennung zwischen diesen beiden Ebene eher Aristotelisch als Deleuzianisch motiviert.[354] Harmans Plutoniumstab in der Wüste sucht auch DeLanda heim. Doch heißt eine Eigenschaft haben nicht schon in eine Mannigfaltigkeit eingelassen sein? Bedeutet die Schärfe eines Messers nicht, etwas schneiden zu können – oder eben die Fähigkeit eines Körpers einen inkorporalen Effekt hervorzubringen. DeLanda versucht sowohl das Aktuale wie auch das Virtuelle an den Körper „Messer“ zu binden, dass seine Eigenschaften und Möglichkeiten gerade außer sich hat. Das Gewicht ist bereits Interaktion mit der Gravitation, die Masse bereits Ergebnis der Interaktion mit dem Higgsfeld. Scharfsein bedeutet schneiden können – keine Rockwell-Messung wäre ohne wirkliches Schneiden möglich. Schneiden bedeutet etwas zu werden, das schneiden kann, weil es scharf wird. Mehr noch als nur die Bindung des Virtuellen an die Dinge, erscheint bei DeLanda – erster Heiliger des neuen Materialismus – der ontologische Status des Virtuellen an sich als problematisch. Wie wir bereits im Beispiel des Silikonplaneten gesehen haben, geschieht die Differenzierung der Materialien durch die Bifurkationen und Singularitäten, die bereits virtuell da sind, oder existieren. Dem Deleuze’schen Credo folgend: „Das Virtuelle steht nicht dem Realen, sondern bloß dem Aktuellen gegenüber. Das Virtuelle besitzt volle Realität, als Virtuelles.“[355] versucht DeLanda dem Virtuellen eine eigene Existenz zuzuschreiben. Dabei beachtet er nicht, dass die Realität der Singularitäten keineswegs notwendig ihre Existenz in der gleichen Weise wie das Aktuale impliziert. Die Philosophie, die Erinnerung[356], die Intensität[357], das Problem[358] – sie alle existieren nicht in der gleichen Weise, wie das Aktuale. Sie sind nicht deckungsgleich mit den Begriffen, den Bildern, den ausgedehnten Körpern oder den Lösungen, die existieren. Anstatt zu existieren, insistieren sie.[359] Wenn die Singularitäten existieren, dann den infinitesimal kurzen Moment, indem sie wirken und aktualisiert werden. Das Wasser verdampft bei 100 °C[360] – ist das Wasser flüssig, existieren die Singularitäten nicht, ist es Dampf, sind sie schon wieder verschwunden. Ein Ereignis ist immer zu früh oder immer zu spät – es ist ungleichzeitig. Insofern also die virtuellen Strukturen „existieren“, dann nur als Aktualisierungen, was sie ihrer Universalität beraubt, die DeLanda ihnen gerne zusprechen würde.[361] Sie sind in ihrer Existenz notwendig regional. Durch diese ontologische Differenz wird es möglich, der Deleuzeschen Forderung nachzukommen, die Intensität getrennt von der Extensität betrachten zu können.[362]
Auch wenn DeLanda die mathematisch-philosophischen Werkzeuge bereitstellt, besinnt er sich im letzten Moment doch auf die Materialien und Körper, die er nicht unterlaufen will. DeLanda wie Duns Scotus – halbe Immanenz. In Gegensatz dazu finden wir bei Harman eine Vitalität der Dinge, die alles organisch macht, bei Bennett eine Umkehr Kants, die uns zu Kant zurückbringt, bei Bryant die Legitimierung der vereinnahmenden Prozesse der Organismen, bei Shaviro einen Panpsychismus, der die Grenze zwischen Organisch und Anorganisch auflöst und die Zone des anorganischen Lebens damit verdeckt. Die Entdeckung des anorganischen Lebens macht es zuerst nötig, sich von der Kantischen Doktrin eines Aristotelischen Somatismus zu befreien, dem all diese Autoren, die sich auf Deleuze Idee des anorganischen Lebens berufen, noch anhängen. Es geht nicht darum, welche Körper organisch und welche anorganisch sind und welche subsequent lebendig oder tot sind, sondern um die Freilegung eines Lebens, das sich dem Organischen nicht beugt und gerade zwischen den Dingen, zwischen den Zellen und zwischen den Strukturen zu finden ist.
Das anorganische Leben ist nicht das Leben des Anorganischen.
Kapitel III – Anorganisch Werden
- Freuds Todestrieb
- Einleitung
„Der Organismus ist nur ein Faktum; im Verhältnis zum Begehren, das sein Recht fordert, ist er eher langweilig.“[363]
Keiner hat die Inversion des Lebens so weit getrieben wie Freud. Man hat seine Beziehung zum Tod umgekehrt – wie in Batailles Festen der Verschwendung[364] – oder es sogar gewagt den Tod wegzudiskutieren, aber Freud treibt dies viel weiter, wenn er den Tod ins Innere des Lebens verlegt als dessen Motor und geheime Entelechie. Das Leben ist nunmehr eine Falte des Todes, nur ein Umweg auf der unvermeidlichen Rückkehr zum Leblosen, die sich in der dämonischen Kraft der Wiederholung des Ursprungs im Unbelebten zeigt. Eben an dieser Kraft, dieser seltsam destabilisierenden Macht der Wiederholung wie Freud sie als Todestrieb beschreibt, ist Deleuze in seiner Aufnahme und Umwandlung Freuds in Differenz und Wiederholung interessiert. Er wird die Struktur des Freudschen Modells beibehalten, jedoch alles was sich in diesem Modell bewegt so weit pervertieren, dass sich die Wiederholung selbst, die Freud beschreibt, verändert; sich von der materiellen Wiederholung zu einer differenziellen wandelt und mit ihr die Rückkehr ins spannungslose Anorganische ins anorganische Leben verkehrt. Deleuze wird Freud mit Nietzsche von hinten nehmen; das Kind ist in der Tat monströs, übermenschlich und verrückt.
Diesseits des Lustprinzips
Man wird erkennen müssen, dass Freuds Antrieb Jenseits des Lustprinzips zu gehen nicht in der Philosophie, die der Psychoanalyse zugrunde lag, noch in der Theorie der Analyse selbst lag, sondern in einer Art von Praxis, die die Philosophie weder deduzieren noch vorhersehen konnte – ein nicht-philosophischer Anfang[365], der sich doch nicht von ihr trennen lässt. Freud sieht sich durch seine Praxis als Analytiker, aber auch als Beobachter der chaotischen Geschehnisse des zerfallenden Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Umkehr seiner Theorie bewogen; es ist seine Arbeit mit den Überlebenden des Krieges, mit ihren Traumata und Alpträumen, die beginnen seinen Glauben an die Universalität des Lustprinzips zu erschüttern.[366] Ein Prinzip, welches den zwei scheinbar verschiedenen Formen der Wiederholung nicht mehr gerecht wird. Eine Art schien sich mühelos unter das Lustprinzip subsumieren zu lassen, die andere dämonische Wiederholung allerdings nicht. Dabei bezeichnet das Lustprinzip vielmehr einen Gemeinplatz der Philosophie im außermoralischen Sinne – dass wir immer nach Lust, bzw. nach Befriedigung streben in unseren Handlungen – als eine gewagte Position. Ebenso Freuds Interpretation der Lust. Ständig ist die Psyche Erregungen ausgesetzt, von außen wie von Innen – von der Hitze der Sonne, zu Interaktionen mit anderen zu den Fantasien und Trieben – immer haben die Erregungen das Potential die Psyche zu destabilisieren. Werden sie zu stark, zu intensiv bedrohen sie das Ego in seiner inneren Konsistenz. Man droht zu zerbrechen. Kann der psychische Apparat diese Intensitäten nicht mehr ausreichend binden, wirken sie als Traumata (in verschiedenen Graden) und Schocks, die vom Bewusstsein als „Unlust“[367] interpretiert werden. In seiner Integrität bedroht versucht das Bewusstsein diese für es verhängnisvollen Impulse zu minimieren, und die übrige Energie abzuleiten oder zu verdrängen. Eben jene Entspannung der Psyche in der die Energien auf das vom psychischen Apparat verwertbare Niveau gesenkt werden, nennt Freud Lust. Freud versichert genauer – angelehnt an Fechner – dass das Lustprinzip also „ein Bestreben des seelischen Apparates sei, die in ihm vorhandene Quantität von Erregung möglich niedrig oder wenigstens konstant zu halten.“[368]. Nicht die Energie im System wird Null, sondern die interne Differenz der Intensitäten, soll minimiert werden. Homöostase ist vollkommene Lust – der Organismus schlechthin.
Man muss den Raum ermessen, in denen dieser Drang zur Homöostase auch wirklich Triebfeder des Bewusstseins ist. Denn selbst der Aufschub der Lust kann – nicht in synchroner aber in diachroner Perspektive – als Ausdruck des Lustprinzips verstanden werden. Unter Einfluss des Selbsterhaltungstriebes löst das Realitätsprinzip das Lustprinzip temporär ab – das Trinken beruhigt, man kann sich mit dem Trinken einen organlosen Körper schaffen oder eine Todeslinie. Bevor die Lust den Organismus zerstört, weil er nur nach der Homöostase sucht, muss es die Unlust in Kauf nehmen, um zu überleben.[369] Auch Spinoza schrieb diesen Aufschub schon den Affektionen zu[370] – und auch Deleuze ist er nicht unbekannt. Auf lange Sicht, die die Zukunft in die Gegenwart einrollt, führt der Verzicht zu einem größeren Lustgewinn oder erhält gar überhaupt dessen materille Basis. Aber auch das Kind, das seine Spule fortwirft, agiert dem Lustprinzip entsprechend. Das „Fort“ des Wurfes – der Verzicht auf das Spielzeug, das Verschwinden – macht erst die Lust, die Entspannung des „Da“ möglich. Erst wenn das Kind die Spule häufiger wegwirft als es sie zurückholt, muss Freud seine Deutungskunst anwenden. Das Kind, in einer hohen kulturellen Leistung, wendet seine passive Opferrolle, wenn ihn seine Mutter zu Hause zurück lässt, in eine aktive der Rache gegenüber der Spule. Projektion der Rache gegen die Mutter. Das Kind geht zum Arzt, ihm wird in den Hals geschaut. Später wird er das Szenario mit seinen Freunden nachspielen und ihnen das gleiche Unbehagen antun. Von der passiven leidenden wechselt das Kind in die aktive mächtige Rolle, die Energie wird gebunden; der Apparat beruhigt. Man wiederholt die Situationen des Traumas, um die Rolle zu wechseln, von der intensiven Gefährdung des Egos zu dessen narzisstischer Konstitution.
Wie viel von dieser heilenden Art der Wiederholung abhängt, lässt sich nur in der Praxis der Psychoanalyse ermessen. Nicht zuletzt besteht sie in einer Wiederholung, die sich selbst nicht repräsentieren lässt, aber zur Repräsentation eines nicht repräsentierten Inhalts dient. Freuds eigene Bestimmung der Psychoanalyse als „Deutungskunst“[371] ist in diesem Sinne selbst noch zu bescheiden, sind die Deutungen doch nur das Mittel die Wiederstände zu lösen, die das Bewusstsein gegen das Ausleben der unterdrückten Inhalte aufgebaut hat, um Unlust zu vermeiden.[372] Die Methode ist gleichzeitig deskriptiv, sie versucht die Lücken der Erinnerung zu schließen und zu deuten, aber vor allem dynamisch, indem sie die Verdrängungsmechanismen außer Kraft setzt. Sie besteht eben nicht, wie Freud selbst bemerkt[373], im Erinnern einer Episode, denn es gibt überhaupt keine Erinnerung, da die vergangenen traumatischen Inhalte nie Gegenwart waren. Sie waren nie präsent, weil das Bewusstsein sie als destabilisierende Kraft verdrängte ohne dass sie als Erinnerung eine Spur hinterließen. Man erlebt das Paradox in der Analyse, „daß etwas »erinnert« wird, was nie »vergessen« werden konnte, weil es zu keiner Zeit gemerkt wurde, niemals bewußt war“.[374] Diese Erinnerung, die keine Erinnerung ist es, die Freud besonders interessiert, gerade, weil sie selbst vom Patienten nicht erfahren wird. Man erinnert sich nicht, gegen die Eltern trotz oder gar Ressentiment empfunden zu haben, aber man benimmt sich trotzig gegenüber dem Arzt, während man sich an die erinnert. Nicht eine Erinnerung kommt als Spur auf, sondern sie wird als Tat ausgeführt, während der Ausführende kein Bewusstsein von der Wiederholung seines Trotzes hat. Die Wiederholung verstellt sich, und heilt, wenn sie erkannt wird.
Doch dann sind da die Heimkehrer aus dem Krieg. Sieh haben geschossen, wurden angeschossen und selbst wenn sie unversehrt zurückkamen, waren die gebrochen. Sie hatten keine neuen Erfahrungen gemacht, sondern nur zerstört. Auch wenn Bachmann in Unter Mördern und Irren den Kriegsheimkehrer Haderer sagen lässt: „Ich möchte nichts missen, diese Jahre nicht, diese Erfahrungen nicht“[375], dann ist das keine Koketterie, sondern der Satz eines Mannes, der so viel im Krieg verloren hat, dass das Einzige, das ihm noch bleibt, seine Gebrochenheit ist, ohne die er nicht mehr leben kann. „[N]ie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber“[376] schreibt Benjamin und umkreist damit die Lücke an Erfahrung, die der Krieg war und den die Überlebenden in ihren Neurosen auslebten. Diese Kriegsneurosen, deren rein physische Ursache Freud bald verwarf, schaffen Risse im Lustprinzip, reichen aber noch nicht es zu erschüttern. Es ist nicht nur der wiederkehrende Schrecken, nicht die aufkommenden Ängste der Heimgekehrten, sondern ihre Träume, die Freud so verunsichern. War doch gerade der Traum nicht nur Lokus der Wunscherfüllung, sondern damit auch Analyseweg des Unbewussten gewesen, so erzeugt er nun die Abgründe wieder und wieder, denen die Soldaten einmal begegneten und immer wieder begegnen werden. Und doch unternimmt Freud zunächst den Versuch das Lustprinzip als Primat zu stabilisieren, indem er es in ein Labyrinth verwandelt. „[W]ir müßten der rätselhaften masochistischen Tendenzen des Ich gedenken“[377] bleibt der ominöse Vorschlag Freuds, um sowohl die Traumfunktion und das Lustprinzip abzudichten. In jeder darauf aufbauenden Analyse wird man sich jedoch im Irrgarten dieses paradoxen Prinzips verlaufen; man erlebt die Schrecken immer wieder, weil man die Unlust begehrt, aber nur weil die Unlust zur Lust wird, und nur weil diese Lust heimlich Prinzip war, so das am Ende beide nicht mehr zu unterscheiden sind, weil sie sich weder in Funktion noch Inhalt unterscheiden, sondern nur im Begriff. Man will nicht das Leiden als Lust, schon gar nicht als Prinzip und damit ständig. Es gehört zu den vielen Spänen, die Freud fallen lassen wird, das Prinzip des masochistischen Ichs. An seine Stelle tritt eine viel dämonischer Kraft – der Wiederholungszwang.
Wir haben bereits die beiden Figuren kennengelernt, die Freud an den Rand, aber immer noch innerhalb des Lustprinzips ansiedelt: das verlassene Kind und den traumatisierten Soldaten, welche beide durch Auslebung ihrer Rache oder Masochismus ihre Wiederholung als Lustgewinn vollziehen können. Doch, dann wiederholt sich der Text, die Figuren treten wieder auf, alle Themen kehren wieder und verkehren sich doch ins Gegenteil. Freuds Text ist nicht nur thematisch der Wiederholung gewidmet, er ist selbst der Vollzug einer entstellenden Wiederholung – bevor der Wiederholungszwang als Begriff eingeführt wird ist er schon lange im Text an der Arbeit. Und ist nicht das schon das Schreiben selbst das Ausleben des Wiederholungszwangs? Was gerade noch innerhalb der Grenzen des Lustprinzips gefasst werden konnte, enthüllt sich bei genauerer Betrachtung als zu weit von jeder Befriedigung entfernt und verschiebt damit auch das Lustprinzip selbst. Bereits durch das Realitätsprinzip gelegentlich außer Kraft gesetzt, war es schon kaum noch Prinzip – genauso wie das Realitätsprinzip umgekehrt vom Streben nach Lust ausgesetzt werden kann[378] – sondern viel mehr eine Tendenz, ein Streben nach Lust, das ebenso leicht vom Kurs abkommen konnte, wie sein Gegenideal. Conatur statt prinzipium. Die Wiederholung der Themen kündigt jedoch bereits auch ein Jenseits der Lusttendenz an, da „der Wiederholungszwang auch solche Erlebnisse der Vergangenheit wiederbringt, die keine Lustmöglichkeit enthalten, die auch damals nicht Befriedigungen, selbst nicht von seither verdrängten Triebregungen, gewesen sein können.“[379] Wenn wir den Drang verspüren, jenen Leuten zu vertrauen, die uns enttäuschen müssen, die Projekte beginnen von denen wir wissen, dass sie scheitern müssen, nur die Spiele zu spielen, die wir nur verlieren können, wiederholen wir die Unlust, als sei sie Selbstzweck – Unlustprinzip. Das Kind wird die Spule nicht nur fortwerfen, um sich für seine Verlassenheit zu rächen, sondern es wird sich auch von anderen wegwerfen lassen. Es sucht die Verlassenheit, das Verlassen werden, und es wird den Therapeuten – so viele Jahre später – nötigen hart gegen es zu sein, die Worte harsch zu wählen und heftig zu kritisieren.[380] Es wurde zum Knecht gemacht und es will der Knecht sein – Hegel gewinnt, so oder so. Es ist nicht die Lust, die es begehrt, jemals begehrt hat, wenn es die gespürte Härte der Mutter gegen es wiederholt. Die Alpträume kehren wieder, und man wird immer entweder Schütze oder Opfer sein, doch man wechselt die Rollen nicht, man wird – so oder so – der Traumatisierte sein; die Passivität, die Machtlosigkeit und den Schrecken wieder-holen, ihn noch einmal vollziehen. Und Tankred wird Clorinde töten und wieder töten, in alle Ewigkeit, in jeder Gestalt, ohne Absicht, aber deswegen auch ohne Hoffnung.
Jenseits des Lustprinzips
Während sich in den Studien zum primären Narzissmus oder den Abhandlungen zum Unbehagen in der Kultur[381] das verhängnisvolle Schicksal, oder der Hang zur Unlust noch als sekundäre Phänomene herausstellen, die innerhalb der Grenzen des Lustprinzips agierten, ist der Wiederholungszwang gänzlich nicht deduzibel aus dem Lustprinzip – er unterwirft sich nicht dem Lustprinzip, scheint ihm gar ganz zu wiedersprechen. Freud wird diese Bewegung noch weiter drehen – vielleicht zu weit – wenn der sagt: „Das Lustprinzip scheint geradezu im Dienste des Todestriebes [Wiederholungszwang] zu stehen […]“[382]. Diese spekulative Deutung, die das Lustprinzip umkehren will, hält doch gerade noch an dessen Kern fest; einer geheimen Teleologie, gemäß derer man eines der Prinzipien als Effekt des Telos des anderen deuten kann. Man strebt nach Lust und zieht die Unlust in den Bann oder man will die Destruktion und benutzt die Lust zur Zerstörung. Oder man hierarchisiert anders, durch den Mythos der Arché, in dem der Wiederholungszwang als „ursprünglicher, elementarer, triebhafter als das von ihm zur Seite geschobene“[383] erscheint. Aber eben dieses Zusammentreffen von Todestrieb/Wiederholungszwang und Libido interessiert Freud in den späteren Masochismus-Aufsätzen. Keinesfalls nimmt die dämonische Wiederholung die Lust einfach in sich auf oder beherrscht, sondern wird in diesem Zusammentreffen selbst etwas anderes. Sie wandelt sich, verkleidet sich, ohne einen reinen latenten Inhalt auszudrücken, sondern mischt sich mit dem Lustprinzip. Man trifft nie auf etwas, ohne sich zu wandeln – man ist nie einfach nur Herr oder Knecht. Hegel verliert, so oder so. Thanatos und Eros haben selbstsame Kinder.
Es ist gerade Derrida, der die Über-Drehung der Bewegung erkennt, mehr in der Struktur des Textes selbst, als in dessen Inhalt:
„Das Vorgehen des Textes selbst ist teuflisch. Er nimmt das Gehen, hört nicht auf zu gehen, ohne voranzubringen, entwirft regelmäßig einen neuen Schritt, ohne einen Daumenbreit Terrain zu gewinnen. Hinkender Teufel, wie alles, was das Lustprinzip überschreitet, ohne je schließen zu lassen auf das Übersteigen.“[384]
Die Wiederholung vollzieht sich nicht vollkommen jenseits der Lust, es übersteigt das Lustprinzip nicht als ein anderes oder gar ein Antagonist, weil jede Konstellation, die sie gegeneinander aufstellen will, sie bereits notwendig mischt. Die schleppende Bewegung ist keinesfalls andachtsvolle Geste, sondern selbst das Zerren der Wiederholung im Text. Man kann sich von dieser hinkenden Bewegung nur auf eine Art befreien, nur auf eine Art wieder Schwung aufnehmen, und Freud benennt sie: die Spekulation.
Im weiten Schwung mit dem Freud jetzt argumentieren wird, zeigt sich die Problematik der Repräsentation der Wiederholung erneut. Sie selbst wird immer sub-repräsentativ bleiben, sich der eigenen Wieder-holbarkeit so lange entziehen, bis sie sich verkleidet hat und anders geworden ist. Man bekommt sie nie durch Empirie, Reflexion oder Betrachtung zu fassen, man kann sie nur durch Spekulation aufweisen. Diese beginnt mit der Grundannahme der Psychoanalyse, dass das Bewusstsein nicht das universale Attribut zu allen seelischen Vorgängen sein, sondern vielmehr eine Leistung oder Funktion eines anderen Systems. „Da das Bewußtsein im wesentlichen Wahrnehmungen und Erregungen liefert“[385], die sowohl von außen wie aus dem Inneren stammen, ist es die Grenze zwischen der Exteriorität der Welt und der Interiorität des psychischen Apparats. Dies ist keineswegs eine ideale oder abstrakte Analogie, sondern findet sein physisches und materielles Korrelat in der Hirnanatomie, die den „Sitz“[386] des Bewusstseins in Hirnrinde verlegt. Es ist genau dieser medizinisch unspektakuläre Umstand den Freud so interessiert; dass die Natur das wertvolle Bewusstsein nicht tiefer vergraben hat im Gehirn, wo es sicherer gegen äußere – vor allem schon mechanischen – Einflüssen gewesen wäre. Allein, scheint dieser Fakt jedoch nur von anatomischem, vielleicht evolutionärbiologischem Interesse. Das Entscheidende ist seine Kombination mit einem scheinbar unzusammenhängenden Gegenstand, der Erinnerungsspur. Anders als in den anderen Systemen des psychischen Apparats stellen die Erregungen im Bewusstsein keine dauerhafte Veränderung dar, sondern „verpuffen“[387] gleichsam im Bewusstwerden – die Erinnerungsspur bildet sich nicht im Bewusstsein. Aus der Kontraktion dieser beiden verwunderlichen Tatsachen oder Sonderrollen des Bewusstseins ergibt sich Freud nächster Schritt, der ihn aus der funktionalen Analyse – die nur zur Aufdeckung der Probleme führte – ins Feld der Geschichte und Entwicklung bringt. Freud betritt das unsichere Terrain der Genese des Bewusstseins.[388]
Der flüssige Verlauf der Untersuchung und der Textfluss – Freud lässt nicht einmal einen größeren Absatz zwischen den verschiedenen Ebenen frei – verschleiern die Größe des Bruchs und zugleich die gedankliche Arbeit, die im Zwischenraum geschehen ist. Freud wählt als Ausgangspunkt für seine Betrachtung ein „undifferenziertes Bläschen reizbarer Substanz“[389] als vereinfachteste Form des Organismus. Die minimale Einheit, die zur Differenzierung und damit zur Bildung eines Bewusstseins fähig ist, ist damit nicht nur bereits organisch und komplex, sondern hat auch schon eine sphärische Form, die ein Innen und Außen bereits impliziert, anstatt es erst zu bilden. Freud treibt das Denken bis zu dem Punkt, an dem es die erste Möglichkeit zur Repräsentation findet, ein Gebilde, das verschieden genug ist, um das Denken zu bereichern, aber ähnlich genug, um es nicht ins Unendliche treiben zu müssen.[390] Von diesem Punkt aus versucht Freud die Verbindung zwischen der Außenhülle des Bläschens und der Hirnrinde herzustellen. Die modifizierbare Außenseite des Bläschens wird ständig von den Erregungen durchdrungen sein, bis zu einer gewissen Tiefe dringen Sonnenstrahlen, Kälte, Stöße und Winde durch die poröse Außenschicht in das Bläschen ein. Die Intensität wird beim Durchlaufen der Substanz immer weiter abnehmen, so dass die äußeren Schichten sich bedeutend stärker modifiziert werden als die inneren – bis diese einen Grad erreichen, an dem sie unempfindlich werden, da sie ihre Plastizität verlieren. Insofern nun keine dauerhafte Veränderung mehr stattfinden kann, hat Freud durch einen Analogieschluss das gefunden, was er dem Bewusstsein gleichsetzen kann. Das Bläschen kollabiert mit dem psychischen Apparat, beziehungsweise die Rinde des Bläschens mit der Hirnrinde. Die Bilder die Freud aufbaut – die exponierte Lage der Hirnrinde, das Bewusstsein als Grenze und die Außenschicht des Bläschens teilen sich eine spatiale Dimension, doch reicht dies noch nicht, um Freuds Analogie zu stützen. Er selbst verweist auf die Erkenntnisse der Embryologie, die zeigen „daß das Zentralnervensystem aus dem Ektoderm hervorgeht“[391] und somit auch die auch die Hirnrinde als Erbe einer primitiven Struktur gesehen werden könnte. Mit dieser embryologischen Argumentation kann Freud jedoch lediglich die funktionale und strukturelle Ähnlichkeit erklären, nicht jedoch, wieso sich das Vererbte nicht – beispielsweise durch Selektion – in veränderter Form wiederholt, sprich wieso nicht im Laufe der Entwicklung die äußere Schicht weiter nach innen gewandert ist. Hierfür bedient sich Freud der Theorie der Rekapitulation der Entwicklungsgeschichte, welche die Ontogenese stets als durchlaufen der Phylogenese betrachtet. In diesem Sinne wiederholt auch das Gehirn die Entwicklungsgeschichte noch einmal, und bildet damit auch die Hirnrinde als Wiederholung der primitiveren Form aus. Diese Theorie wird nicht nur von heutigen Embryologen aus biologischer Sicht verworfen[392], sondern wird auch von Deleuze aus philosophischer Sicht angegriffen. Alles war der Organismus in seiner Entwicklung sein kann ist eine Wiederholung der Vergangenheit, welche selbst das Schicksal des Organismus bildet. Die Ausfaltung des Lebens bliebe in den Implikationen der Vergangenheit gefangen – die Vergangenheit wäre die Gegenwart ohne wirkliche Zukunft. Deleuze wird diesen Schicksalsbann durch einen mächtigeren brechen; die reine, leere Form der Zeit.
An diesem Punkt des Arguments dient die These jedoch (noch) der Stützung der zweiten Konsequenz aus der Entwicklungsgeschichte; dass das anorganische nichts dem Leben Äußerliches ist, sondern es sogar ermöglicht. Die anorganischen Schichten der toten Außenhülle bilden einen „Reizschutz“[393] gegenüber der Umwelt, die durch ihre beständigen Erregungen droht den Organismus zu zerstören. Das Leben des Inneren wird durch den Tod des Äußeren verbürgt, welcher sich somit als konstitutiv oder gar transzendental für das Leben erweist. Ohne Tod kein Leben – nicht als Heideggersche Endlichkeit, sondern als invertierte Arendtsche Natalität. Welcher Tod das ist, wissen wir noch nicht. Man muss aber in der Stringenz der Argumentation auf die nahezu existenzielle Situation des Bläschens hinweisen, welches seinen Reizschutz mechanisch entwickelt, ohne jede Form von Teleologie und Absicht. Als bilde sich das Bewusstsein als letzte Instanz eines Automaten aus, der es auswirft, vielleicht als Nebenprodukt ohne es gewollt zu haben. Anima minima[394], wie Lyotard sagt. Wenn sich die Welt ein Licht anzündet, dann zufällig – es geschieht. Quod.[395]
Invertiert verwendet Freud diese Analogie nun auch auf die Erregungen aus dem Inneren an – die Bilder und Phantasien, die uns verfolgen, die Regungen des Magens, das Begehren nach der Zerstörung. Werden sie zu intensiv, beginnen sie das Ego zu bedrohen; man wird von seinen Phantasmen verschlungen. Als Schutz beginnt der psychische Apparat diese, vom Bewusstsein als Unlust wahrgenommenen, inneren Erregungen wie äußerliche zu behandeln und wird gegen sie die gleichen Schutzmechanismen anwenden, wie gegen die äußeren. Ursprung der Projektion. Unsere Haut ist dick, auch wenn die porös ist und auch unser Schädel ist hart, doch die Mechaniken des inneren Schutzes sind schwach; nicht zuletzt deswegen, können diese inneren Erregung für viele der Neurosen verantwortlich gemacht werden. Und immer noch befinden wir uns innerhalb der Ökonomie des Lustprinzips. Immer noch finden wir die Mechanismen des Schutzes wieder und immer noch bewegen wir uns mit der Spekulation im Kreis – ein Stück vom Lustprinzip weg und wieder auf es zu. Teuflisch; Derrida gewinnt, so oder so. Und immer noch bleiben die Blicke der Soldaten unerwidert, die langsam vom ihren Alpträumen verzehrt werden, immer noch rächt sich das Kind an seinen Eltern. Immer noch ist der Zwang noch nicht dämonisch, sondern erotisch. Und immer noch sagen wir: ‚schauen sie doch, das ist so und so immer noch das Lustprinzip‘.
- Diesseits des Todestriebs
Und dann beginnt der wirkliche argumentative Rutsch weg von der Logik der Negation (Entweder Lust oder Un-Lust) hin zum Dualismus. Er wird alles mit dich reißen in Freuds argumentativen Gang:
„Ein Trieb wäre also ein dem belebten Organischen innerwohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen das Belebte unter dem Einflüsse äußerer Störungskräfte aufgeben mußte, eine Art von organischer Elastizität, oder wenn man so will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben.“[396]
Es ist nicht ein Trieb unter anderen, den Freud hier beschreiben will, es ist auch nicht irgendeine Hierarchie aus Trieben, die Freud anstrebt zu beschreiben, sondern es ist der „Charakter der Triebe“[397] selbst. Die Ausrichtung der gesamten Triebtheorie hängt also an dieser Spekulation. Insofern ist die Verwendung von Todestrieb und Todestrieben nicht das Problem, sondern eher schon immer eine spezifische Antwort; eine der Konfiguration und Konstellation, anstatt des Inhalts und der Bedeutung. Inwiefern die Triebe sich in einem Charakter ausdrücken hängt von ihrer gemeinsamen Bewegung mehr ab als von ihrer inneren Ähnlichkeit – nicht Logos sondern Nomos der Triebe. So kann man Deleuze Aufschlüsselung der kannibalischen Destruktionstriebe und der spekulativen Todesinstinkte lesen, die beide durch den Thanatos/Zwang als Bewegung der Verbindung beider bestimmt sind.[398]
Die Rückkehr ins Anorganische, als Entspannung, dem jeder Organismus zustrebt, kennzeichnet als Zug oder Trieb zum Tod alles Leben; dessen „konservative Natur“. Nicht weil sie sich erhalten wollen innerhalb einer Umwelt, sondern weil sich die Organismen ohne die Umwelt konstituieren wollen, sind sie konservativ. Ohne das ihnen Äußere – die Umwelt – hätten sie sich nie aus sich selbst heraus entwickelt und zu leben begonnen. Man mag – wie Ansell-Pearson[399] – einwenden, dass diese Hypothese auf einem strengen Dualismus zwischen Organismus und Umwelt beruht, zwischen dem Streben nach Ruhe und der beständigen Störung. Selbst, wenn man damit Recht hat, verfehlt man damit Freuds einfache, aber aufschlussreiche Adäquation, dass Leben sich erst durch den Kontakt mit dem Außen ins Werk setzt, welches selbst in den inneren Kern des Dings gefaltet wird. „Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon.“[400] Das Leben vollzieht sich in der Ausdehnung als Affektion[401] – da, wo der Körper an seine Grenzen stößt und diese überschreitet. Man wird sagen müssen, dass die Haut das Tiefste ist – wie Valéry es einst tat – und damit bereits das Außen zum Innen gemacht haben. Aber eben in diesen minimalen Wirkungen des Außen, den winzigen Zusammentreffen mit den Intensitäten geschieht das „Erwachen“[402] wie Lyotard es einst nannte – das Aufspannen der Seele, durch die Affektion, die keinen von uns vollziehen und keiner von uns nicht wollen kann. Erst wenn wir diesen Umstand in Freud gesehen haben, müssen wir fragen, wieso das
Wir sind schon immer erweckt, ohne ein zeitliches vorher – Körper sind nur, insofern sie affiziert sind, sie sind kristalline Psyche. „Es gibt nur Körper in actu, und jeder Körper ist Psyche“[403], kein Körper ist je unbelebt, wenn er durch die Affektion zum Leben erweckt wird. Es ist natürlich einerseits die Grundannahme Freuds – und der beginnt erst sie zu hinterfragen – dass nur organischen Materialien dazu in der Lage sind, jene speziellen Erlebnisse haben können, die die Psyche erst konstituieren; dass es bestimmte Dinge sind, die belebt werden können, andere nicht. Doch hier lässt sich Freud mühelos erweitern, Nancy hat das gezeigt. Die Frage der Rückkehr ins Leblose ist eine andere, jenseits des Dualismus und der Adäquation von Lebendigen mit dem Organischen. Es ist die Frage der Zeit, oder genauer einer Zeit, die Freud evoziert und postuliert, als focus imaginarius vielleicht, doch nicht ohne Konsequenz. Die Zeit, vor dem ersten Bläschen, dass durch den Bund mit dem Tod überleben konnte, jene Zeit, in der keine animierten Körper die Erde bevölkerten, konstituieren diese Zeit der vollkommenen Entropie. Eben hier treffen wir auf die große Differenz zwischen Freud und Spinoza, dem Gedanken der Immanenz, dass alle Körper überhaupt nur in actu durch Affektionen sind und dem Freudschen Gedanken der Körper, die beseelt werden und sich aus ihrem Urzustand bewegen. Sie sind die beiden Linsen, in denen sich das Erbe Aristoteles bricht; man beginnt bei der Potentialität und arbeitet sich zur Aktualität vor, das heißt von den potentiell belebten Körpern zu den Lebenden oder man beginnt beim actus purus, das heißt beim lebendigen Körper. Freud spekuliert auf die Zeit der reinen Potentialität, in der noch nichts geschehen ist – seine Zuflucht.
Sie liegt in Freuds Traum einer ontologisch vorhergehenden Welt, einer Welt aus Ruhe und Bewegungslosigkeit, weder kalt noch warm, sondern ohne Differenz; eine Welt, aus unendlich verstreuten Dinge, abgeschlossen wie Monaden auf einem Feld absoluter Unverbundenheit. Eine Vollstellung von Seligkeit liegt noch in dieser Welt. Der Hauch der Kontemplation Schopenhauers durchzieht sie, wie ein heilendes Versprechen; „stete Abwendung vom Willen“[404], endlich Einkehren können, in die Ruhe des Gemüts. „Das Leblose war früher als das Lebende.“[405]
In differenzieller Wiederholung erscheint nun wieder die Embryologie, genauer die These von der Rekapitulation der Entwicklungsgeschichte, diesmal als Garant der biologischen Evidenz des Wiederholungszwanges. Jedes Lebewesen, so Freud, wiederholt in seiner Entwicklung, die ihm vorangegangenen Stufen. Die implizite Frage ist offensichtlich: Wieso sollte es dann nicht auch die erste Stufe, das Leblose wiederholen? Wir haben jedoch bereits gesehen, dass diese Argumentation sich auf eine Biologie stützt, die ihren Rückhalt unter den Biologen heute lange verloren hat. Gleichzeitig finden wir in der Spekulation Freuds eine Transgression der Biogenetischen Grundregeln wie Haeckel sie formulierte. Wenn er die These aufstellt: „Die Ontogenesis ist eine kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenesis, bedingt durch die physiologischen Funktionen der Vererbung (Fortpflanzung) und Anpassung (Ernährung).“[406], dann hat diese eine klare Grenze dessen, was wiederholt wird. Der Mensch mag die Wirbeltiere wiederholen – kurz Kuh, Katz und Huhn sein, vielleicht sogar Lanzettenfisch – doch die Ahnenreihe hat ein Ende mit dem Ersten der Stammesgeschichte. Man wiederholt nicht die Vorfahren aus Staub und Stein, auch wenn der Mensch selbst nur „Kontraktionen aus Wasser, Erde, Licht und Luft“[407] ist. An einer bestimmten Stelle hört die Bewegung des Denkens auf, bevor sie das Unendliche erreicht. Gerade in seiner Besprechung der Differenzen zwischen dem Anorganischen und dem Organischen, muss Haeckel notwendig einen gewissen Nullpunkt des Organischen markieren, den simpelsten Körper, der trotzdem noch als mit Werkzeugen ausgestattet und zur Ernährung fähig betrachtet werden kann; das Plasma. Unter dieser Stufe endet die genetische Linie – doch dieser Endpunkt des Denkens muss noch zu einem Anfang der Serie des Lebendigen gemacht werden. Deswegen schlägt der „Blitz des Lebendigen in die Materie“[408] ein, Spontanzeugung, und setzt das Leben ab diesem Punkt – der Arche des Lebendigen in Gang. Hegel gewinnt – so oder so, wieder und wieder. Mit der Markierung eines repräsentierbaren Anfangspunkt des Lebens, wird das Anorganischen nicht nur vom Organischen geschieden, sondern auch der genetischen Bedeutung beraubt. Organisches kann nur aus Organischem entstehen. Bei Freud gibt es keine Blitze und auch keine Spontanzeugungen, nur Erregungen und das, was von ihnen belebt wird. Die besondere Rolle, die Freud dem Anorganischen einräumt, liegt eben genau in dieser zeitlichen Rekapitulationsdimension, die das Organische nicht loslässt, sich als dessen Ursprung und Ziel immer mit durch den alle Lagen, Bewegungen und Tonalitäten des Organischen zieht. Man ist immer – wie es Lacan einmal sagt – eingeklemmt „zwischen-zwei-Toden“.[409]
Und doch geht es Freud um nichts anderes als um das Leben – auch wenn dies gerade angesichts der Argumentation paradox erscheint. Nicht der Tod, der für Freud entschieden die Dekontraktion, die absolute Entspannung des Organischen ins Anorganische ist, sondern das Leben wird das eigentliche Rätsel. Es ist eben jene Bewegung zum Tod hin, die das Leben selbst ist, die Freud interessieren. Wie sollte denn, angesichts der konservativen Triebe überhaupt Leben stattfinden? Die Antwort Freuds besteht in seinem Umweg in Bezug auf Weismann. In der Untersuchung von Einzellern hatte dieser ihre scheinbare „Unsterblichkeit“[410] aufweisen wollen und kam daraufhin zu dem Schluss, dass der Tod eine späte Entwicklung des Lebens sei. Der Tod ist ein historisches Phänomen, welches ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklungsgeschichte der Organismen auftritt.[411] Die primitiveren Einzeller, welche nur aus Keimzellen standen, kannten den Tod noch nicht. Diesen älteren Teil des Organismus attestiert Weismann auch die Unsterblichkeit innerhalb der jüngeren und komplexeren Formen. Der Körper jedoch – Soma – ist sterblich, dem Verfall notwendig unterworfen und wird vergehen. Unter günstigen Umständen ist die Keimzelle in der Lage, sich zu reproduzieren und im günstigsten Fall wieder einen sterblichen Körper auszubilden. Man kennt all die Figuren des unsterblichen Lebens, das vermeintlich in den primitiveren Keimen schlummert: das Alien aus den Phantasien Gigers und Scotts ebenso wie Okens Urschleim[412] oder das gewaltsame Potential der Mitochondrien in Hideki Senais Romanen.[413] Auch fernab von der analogischen Struktur von Keimzelle und unsterblicher Seele, die sich wieder inkarnieren kann, beruht diese Theorie auf der impliziten Annahme, dass ein Individuum durch seinen genetischen Code vollständig abgebildet sein, ohne, dass die materiellen und jeweils einzigartigen Ausprägungen wichtig wären. Das Individuum ist Wiederholung einer allgemeinen Form, die die Keimzelle birgt. Materielle Wiederholung ohne Differenz.
Diese zwei Forderungen, dass zu erklären sei, wieso es überhaupt Leben gebe und wie der Todestrieb etwas sein kann, dass dem Organischen eigen ist, wenn der Tod doch erst eine späte Entwicklung ist, bestimmen den Gang der weiteren Interpretation des Lebens Freuds. Freuds erster Schritt verringert die Distanz zwischen den beiden Ansätzen:
„Was uns hieran fesselt, ist die unerwartete Analogie mit unserer eigenen, auf so verschiedenem Wege entwickelten Auffassung. Weismann, der die lebende Substanz morphologisch betrachtet, erkennt in ihr einen Bestandteil, der dem Tode verfallen ist, das Soma, den Körper abgesehen vom Geschlechts- und Vererbungsstoff, und einen unsterblichen, eben dieses Keimplasma, welches der Erhaltung der Art, der Fortpflanzung, dient. Wir haben nicht den lebenden Stoff, sondern die in ihm tätigen Kräfte eingestellt, und sind dazu geführt worden, zwei Arten von Trieben zu unterscheiden, jene, welche das Leben zum Tod führen wollen, die anderen, die Sexualtriebe, welche immer wieder die Erneuerung des Lebens anstreben und durchsetzen. Das klingt wie ein dynamisches Korollar zu Weismann’s morphologischer Theorie.“[414]
Dieses Korollar erweist sich jedoch bei aller Nähe als invertierte Isomorphie. Gleich ist beiden, dass sie, statt Stoffen, die dynamischen Verhältnisse jener als Ausgangsbasis wählen. Sie stellen beide bestimmte Serien von Kräften und Stoffen auf, die sie korrelieren lassen in allen Graden und Variationen. Die Korrelation ist aber jeweils durch ein anderes Bindeglied gewährleistet, welche die Bewegungen der anderen Korrelation von oben bestimmt. Diese bestimmende Relation zeigt eben an, welcher Bereich im nicht empirischen verborgen liegt. Bei Weismann liegt die Unsterblichkeit der Keimzellen im beobachtbaren Bereich, insofern man ihn an einigen günstigen Zellen zeigen kann, aber nur negativ, indem man den Tod in Kauf nimmt und zeigt, wie doch etwas überlebt oder überleben kann. Freud wird nun genau diese Struktur invertieren, wenn er es zwar für erwiesen hält, dass einige Keimzellen empirisch unsterblich sein könnten, jedoch dies nicht einen nicht empirischen Trieb hin zum Tod ausschließen würde. Man müsste dafür nur die Korrelation der Reproduktion der Einzeller vom Leben auf den Tod verschieben. All die Variationen der Evolution, die Mechanismen der Selbsterhaltung und selbst die Sexualtriebe stehen dem Tod für Freud nicht gegenüber, sondern sie sind notwendige Umwege auf der sonst geraden Bahn zum Tod. Im Grunde müssen wir nur der Bahn der Rekapitulationsthese genau folgen und darauf bestehen, dass der Zug in den Tod auf der Wiederholung der Stammesgeschichte bis zum Anfang, das heißt auf dem Zustand des Anorganischen beruht. Somit verfügt aber jeder Organismus über seinen phylogenetischen Beginn, seine anorganische Arché, seinen Staub zu dem er werden will und seine Erde zu der er in einer bestimmten Weise werden muss:
„Die theoretische Bedeutung der Selbsterhaltungs-, Macht- und Geltungstriebe schrumpft, in diesem Licht gesehen, ein; es sind Partialtriebe, dazu bestimmt, den eigenen Todesweg des Organismus zu sichern und andere Möglichkeiten der Rückkehr zum Anorganischen als die immanenten fernzuhalten, aber das rätselhafte, in keinen Zusammenhang einfügbare Bestreben des Organismus, sich aller Welt zum Trotz zu behaupten, entfällt. Es erübrigt, daß der Organismus nur auf seine Weise sterben will;[415]
Das Leben ist die gewundene Straße, die unweigerlich zum Tod führt und es ist eben nur das; Leben zum Tode, der sich von keiner Lebensäußerung lösen lässt. Christliche Fingerlabyrinthe im Chartres-Typ in dessen Mitte der Tod wartet; jener Tod, der einem bestimmt ist und an den einen das Schicksal bindet. Nirwanaprinzip. Gerade hier liegt die eigentliche – und von Freud nicht bewältigte – Bemerkung Weismanns über die Natur des Lebens. Seine Herausforderung besteht genau darin zu behaupten, dass das Leben der Keimzellen ohne den immanenten Tod gedacht werden muss, weil dieser nur dem Organismus äußerlich sein kann, im Entzug der Bedingungen der Reproduktion. Freuds Spekulation implizierte gerade die Immanenz des Todes im Leben oder gar, dass das Leben dem Tod immanent sei, weil „alles Lebende aus inneren Gründen stirbt“.[416] Das Leben ist die Weise oder die Funktion des Todes, die den Organismen erlaubt auf ihre Weise zu sterben. Wieder spielt Freud hier die spekulative gegen die empirische Sicht aus, indem er darauf verweist, dass nicht die potentielle Unsterblichkeit der Keimzellen beobachtet werden kann, sondern nur das Aufkommen neuer Vitaldifferenzen, die jedoch nur verlebt werden können. Beobachtbar ist das ständige Aufflammen des Lebens, was aber kein wirkliches neues Leben einführt, sondern für Freud auch nur den Weg in den Tod verlängert. Jede neue Regung, die winzigen Ereignisse, die großen Taten, das zersprengen der Sonne, das Töten des Vaters finden alle das gleiche Ziel, die Entropie und damit die endgültige Entspannung. Leben ist die „Gesamtheit der Funktionen die dem Tod widerstehen“[417], wie Bichat es schon nannte, mit der Änderung des Telos in Richtung des eigenen schicksalhaften Todes.
Man muss auf die Bewegung achten, mit der Freud seine Gedanken als eben jene Spekulation ausweist die sie sind, aber gerade somit als Denkbewegung freisetzt und öffnet – nicht zuletzt auch für die dämonische Wiederholung durch Deleuze. Jene unvermeidliche Bindung an die Biologie, die die Zirkularität der Spekulation verhindern soll, ist es, die vielleicht am Ende den „ganze[n] künstliche[n] Bau von Hypothesen umblasen wird.“[418] Hier wurzeln das Verhängnis und die Öffnung der Freudschen Argumentation. Diese Bindung erscheint jedoch fester und gradliniger in den Variationen und Mutationen des Todestriebes in Freuds späten Schriften. Der Zug der Fische oder die Migrationsbewegung der Vogel, die an den Ort ihrer Herkunft zurückkehren sind für Freud in seiner Vorlesung Angst und Triebleben nicht nur Beispiele, sondern Formen der Äußerung der konservativen Natur alles Lebenden – vielleicht ist sogar jeder Instinkt des Tieres so zu bewerten, fragt uns Freud. Deutlich wird hier jedoch die Stellung die Freud den Trieben des Ego, welches auf dem Erhalt seiner eigenen Identität und seiner Ruhe besteht – die Umwelt und seine Erregungen sind nur Störungen des ursprünglichen Zustandes – einräumt. Dieser organische Trieb, sich gegen die Umwelt abzuschotten oder sie ganz in seine Kontrolle zu bringen, überlagert und vereinnahmt den Sexualtrieb, welcher auf die Außenwelt als konstitutiven Faktor gerichtet ist. Jene auf die Außenwelt gerichteten Tendenzen zu unterdrücken führt „to the extent that the desire for death amounts to a complete externalization of multiplicity, heterogeneity, and difference.”[419] Das Ego ist der Organismus, jede konsistente Einheit, die niemanden und nichts braucht. Sie ist absoluter Narzissmus.
Die Zusammenschrumpfung des Todestriebes
Erst in den nächsten Variationen des Motivs entwickelt Freud die eigentlichen – in Jenseits des Lustprinzips nur angelegten – Konsequenzen des Triebes zum Tode, gerade in der Verquickung der Triebtheorie mit anderen Gebieten; weitreichend von Medizin zu Musik, von Philosophie zu Gesellschaftstheorie. Eben der letzteren widmet sich die Studie über das Unbehagen in der Gesellschaft, welche nicht sekundär und zufällig, sondern essentiell auf den Erkenntnissen von Jenseits des Lustprinzips aufbaut, diese aber radikalisiert und verzerrt. Freud schreibt, fast um mit dem Aufsatz zu schließen:
„Und nun, meine ich, ist uns der Sinn der Kulturentwicklung nicht mehr dunkel. Sie muß uns den Kampf zwischen Eros und Tod, Lebenstrieb und Destruktionstrieb zeigen, wie er sich an der Menschenart vollzieht. Dieser Kampf ist der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt, und darum ist die Kulturentwicklung kurzweg zu bezeichnen als der Lebenskampf der Menschenart.“[420]
Die kannibalischen Triebe, jene die zum Tod drängen, bedrohen den Zusammenhalt und überhaupt die Möglichkeit einer Gesellschaft. Nur durch die Internalisierung von Schuldgefühlen und den geforderten Verzicht von Trieben, deren Charakter regressiv ist, kann das Versprechen auf Gemeinschaft und Zivilisation Rechnung getragen werden. Diese Unterdrückung verursacht ein Unbehagen, welches rückwirkend selbst zur Bestätigung der Repressionshypothese wird. Es wird eine Weile dauern bevor Foucault diese Ökonomie der Sexualität angreifen und wiederlegen wird.[421] Man muss die Wiederholung des Todestriebes hier nicht nur in seiner Kontinuität, sondern vor allem in seiner Differenz beziehungsweise Neukonfiguration der vorhergehenden Todestriebe gesehen werden. Den Dualismus zwischen Eros und Thanatos hatte er noch durch die Vorherrschaft des Todestriebes vermeiden können. Nun aber scheint das Potential der Lebenstriebe soweit ausgedehnt – im Errichten einer funktionalen Gesellschaft – dass Freud sie nicht mehr subsummieren kann, sondern sie als Antagonist gegen die destruktiven Triebe stellen muss. Hatte er in der Regressionsthese noch ein schicksalhaftes Telos angenommen, wodurch der Todestrieb als Charakter der Triebe legitimiert wurde, so muss er jetzt einen impliziten sozialen Nihilismus in Kauf nehmen. Dabei schrumpft die Konzeption von ihrer biologischen Basis zu einem Mythos des destruktiven zusammen. Die für das Leben konstitutive Kraft einen Umweg zu erschaffen, der das Leben ist, wird dem Thanatos hier ganz genommen und nur mit dem Durst nach Vernichtung identifiziert. Viel des Obskurantismus, der sich um dieses Prinzip rankt, aber auch die ablehnende Haltung die Brun[422] diesem Prinzip entgegen bringt, wurzeln in dieser Verschiebung. Es ist gerade Erich Fromm, der nach langem Kampf mit dem Prinzip des Todestriebes, diese offene Stelle und unerklärliche Lücke in Freuds Argumentation bemerkt:
„Wenn wir uns Freuds Überlegung über die Grundlage des Wiederholungszwanges anschließen, daß nämlich das Leben die inhärente Tendenz hat, abzuklingen und schließlich zu sterben, so wäre eine solche ihm innewohnende Tendenz etwas völlig anderes als der aktive Impuls, zu zerstören.“[423]
In seinen früheren Arbeiten, besonders in den Drei Abhandlungen über Sexualtheorie hatte Freud eben jene Destruktionstriebe noch dem Sadismus zugeschrieben, der wohl definiert in den Grenzen des Lustprinzips arbeitet. In einer gewissen Unabhängigkeit arbeiten diese Sexualtriebe als die aggressive Seite der Sexualität keineswegs gegen das Leben, sondern gerade als Ausdruck des Selbsterhaltungsprinzips, welchem es nicht widersprach. Diese Annahme ist eine logische Konsequenz aus Freuds früher Überzeugung: „Ich kann mich nicht entschließen, einen besonderen Aggressionstrieb neben und gleichberechtigt mit den uns vertrauten Selbsterhaltungs- und Sexualtrieben anzunehmen.“[424] Auch in Jenseits des Lustprinzips sind beide Impulse, der Sadismus und die Selbsterhaltung noch spürbar. Zunächst versucht Freud die Wiederholung des Verlassen Werdens durch das Kind als Rache, das heißt eine Form des Sadismus mit Lustgewinn, zu erklären. Diesen lässt er jedoch fallen, aufgrund der Abwesenheit von Lust in der Wiederholung, was Freud viel eher zu einer Form des Masochismus führte. So konsequent Freud auch den Sadismus in der Wiederholung widerlegt, so findet die Selbsterhaltung ein anderes Schicksal – denn Freud ist nicht bereit sie aufzugeben. Sie findet sich als verwandelte These immer noch im Todestrieb selbst aufgehoben, der jetzt zu deren Triebfeder wird. Entscheidend für die Wandlung ist aber statt der Spaltung in zwei unabhängige Prinzipien, zieht Freud es vor den Selbsterhaltungstrieb so weit zu verschieben, dass er als Effekt des Todestriebes gesehen werden kann. Freud versucht noch Monist zu bleiben – und gibt es mit den Destruktionstrieben wieder auf. Deleuze wird aber ganz besonders auf diesem mittleren Freud bestehen, der im Todestrieb nicht nur den Willen zur Zerstörung sah, sondern den Freud der affirmativen Involution.
Ihren frühen Ausdruck findet dieser kreative Rückschritt in Freuds – Jenseits des Lustprinzips noch vorausgehenden – Schrift Zeitgemäßes über Krieg und Tod, deren Anstoß abermals die Nicht-Philosophie ist. Die Wirren des Krieges und das unpersönliche Sterben, in denen kein Soldat mehr einzelner Angreifer oder Opfer war, sondern nur noch Instanz einer selbstlaufenden Kriegsmaschine, drängen Freud zur Reflexion. Die abstrakte Maschine des Tötens hatte sich in Europa eingerichtet und Menschen, die ein Jahr vorher noch über die Weltpolitik diskutiert hatten, standen sich jetzt in Grabenkämpfen gegenüber. Etwas Geheimes und Verschüttetes müsste den Kontinent erfasst haben, das die Fassaden der Zivilisation nicht nur niederriss, sondern als Attrappen bloßstellte. Die Enttäuschung über die Verrohung weicht jedoch bald der analytischen Gelegenheit. Es zerstört die Illusion über den ursprünglichen Drang zur Zivilisation und die Notwendigkeit einer Gemeinschaft; es legt den Hunger nach Zerstörung frei, den man verdrängt hatte, weil er Unlust verursacht.[425] Lange hatte man versteckt, das Drakons Blutrecht immer noch gilt, das es nicht in Athen geendet hatte. ‚Tot den Fremden!‘ ist – so meint Freud – der Seele eingraviert. Keineswegs ist diese Beziehung jedoch reziprok, denn jemandem den Tod geben heißt nicht den Tod empfangen, ja für Freud schließt es die Möglichkeit sogar aus. Denn die innerste Tendenz des Unbewussten ist sich selbst als unsterblich zu betrachten[426], an den eigenen Tod nicht zu glauben. Es mag hierin die Quelle all unseres Heroismus liegen, wohl um den Tod zu wissen und ihn doch nicht zu glauben. Als absolute Grenze kommt ihm keine positive Bedeutung zu, wir können ihn nicht nur nicht als ihn selbst denken, sondern er bleibt unmöglich zu erfahren. Gerade deswegen hat er keine Bedeutung für das Unbewusste:
„Was wir unser »Unbewußtes« heißen, die tiefsten, aus Triebregungen bestehenden Schichten unserer Seele, kennt überhaupt nichts Negatives, keine Verneinung – Gegensätze fallen in ihm zusammen – und kennt darum auch nicht den eigenen Tod, dem wir nur einen negativen Inhalt geben können.“[427]
Offengelegt und ohne Halten, wie sich der zerstörerische Trieb im Krieg zeigt – alles zerstörend, was nicht zu einem Selbst gehört – hat er für Freud doch eine positive Dimension. Nicht ohne Ironie – und vielleicht verzweifelt – mahnt uns Freud, dass nicht der Frieden in der Unterdrückung des Hungers nach Blut zu suchen sei, sondern ein affirmativer Umgang mit den zerstörerischen Impulsen; eine positive Regression. Krieg, der die Rückbildung mit sich bringt, hat eben noch jenes Positives, dass er die Wahrheit auf seiner Seite hat.
Obwohl keines mehr dies nach der strukturalen Lektüre durch Lacan glauben mag, ist Freud hier vor allem affirmativer Denker, der das Begehren nicht vom Mangel her denkt, sondern von einem Exzess von Energie, welcher sich aus dem unvergänglichen Unbewussten spießt – wie Land bemerkt.[428] Es kennt kein primäres Ziel, noch hat es eine immanente Ausrichtung, sondern wird durch den Apparat der Psyche erst gerichtet. Der psychische Apparat, man wird dieses Wort noch befragen müssen, mit seinen Mechanismen, Ableitungen und der Ohren-Klappe. Der Apparat ist eine Maschine, der das Unbewusste agieren lässt. Das monströse Unbewusste. Kein Mangel – reiner Exzess.
Man kommt nicht umhin hier die wohl größte strukturelle Nähe zu Deleuze festzustellen, viel näher als an Lacan, und doch gleichzeitig die unendliche inhaltliche Ferne. Und Deleuze wird von der strukturellen Folie nicht abweichen, und wird trotzdem durch ein anderes Modell des Todes die gesamte Struktur verschieben und verändern. Ein Bauteil der Maschine verändert ihren Effekt. Alles wird wiederkommen, der Todestrieb, der Zug ins Anorganische, die Energetik, das unsterbliche Unbewusste. Man wird sich aber fragen müssen, was dieser Tod und dieser Rückgang eigentlich bedeuten – ob sie nur die Entspannung sind, die der Spannung des Lebens gegenüber stehen – und man wird fragen müssen, was es heißt die „Vitaldifferenzen abzulegen“[429]. Das heißt jedoch sich nicht nur auf den Zug des Anorganischen, und die labyrinthische Struktur der Umwege zum Tod einzulassen, sondern sich in das Herz des Ziels, in das Anorganische selbst zu begeben, um seinen intensiven Differenzen nachzuspüren. Man wird sehen, wie in der entspannten und ruhigen Welt des Anorganischen die intensiven Differenzen wimmeln, die durch den Freudschen Tod überdeckt waren. Man muss den Angra Mainyu freisetzen, ohne, dass er sich nur in der Zerstörung ausdrückt.
Sich auflösen in der Involute eines unpersönlichen Todes – das hieße, das Anorganische denken.
- Homo Tantum
- Lacan + Zizek – den Todestrieb neutralisieren
Lacan ist nicht nur unentschlossen über Freuds Konzeption des Todestriebes, sondern erheitert. Er kann nicht entscheiden, ob sie wahr oder nicht, oder ab man ihr glauben soll. Sie ist schlicht „so suspekt und so lächerlich“ unterstellt Lacan. Und ihm ist alles suspekt an dieser Konzeption: das der Natur angeblich ein Subjekt unerstellt würde[430], den primären Masochismus[431], die kreationistische Sublimierung[432] und die Zerstörung des Subjekts[433]. Nichts gibt es für Lacan, das nicht suspekt wäre am Todestrieb. Und doch bleibt er unausweichlich –auch für Lacan. Auch er will – wie Deleuze – den Todestrieb verschieben. Strategisch muss er dafür zunächst den destruktiven Charakter des Todestriebes beschwören, den er ohne Umschweife mit dem Nirwanaprinzip identifiziert. Freigesetztes oder radikales Begehren kann sich für Freud also – so meint Lacan – nur als destruktiver Trieb herausstellen. „Wenn es keine Zerstörung gibt, so gibt es keine Nahrung für die Erde“[434], lässt Lacan den de Sade sagen. Freud de Sade: ‚Es muss jene geben, die die Welt nicht nur mit dem Verbrechen verletzen, sondern sie aus dem Gleichgewicht stoßen, aus dem „rerum concordia discors“[435] wie Horaz es nannte, müssen. Es braucht jene, die nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen die Natur selber, gegen ihre Gesetze, die letzten Bindungen, verstoßen und die Gestirn vom Himmel reißen wollen. Sie begehren nicht den Tod des anderen, sondern das größere Verbrechen, die Vernichtung. Der Leichnam verfault und wird der Erde zurückgegeben – selbst diese letzte Regeneration muss man verhindern, noch einen zweiten Tod hinzugeben. Man muss die Welt brennen sehen. Sie muss von vorne anfangen. Absoluter Sadismus, letzte Natürlichkeit des Verbrechens. Und gerade in diesem, die Schöpfen aus dem Nichts – die Natur zum Neubeginn zwingen.‘ Das ist die kreationistische Dimension, die Lacan Freud unterstellt.
Lacan versucht sich abzuwenden von diesem Bild: „gibt es etwas Armseligeres und Erbärmlicheres als den Gedanken, dass die menschlichen Verbrechen in welcher Form immer, im Guten und im Bösen, mitarbeiten könnten an der kosmischen Aufrechterhaltung der rerum concordia discors?“[436] Der kosmischen Transgression will Lacan dagegen eine schöpferische Dimension des Todestriebes gegenüberstellen, die letztendlich auf der kreativen Funktion der Signifikantenkette beruht und auf ihrem Außen. Sie garantiert gar die Möglichkeit, die Phänomene der Natur als vom Todestrieb besetzt zu beschreiben und dadurch die Schöpfung hervorzubringen, nur insofern es die Signifikantenkette gibt.[437] Lacan erkennt richtig, dass es sich beim Todestrieb um eine Erinnerung handeln muss, die Freud noch durch die biologische Theorie der Rekapitulation abgesichert hatte. Nie hatte sich Freud aber die Frage gestellt, worin genau dieses Stammesgedächtnis beruht –bis auf Spekulationen über Vererbung. Vielmehr hatte er die biologischen Theorien mehr oder minder unreflektiert aufgenommen, wie Holt bemerkt:
„Viele der verwirrendsten und scheinbar willkürlichen Aspekte der psychoanalytischen Theorie, die Behauptungen enthält, die so falsch sind, daß sie nicht mehr nachprüfbar sind, sind entweder versteckte biologische Annahmen, oder sie resultieren direkt aus solchen annahmen, die Freud von seinen Lehren während des Medizinstudiums gelernt hatte.“[438]
Lacan wird diesen Faden aufnehmen und versuchen den Raum der Theorie jenseits der Biologie zu suchen und auf die Kette der Signifikanten zurückführen, die die Erinnerung an den früheren Zustand, zu dem man zurückkehren will, gewährleistet. Sobald es aber die Kette der Signifikanten gibt, gibt es auch ihr Außen oder ihren unmöglichen Anfang, auf dem sie sich letztendlich begründet[439] – das Nichts oder die Lücke des Realen selbst.[440] Lacan wird seine Verschiebung nun absolut machen und vollkommen von Freud divergieren. Insofern der Todestrieb durch die Signifikantenkette gewährleistet wird als Erinnerung, geht er notwendig nicht in ihr auf, denn er richtet sich nicht auf ein Verlangen innerhalb der Signifikantenkette. Wäre dem so, könnte Lacan die immense Schöpfungskraft des Todestriebes nicht erklären. Vielmehr zielt das radikale Begehren/Todestrieb auf das Außen der Signifikantenkette, auch das Nichts, welches als Lücke immer offen bleiben muss – das Ding. Auf diesen leeren Punkt richtet sich das Begehren, das nach einem Genießen jenseits der Lust und damit auch jenseits des Lustprinzips sucht. Es ist in seltsamer Resonanz gerade Derrida, der im Todestrieb auf die Tendenz gegen das archontische Primat – ein Archiv zu errichten zu wollen – hinweist[441], und ihn damit ebenfalls auf die Leere außerhalb des Archivs verweist auf welche sich der Todestrieb richtet. Jenes radikale Begehren will also nicht innerhalb der Grenzen des Gesetzes agieren, sondern will sie notwendig überschreiten – und bleibt mit nicht minderer Notwendigkeit gerade deswegen ihnen verhaftet. Es ist das Begehren der Antigone, die Polyneikes gegen das Gesetz des Staates begräbt und damit jener Überschreitung einen Schnitt einführt – meta– der die Ebenen des Gesetzes und seines Außen freilegt und das Gesetz selbst seinem wahren Charakter, der Hybris, preisgibt. Sie kann diese Überschreitung nicht überleben, denn das Reale kann nicht gelebt werden, doch es gibt auch keine Leben ohne es. Das Telos des Todestriebes findet sich nun eigentümlich verkehrt – vom Trieb zur Zerstörung ist es gewechselt zum Trieb des Genießens [jouissance], welches immer außerhalb des Lustprinzips geschieht und doch nicht minder zerstörerisch sein kann. Alles findet sich hier verwandelt: vom Tod zum Genießen; von der Garantie des Lebens durch den eigenen Weg zum Tod hin zum Genießen, das das Leben verbürgt, von der Biologie hin zur Linguistik (und ihr Außen).
Und während der Todestrieb seine schöpferische Kraft entfaltet, bemerkt man gar nicht, dass er ganz und gar zahnlos geworden ist, oder eben das seine Zähne nur die unerreichbaren des unmöglichen Dings sind, nach dem er strebt. In Lacans Umkehr hin zum Leben, hat der Todestrieb seine eigentümliche energetische Kraft verloren, die gerade im ungerichteten Exzess der Triebkraft bestand. Nun aber wird die Triebkraft nicht nur gebunden, sondern sie wird von einem fernen und unerreichbaren Punkt her – dem Objekt des Genießens – erst konstituiert und lassen nur noch Bewegungen auf es zu, oder er bettet sich in die Signifikantenkette ein und vergeht. Boothby hat in seiner Lacanianischen Lektüre eben diesen neuralgischen Punkt bemerkt und darauf hingewiesen, dass Freud zwei Theorien über das Jenseits des Lustprinzips anbietet[442] – der Trieb auf ein Minimum hin (Ruhe) und ein Prinzip der Intensivierung der Unlust und damit auch der Differenz (Unruhe). Diese Doppelfunktion ergibt sich aus der problematischen Situation der Egotriebe in Freuds Schrift. Einerseits scheinen sie die Sexualtriebe zu unterdrücken, um die Einheit des Organismus in seiner narzisstischen Versiegelung zu forcieren, andererseits gefährdet die Wiederholung in der Verstärkung der Intensitäten (Unlust) das Ego. Es ist die letztere These die nicht nur Boothy als die produktivere erscheint, weil sie sich nicht in die paradoxe Situation des gegen das Leben gerichteten Organismus bringt, sondern die energetische und exzessive Dimension der Wiederholung betont. Insofern ist auch der Todestrieb kein Wunsch zur Zerstörung des Anderen, sondern des Subjekts – es ist eher suizidal statt mörderisch. Deleuze scheint sich aus den Worten von Freud und Lacan zu kristallisieren. Lacan hat diese Interpretation in Freuds Werk selbst bereits als „lächerlich“[443] zurückgewiesen, da sie auf einen Trieb jenseits der konstituierenden Wirkung des Dings hinzuweisen schien. Alle drei jedoch – Lacan, Žižek und Boothy – versuchen die Freudsche Theorie jenseits der biologischen Wurzeln, nicht nur als theoretische Struktur, sondern auch als physische Konsequenz zu lesen. Betonen wir aber die schöpferische Wirkung der gegen das Subjekt transgressiven Triebe und verschieben die Theorie gleichzeitig aus dem Feld der Biologie auf ausschließlich das des Symbolischen (und seinem Außen), dann verlieren wir die Mittel die Schöpfung von größeren konsistenten Einheiten (molare Entitäten) überhaupt noch zu erklären. Nehmen wir die Zerstörung des Subjekts in Kauf, dann wird das Neudenken der Biologie unmöglich zu umgehen sein[444], stützen wir uns jedoch auf das Spiel der Signifikanten und ihr Außen, dann müssen wir die ungerichtete exzessive Dimension der Wiederholung aufgeben, zugunsten eines unauslöschlichen Mangels. Žižek hat diese doppelte Leserichtung nicht nur aufgenommen sogar noch radikalisiert und eine paradoxe Wendung gegeben, indem er den Todestrieb ganz vom Unbewussten loslöst und vollkommen auf die Seite des symbolischen stellt.[445] Er betont, dass die Grundopposition auf der der Todestrieb aufbaut – Tod/Leben – sich selbst überhaupt nicht konstituiert werden kann, weil der Zwischenraum bereits besetzt ist von den Teilungen innerhalb des Lebens und des Todes selbst. Das gewöhnliche Leben und das monströse untote Leben spalten das Leben selbst mit all ihren Zwischenzonen, ebenso wie der normale Tod und die untote Maschine – nicht lebendig und doch nicht Tod. Genau wie Deleuze und Guattari in Anti-Ödipus versucht auch Žižek das Leben vom Heideggerschen Sein-zum-Tode zu lösen, welches nicht mehr nur negativ durch seine unüberwindliche Grenze der Endlichkeit bestimmt ist. Heideggers thanatologische Engführung.[446] Jedoch verweist Žižek zu Recht auf den Umstand, dass Freud das Unbewusste als unsterblich und sich seiner eigenen Sterblichkeit nicht bewusst charakterisiert; es kennt die Todesangst nicht. Somit – schließt er – muss die Sterblichkeit auf der Seite des Bewusstseins liegen.[447] Der Todestrieb kann also keine Wirkung des Unbewussten selbst sein, dass keine Spur seines Todes in sich trägt. Žižeks Bewegung hin zum Bewusstsein weist einerseits die paradoxe Dimension des Todestriebes in Freuds Schriften hin, in der das Bewusstsein nicht nur Konsequenz oder Spur des Todestriebes ist, sondern sein genuiner Sitz. Gleichzeitig wird die exzessive Dimension des Unbewussten und sein unerschöpfliche Kraft herausgestellt, die die Dualität von Leben und Tod herausfordert. Žižek ist Schüler Deleuze‘. Doch die entscheidende Facette des Freudschen Ansatzes, dass selbst das Unbewusste nicht frei ist von den destruktiven Trieben des Bewusstseins, fehlt und ist uneinholbar in Žižeks Ansatz. Seiner Wende verdanken wir jedoch, dass der Schlüssel zur produktiven Kraft des Todestriebes und damit zum Auffinden des Anorganischen Lebens, des Lebens der „undead machine“[448] in jenen Zwischenräumen zu suchen ist, an denen sich der Riss innerhalb des Lebens oder innerhalb des Todesauftaucht. Jene Punkte, an denen das untote Leben, das Leben selbst in Frage stellt. Es geht um eine affirmative Neubewertung dessen, was Freud mit Tod meint. Spinoza gewinnt, so oder so.
- Erste und zweite Synthese bei Deleuze (+Zeitsynthesen)
Man kann sie überall in Deleuze Werk finden, verstreut in Kommentaren und Zusammenarbeiten, in Vorträgen[449] und in mal mehr, mal weniger systematischen Auseinandersetzungen[450], die Rekonfiguration Freuds – des alten Generals. Jedoch ist nirgends die Verdichtung der Freudschen Bewegung so intensiv, wie in Differenz und Wiederholung, in dem Deleuze entlang seiner drei Zeitsynthesen Freudsche Synthesen entwickelt; dabei findet sich die Synthese der Gewohnheit – in ihrer psychoanalytischer Transformation – zur Synthese des primären Narzissmus[451] verwandelt, die Synthese des Gedächtnisses reißt als Synthese der Partialobjekte virtuelle Intensitäten aus der koexistenten Vergangenheit und letztendlich korrespondiert die Synthese der Ewigen Wiederkehr mit dem Todestrieb von dem sie sich in der reinen leeren Form der Zeit nicht mehr unterscheiden lässt. Dritte Synthese, der Tod der Erotik der Vergangenheit – vollkommene Desexualisierung. Transzendentaler Todestrieb.
Die Synthese des primären Narzissmus
Wir werden schon immer das Tick-Tack gehört haben, die Schläge des Uhrwerks, die physisch nichts miteinander zu tun haben. Und doch werden wir hören: Tick (und erwarten:) Tack (und hören es als Wiederholung von Tick, und erwarten:) Tick. Tick-Tack-Tick-Tack. Wir wissen wie es weiter geht – Wittgensteins Regelfolgenproblem zum Trotz.
Doch die Schläge der Uhr werden sich nicht geändert haben; physisch getrennt tauchen sie auf und verschwinden und doch geschieht etwas – „eine Differenz, etwas Neues im Geist“[452]. Die Zeit selbst zieht sich zusammen, die Schläge verbinden sich, der Geist wird sie verbunden haben. Es wird sich die Zeit gegründet haben, eine lebendige Gegenwart. Kant nennt das „Synthese der Apprehension“[453] ist damit selbst nur eine differentielle Wiederholung Humes; was Kant gemerkt haben musste – und sofort mit Streichungen reagierte.[454] Wir hören die getrennten Schläge der Uhr noch einmal und wir werden sie diesmal mit Humes Ohren hören. Sie vermischen sich nicht – keiner der Töne geht in den anderen über, und doch lassen sie sich nicht mehr trennen. Wie in der Melodie Husserls – der an dieser Stelle eine differentielle Wiederholung von Aristoteles ist – in der man keinen Ton der Melodie separat hören kann, ohne die Melodie zu verlieren, sondern immer noch das Nachklingen der letzten Töne (Retention) und das Erwarten der Kommenden (Protention) im Bewusstsein behalten muss, so ergibt auch ein einzelner Glockenschlag noch keinen Sinn. Nichts verbindet sich in den Dingen, sondern ihre Relationen sind extern – nichts liegt in den Dingen selbst, dass sie notwendig verbindet außer das Allgemeine, welches der Geist aus dem Besonderen bildet. Ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch – nicht die Idee des Menschen, die die Besonderen legitimiert, sondern die Gewohnheit des Menschen, die das Besondere verbürgt. Das Reflektieren kommt später – „Die Kontraktion ist keine Reflexion“[455] und ebenso wenig ist sie der Verstand oder das Gedächtnis, die Boten der Reflexion, die Einbildungskraft, jene Kraft der Kontraktion, welche sie so häufig überlagern.[456] Vielmehr werden sie Alle als aktive Synthesen von einem unterirdischen, subrepräsentationalen Strom von passiven Synthesen unterzogen, ohne den sie nicht möglich gewesen sein werden. Und selbst Ich werde nur eine Gewohnheit gewesen sein – mein Leben, die Serie von mens momentanea, von denen ich gelernt habe, sie auch ein Zentrum zu beziehen. Damit ist der Geist ständig im Delirium[457], und die Erfahrung wird immer schon übergelaufen sein[458], da sie ihre Formen erst in der Wiederholung gießt, sie erst ins Recht setzt. Somit entkommen die Zukunft und die Vergangenheit der zusammenziehenden Feldwirkung der Einbildungskraft nicht: sie „bezeichnen keine Augenblicke, die von einem der Annahme nach gegenwärtigen Augenblick geschieden wären, sondern die Dimensionen der Gegenwart selbst, sofern sie die Augenblicke kontrahiert.“[459] Und die Gegenwart wird sich aufgespannt haben über die Vergangenheit und die Zukunft, die verschwinden, sobald sie aus dem Feld der lebendigen Gegenwart rücken. Alles was geschieht, geschieht jetzt, alles was sein wird, wird jetzt sein, weil alles was war nur ist, wenn es jetzt Realität hat und alles was kommt, jetzt schon reale Erwartung ist. Einfalten der Vergangenheit und Ausfalten in die Vergangenheit. Und wieder mehr einfalten, mehr kontrahieren und die Zukunft bestimmen (determinieren), damit die Zeit nach vorne schnellt, „also vom Besonderen zum Allgemeinen“[460] voranschreitet.
Und Deleuze wird sich nicht mit der Psyche begnügt haben, denn man wird noch nicht einmal gesagt haben können, wo sie endet. Es wird nur Kontraktion gegeben haben, wenn es Kontemplation gab – und es gibt die Betrachtungen nur, wenn es Kontraktionen gibt. Mein Herzschlägt, es kontrahiert eine Gewohnheit und ist selbst nur kontrahiertes Pumpen, verdichtetes Blut. An dieser Stelle scheinen sich die Synthesen zu kreuzen, die sinnlichen und die perzeptiven – biologische und psychische Synthesen. Elementare Reize kontrahieren zu einer Wahrnehmung, die Qualitäten verweisen in ihrer Verbindung aufeinander und werden überlagert von einer – wenn auch vielleicht nur rudimentären Form – von Intentionalität. Und während das Bewusstsein – ohne Subjekt oder Kern – die Reize kontrahiert haben wird, verbirgt sich hinter dieser perzeptiven Synthese ein Auge, das die Kontraktion des Lichts selbst ist.[461] Der Magen antwortet – wie Merleau-Ponty[462] an Goldsteins[463] Studien herausstellt – bekanntlich noch vor dem Bewusstsein auf die Farben; Kontemplation jenseits des Ich. Die organische Synthese des Auges, die die Synthese der Wahrnehmung unterzieht und ermöglicht, die rezeptive Synthese der „primäre[n] Sinnlichkeit“[464] mahnt uns der prekären Stellung der Betrachtungen, jenseits deren wir nicht sein können, die wir gar sind:
„Welcher Organismus ist nicht aus Wiederholungselementen und -fällen gemacht, aus Wasser, Stickstoff, Kohlenstoff, Chloriden, Sulfaten, die kontrahiert und betrachtet werden, und verflicht nicht auf diese Weise all die Gewohnheiten, aus denen er sich zusammensetzt? Die Organismen erwachen unter den erhabenen Worten der dritten Enneade: Alles ist Betrachtung!“[465]
Es gibt nichts unschuldiges mehr in der Seele, dass nicht durch das außen selbst in Bewegung gesetzt worden wäre. Wir schauen nach außen, wir betrachten immer etwas anderes, und doch betrachten wir uns selbst, aber man kann sich eben nicht selbst betrachten ohne etwas anderes zu betrachten, dass man ist. Man ist immer Nietzsche, der in Sils Maris der Natur begegnet und nur dort sich selbst finden kann. Weder werden wir von diesen äußeren Intensitäten nur beeinflusst, noch nur geleitet, sondern die Erregungen der Natur selbst ballen sich in uns zusammen – wir sind die Bindung dieser Erregungen.
„Es gibt eine Glückseligkeit der passiven Synthese; und wir alle sind Narziss in der Lust, die wir in der Betrachtung empfinden, obwohl wir etwas ganz anderes als uns selbst betrachten.“[466] Was wir aber als uns selbst betrachten ist nicht auf der gleichen Ebene, wie die Betrachtungen, aus denen wir bestehen – auch wenn man sie nicht trennen kann. Dieser Schwarm der passiven Synthesen, auch wenn er von den aktiven überlagert wird, erscheint in diesen trotzdem als Zeichen. Die enttäuschte Protention des Magens, kein Essen bekommen zu haben, welche es seinerseits kontrahieren kann, entspricht nicht dem Zeichen des Magens, das in der aktiven Synthese als Hunger reflektiert werden kann, genauso, wie das Bild des Herzschlags für das Bewusstsein nicht die wirkliche Bewegung abbildet, oder ihm auch nur ähnlich sieht. Jede passive Synthese bedingt Zeichen, welche wiederum für das Bild der Gewohnheit selbst konstitutiv sind, welche ihrerseits nicht kraftlos sind. Die Betrachtung einer Betrachtung. Kybernetik zweiter Ordnung[467] – Heinz von Förster gewinnt, so oder so. Eben mit einer Betrachtung dieser Betrachtung der Betrachtung zu entsprechen, ist die Lust, die ihrerseits nur durch die Betrachtung möglich wurde. Dies ist der Narzissmus der ersten Synthese ist eben dieser Bezug, der nur in die Welt schaut, um Bilder seiner selbst zu sehen. Organischer Narzissmus.
Hier finden wir Deleuze Unterminierung des Lustprinzips. Lust ist nicht der Grund für Gewohnheiten, sondern Gewohnheiten sind der Grund für die Lust. Damit die Lust selbst erstaufkommen kann als Erfüllung eines Bildes seiner selbst, muss dieses bereits auf einer Kontraktion beruhen, die das Bild ermöglicht. Ein Organismus muss seine Nulllinie erst finden, es muss erst Erregungen binden, um ein System mit Selbstbezüglichkeit aufzubauen, in dem so etwas wie Lust überhaupt möglich ist. Es muss erst die Möglichkeit schaffen sich selbst entsprechen zu können. Die Frage ist daher nicht – oder wenn sie es ist, ist sie sehr müßig -, ob die Lust eine Kontraktion von Erregungen ist oder gerade die Entspannung dieser, da sie beides sein muss, um ihrem eigenen Bild zu entsprechen. Man muss den Krampf, auch das Erschaffen vermeiden, die Überspannung und die Langeweile.[468] Viel eher ist die Frage, wie die Lust selbst nicht nur ein zufälliger oder eingeschränkter Teil des psychischen Apparats ist, sondern zu Prinzip wird. „Die Lust ist ein Prinzip, sofern sie die Unruhe einer erfüllenden Betrachtung ist, die in sich selbst die Fälle von Entspannung und Kontraktion kontrahiert.“[469] Ist Lust erst einmal möglich, beginnt sie die Formen der Bindung der Erregungen rückwirkend zu annektieren – wie Kants Autopoiesis, den Prozess der Entstehung eines Organismus zum genetischen Prozess des Organismus machte. Sobald der Organismus Kants etabliert ist, nimmt er die passiven organischen Synthesen, die konstituierten in ihn auf und zu seiner Konsequenz. Die Repräsentation entert die Produktion. Ebenso wird die Bindung von Erregung, die Lust ermöglichen zu der Idee von Lust als Basis des Lustprinzips, sobald die passiven Synthesen die aktiven Synthesen des Ego ermöglicht haben. Die zuerst konstitutive Kraft der passiven Synthesen wird nun als Konsequenz der aktiven Beschrieben – die Gewohnheit, so Freud, kann sich nur bilden, weil das Bewusstsein die Mechanismen von Lust und Unlust auf diese Prozesse der Gewohnheitsbildung anwendet. Auf keine andere Weise, kann sich Freud erklären, wie sonst eine so komplexe Struktur, wie eine Gewohnheit entstehen soll, wenn nicht durch ein ihr zu Grunde liegendes Prinzip, wie die Lust. Freud bewegt sich auf der Ebene der Bilder, die die passiven Synthesen erst hervorbringen und kann daher die passiven Synthesen nicht sehen. So richten sich auch die passiven Synthesen (Betrachtungen) und die aktiven Synthesen (Lustprinzip) nicht auf dieselben Dinge: „Binding operates on free exitations in oder to enable the pleasure principle to relate them together into a system.“[470]
Es ist das kybernetische Problem, welches sich auf zahllosen Ebenen wiederholt, in Ashbys Homöostasetheorie der Organisation[471] nicht weniger als in der Homöodynamiktheorie von Maturana – die Frage des Gleichgewichts, welches erhalten werden und dem entsprochen werden soll, welches immer nur in den Termen seines eigenen Bildes gesehen wird, nicht aber in den Dynamiken, die die Bilder, denen entsprochen werden soll, erst konstituieren. Die Feedback-Schleifen[472] konstituieren sich durch positive Stimuli oder negative, ohne jedoch das Prinzip der Positivität oder Negativität der Stimuli – das vom Lustprinzip nicht sehr weit entfernt ist – zu hinterfragen. Dies entspricht eben nicht der Frage, ob ein Organismus immer nur nach einem Gleichgewicht strebt, denn diese ist banal, sondern nach den Mechanismen unter denen das Entsprechen eines Gleichgewichts überhaupt möglich ist und die nicht auf den Organismus selbst zurückgeführt werden können. Es ist nicht zuletzt die Frage, die in den wirtschaftstheoretischen Phantasien von Smith und Hayek wiederkehren.[473]
Plotin sagt: Man bestimmt und genießt sein eigenes Bild nur, indem man sich zwecks dessen Betrachtung dem zukehrt, woraus man hervorgeht.“[474] Man wird Deleuze Satz: „Orgisch zu werden und das Ansich zu erobern ist der höchste Wunsch des Organischen“[475] noch einmal mit seiner eigentümlichen Ironie lesen müssen, die die Philosophie verrät, gerade um sie von ihrer anthropozentrischen Verirrung zu befreien – die Lust wird gar kosmisch:
Und vielleicht ist es ,,Ironie“ zu sagen, alles sei Betrachtung, selbst die Felsen und die Wälder, die Tiere und Menschen, selbst Aktaion und der Hirsch, Narziß und die Blume, selbst unsere Handlungen und unsere Bedürfnisse. Aber die Ironie ihrerseits ist noch eine Betrachtung, nichts anderes als eine Betrachtung . . .“[476]
Überall nur Synthesen und nichts als Synthesen, kein Grund, keine Stabilität – nicht in den Steinen, nicht in den Menschen. Substratunabhängige Welt.[477] Und dann die winzigen Zufallsereignisse, die ungeplanten passiven Synthesen, die noch keinem höheren System oder Prinzip folgen, aus denen sich die Muster ergeben, die durch Feedbacks ungeahnte Konfigurationen hervorbringen.[478] Peirce[479] und Whitehead erschaffen die Muster des Kosmos aus Gewohnheiten, aus Wiederholungen, die ihr eigenes Bild, die Muster die sie schaffen, wiederholen. Narzisstisches und lustvolles Universum – libidinöser Kosmos.[480] Und wenn die Steine betrachten, die Pflanzen – wie es auch schon Hume beschreibt[481] – Sinnlichkeit kontrahieren, und wenn selbst das System der Planetenbewegung Betrachtungen entsprungen ist, dann müssen diese Dinge eine Seele haben, eine kontrahierende Ausdehnung und wenn auch nur eine kontemplative.[482] Die Phänomenologie reicht an diese Seele nicht heran, denn sie kann weder empirisch erkannt noch bewusst empfunden werden, sondern sie ergibt sich aus den infinitesimal kleinen Erregungen, den Intensitäten, die den Körper ausmachen und konstituieren in jedem Moment. Differentialrechnung der Intensitäten:
„kleine Perzeptionen Materieschwingung
—————————- = —————————–
bewusste Perzeptionen Organe“[483]
Intensitäten – kleiner als jede Ausdehnung – und doch nicht Nichts, sondern der Grund der Empfindungen. Sie Intensitäten treiben die Ausdehnung und Rückkopplung des lustvollen Kosmos an. Die erste Synthese konstituiert und ermöglicht das organische – sie ist aber selbst nur insofern organisch, als sie die anorganische, intensive Konstitution des Organischen als Prinzip in sich einschließt. Sie verweist bereits auf den brodelnden Schwarm der intensiven Differenzen des Todestriebes.
Synthese der Partialobjekte
Die Gegenwart war noch unendlich gewesen. Sie hatte weder Anfang noch Ende gehabt – sie verging nie. Unbeirrbar breitete sich der Habitus aus und untergräbt damit seine eigene Möglichkeit; die Frage des Vergehens wird unausweichlich, denn „gerade im Vorübergehen liegt der Anspruch der Gegenwart.“[484] Sie musste vergehen um eine neue Gegenwart zu ermöglichen und damit erst die Wiederholung, die die Gegenwart wiederum ermöglichte. Eine zweite Synthese tauchte auf, drängte sich auf, die in jedem Moment das primäre Vergessen entdeckt. Jeder Moment enthält etwas, das nicht gegenwärtig ist, es bleibt verborgen – inaktuell, wie Bergson es sagt. Aber vielleicht sagt es schon eher und ausdrücklicher Kierkegaard:
„Er war tiefinnerlich verliebt, das war klar, und doch war er imstande, sich gleich an einem der ersten Tage an seine Liebe zu erinnern. Er war im Grunde mit dem ganzen Verhältnis fertig. Indem der beginnt, hat er einen so fürchterlichen Schritt getan, dass er das Leben übersprungen hat. […] Was für eine seltsame Dialektik! Er sehnt sich nach dem Mädchen, er muss sich Gewalt antun, um nicht den ganzen Tag bei ihr zu hängen, und doch ist er im Hinblick auf das ganze Verhältnis schon im ersten Augenblick ein alter Mann geworden. […] Die Erinnerung hat den großen Vorteil, dass sie mit dem Verlust beginnt, deshalb ist sie sicher, denn sie hat nichts zu verlieren.“[485]
Man konnte die Gegenwart nicht mehr von jenem Verlust trennen, von jenen Momenten, die schon immer vergangen waren in der Gegenwart. Sie koexistierten mit der Gegenwart, sie waren das ewige schon-voraus[486] in das die vergehenden Gegenwarten eingehen und sich wandeln; reine Vergangenheit – reines Vergangen sein. Und man musste auf dieser Reinheit bestehen, damit sie dem greifenden Schwung der Gegenwart entgehen konnte. Die reine Vergangenheit bestand nicht einfach aus vergangenen Gegenwarten und ist auch nicht mehr in dieser auflösbar. Es mag sein, dass nur „die Gegenwart existiert“[487], doch die Vergangenheit insistiert[488] – sie durchquerte die Gegenwart ohne doch in ihr zu existieren; sie war schon vorbei. Und dann wollte sich die Gegenwart in der Vergangenheit spiegeln und sich lustvoll selbst erkennen, und doch konnte sie es nicht. Die Vergangenheit ähnelt der Gegenwart nicht, sie sind nicht Spiegelbilder der Gegenwart, sondern virtuell im Gegensatz zur aktuellen Gegenwart. Man möchte die Vergangenheit gerne befragen, wohin es gehen soll, wohin es geht, doch Kafka gibt uns die Antwort: „Zu spät“[489]. Sie ist schon vergangen, wenn die Gegenwart sie befragt und doch gibt sie Antworten. Denn die Vergangenheit ist kein Mangel – einfach eine Lücke in der Gegenwart -, sondern die fügt der Gegenwart etwas hinzu – Bewegungen und Inhalte.
Man muss Leibniz einmal ernst nehmen: Jeder Gegenstand ist Monade, die aus unendlich vielen Monaden besteht. Alles ist unendlich einzeln. Und man versucht diese absolute Vereinzelung aufzuheben, man sucht nach den Eigenschaften, die sich verbinden, ohne sie ineinander aufzulösen. Gleichen sich jedoch zwei Dinge in allen Eigenschaften, so kann man sie nicht mehr unterscheiden – wobei zeitlich-räumliche Unterschiede keinen Unterschied machen, meint Leibniz. Man muss also den Mittelweg nehmen, einige Eigenschaften herauszulösen und sie zu vergleichen. Aber nur, weil ein Apfel grün ist, genauso wie das Blatt des Baumen, an dem er hängt und das Haus vor dem er steht – sind weder Blatt noch Haus Wiederholungen des Apfels. Kurz, die Assoziationsgesetze erklären noch nicht notwendig, wieso einige Dinge verknüpft werden und andere nicht und schlimmer noch welche Ideen zueinanderfinden oder nicht. Bei genauem Hinsehen ist nichts wie das andere, tritt man einen Schritt zurück ist in gewisser Weise alles allem in irgendeiner Weise ähnlich. Die Assoziation Humes reicht nicht aus, um die Wiederholung zu erklären. Sie braucht weitere Bewegungen und Inhalte – das Gedächtnis ist ihre Regisseur und Autor. Am Ende war sie es, die Erinnerung, die mein Leben zu meinem Leben gemacht haben wird. „Das wahre Maß des Lebens ist die Erinnerung“[490] sagt Benjamin, und er hat Recht. Denn die Erinnerung ist die geheime Metrik, die sich inmitten des Lebens befindet, die ihm seine Abmessungen und Objekte gibt und es letztendlich zu meinem gelebten Leben macht.[491] Sie ist eben das Maß, in dem Maß, wie sie die Bewegung der Gegenwarten vorgab, sie vorgegeben hatte. Hume hatte noch die klare Musik des Barock im Kopf, die klar getrennten Einheiten der Musik, in der Pausen nur kleine Versatzstücke der übergeordneten abstrakten Metrik waren. Bach war als Musiker auch Mathematiker. Es gab für ihn nur Abfolgen von Sequenzen, von aneinander gereihten Gegenwarten unter einer abstrakten Choreographie, die die einzelnen Elemente anordnete. Bergson hat schon die Impressionisten im Ohr. Satie beginnt damit den Takt und seine abstrakte Metrik aufzulösen – bis er ganz die Taktstriche fallen lässt und die Dauern freisetzt, die auch Bergsons Werk durchziehen.
 Eric Satie ‘Gnossiennes’, keine Taktstriche, eine Dauer der Musik als Maß
Eric Satie ‘Gnossiennes’, keine Taktstriche, eine Dauer der Musik als Maß
Klangteppiche, Gewebe statt Klanggebäude, Mauern. Jene Bewegung Saties übertragt Bergson auf die Zeit: Die Erinnerung schließt die disparaten Gegenwarten zusammen und richtet sie aus am Maß des kontinuierlichen Werdens aus. Nicht nur die Hammerschläge der Gegenwart, sondern dies ist ihr Ablauf, ihre Verbindung – das Zusammenschließen der Gegenwarten, dies ist die Erotik der Erinnerung.[492]
Diese Erotik ist allgegenwärtig – scheint sich aber zunächst in der Reflexion in den drei Paradoxa der Gleichzeitigkeit, Koexistenz und Präexistenz. „Die Wahrnehmung“, schreibt Bergson, „ist niemals bloß Kontakt des Geistes mit dem gegebenen Gegenstand; sie ist immer von Erinnerungsbilder durchsetzt, welche sie vervollständigen, indem sie sie erklären.“[493] Die Erotik der Vergangenheit durchdringt jede Gegenwart und macht jede Erfahrung als gegenständliche erst möglich – es erklärt sie, indem die Erinnerungsbilder an der reinen Vergangenheit partizipieren und sich in die Wahrnehmung inkarnieren.[494] Damit enthält jeder Moment einen Splitter, der nicht gegenwärtig ist, der Gegenwart jedoch erst ermöglicht sich zu konstituieren; und sie damit doch schon immer in den Abgrund der reinen Vergangenheit zieht. Das Vergehen der Gegenwart. Kein Bild und keine Vorstellung kann man sich von diesem Raum machen[495] – da die Vergangenheit nicht einfach die Sammlung der vergangenen Gegenwarten ist, sieht sie der Gegenwart auch nicht ähnlich, und man kann sie nicht repräsentieren ohne sie auf die Gegenwart zusammen zu schrumpfen.[496] Deswegen reserviert Bergson einen anderen Begriff für sie: Virtualität im Gegensatz zur Aktualität der Gegenwart, die das alte Begriffspaar Möglichkeit/Verwirklichung ablösen. Bergson – der Mathematiker – entnimmt dieser Virtualität jedoch eine Repräsentation, um die Wirkungsweise der reinen Vergangenheit zu veranschaulichen. Es ist banal zu bemerken, dass das Modell notwendig eine gewisse Lächerlichkeit besitzen muss, da es nicht angemessen sein kann. Nicht banal ist dagegen, das Modell als ein solches Zugeständnis an die Unvorstellbarkeit hinzunehmen und
darin die Möglichkeit zu sehen, doch noch etwas zu sagen; diese Möglichkeit ist der Zeit- oder Gedächtniskegel. Auf der höchsten Ebene des Kegelschnitts AB findet sich reine Vergangenheit in ihrer höchsten Dekontraktion – die Gesamtheit der Erinnerungen eines Lebens. Durch die Translation und Rotation des Kegels wird die reine Vergangenheit immer mehr kontrahiert und gleichzeitig in jene Konstellation gebracht, in der sie – in ihrer Form höchster Kontraktion – im Zusammentreffen mit den senso-motorischen Reizen der Wahrnehmung eine Gegenwart bildet. Bei diesem Prozess geht jedoch nichts von ihr verloren, sondern entspricht mehr einem Verdichten oder einer topologischen Transformation in der die Relationen erhalten bleiben.
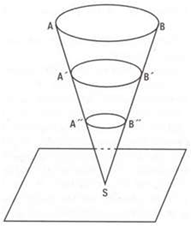 Bergsons Zeitkegel
Bergsons Zeitkegel
Auf jedem möglichen Querschnitt des Kegels, also in jedem Grad der Kontraktion, wird „dasselbe psychische Leben“[497] wiederholt. Die Konsequenz, die Bergson zieht, dass die Gegenwart nur die Vergangenheit in ihrer höchsten Kontraktion sei[498], wird Deleuze noch radikalisieren, indem er schlussfolgert, dass daher die Gegenwart mit der Vergangenheit koexistiere[499], welche – wenn auch verdichtet – immer vollständig mit der Gegenwart ist. Es ist jedoch allein die Gegenwart, die existiert, die die Gründung der Zeit ist, welche aber nur durch die Insistenz der Vergangenheit möglich wird, in dem sie den Grund der Zeit bildet. Und gerade deswegen wird die Vergangenheit in ihrer Insistenz immer schon der Gegenwart voraus gehen, sie wird immer schon geschehen sein, damit sich die Gegenwart konstituieren kann – Präexistenz.[500] Das Vergangene begleitet das Gegenwärtige als spekulativen oder virtuellen Schatten ohne den es nicht möglich wäre. „Ohne Schatten bist du auch der Seele bar“[501] heißt es in einem volkstümlichen Lied nach Peter Schlemihls wundersame Geschichte.
Es ist eben jene Virtualität – mit ihren Paradoxa – die Deleuze einerseits zur Diskussion von Freud und der Möglichkeit der Substitution der Objekte des Begehrens[502] (ihre Virtualität), aber vor allem zu Lacans Theorie des Phallus als Modell für die „virtuellen Objekte“[503]. Der kleine Junge lutscht am Daumen und man hört schon Melanie Klein sagen, wie der Kleine die Mutterbrust simuliert und sich nach dem Körper der Mutter sehnt – und man hört auch Lacan im Hintergrund lachen leise etwas von den Phantasien des Ursprungs nuscheln. Und man wenn er aufwächst, wird er sich verlieben und alle werden sofort ‚wissen‘, dass er sich in seine Mutter verliebt hat. Und Deleuze beginnt zu toben und muss ruft: ‚Ihr wisst nichts von den Objekten meines Begehrens!‘. Also wieder zurück zum Kind.
Der Habitus, in der ersten Synthese, bindet die Erregungen und lässt sich uns als Lust erleben. Dabei bezog sich diese Lust nicht auf die Objekte, sondern auf die Zeichen der passiven Synthese und den Bildern die sie erzeugten. Diese Zeichen waren nicht identisch mit den Repräsentationen der Synthesen – sie waren ihrem Wesen nach verschieden. Das Kind lutscht aber nun am Daumen und bezieht sich nicht nur auf Gegenstände und Zeichen, die ihm innerlich sind. In seinem Bezug auf ein Außen richtet es sich notwendig auf Objekte, die Erregungen hervorrufen können, um sie dann wieder lustvoll binden zu können. Eros besetzt damit nicht nur die passiven Synthesen der Gewohnheit, sondern bezieht sich auch auf Objekte, die sich nicht in der Gegenwart auflösen lassen, sondern eine Dimension benötigen, die diese gegenwärtigen Objekte erst als solche möglich macht. Bergson in Lacan wiederholt. Das Kind ist jedoch weder am Daumen – dem aktualen Objekt – selbst interessiert, noch ist es an einer Repräsentation verfallen; wie Daumen repräsentiert Mutterbrust. Vielmehr erschafft die Nuckelbewegung virtuelle Zeichen, welche in einer passiven Synthese gebunden werden können. Es ist damit nicht an der Brust als solcher interessiert, sondern an einem Aspekt der Brust, welche die Erregungen für den Bindungsprozess bereitstellte und der im Daumenlutschen wiederholt wird.
Das virtuelle Objekt des Daumenlutschens ist also weder identisch mit dem Daumen noch mit der Brust, sondern nur mit einem Aspekt von beiden, der Erregungen generieren kann. Damit bricht das Bild der Objekthaftigkeit in zwei Perspektiven auf – die totale Dimension des Objekts, welche in verschiedenen Perspektiven repräsentiert werden kann und die detotalisierende Dimension des Objekts, welche lediglich einige Aspekte subtrahiert, die ohne Vollständigkeit und doch auch ohne Mangel existieren. Wir wiederholen nicht unsere vergangenen Lieben in der jetzigen, doch wir wiederholen Gesten und Bewegungen, Züge des Gesichts statt Typen, Schwünge und Regungen der Seele, die sich nie ganz an diese eine Person binden lassen. Ein Winken ohne eine Person die winkt, ein Lächeln ohne Katze, wie die Carolls Cheshirecat oder „Kopf ohne Hals, Arm ohne Schulter, Augen ohne Stirn“[504] – kurz Partialobjekte. Man braucht keine Organe, es gibt sehr wohl organlose Körper, genauso wie es körperlose Organe gibt.[505] Diese Aspekte, die virtuellen Objekte „sind Fetzen reiner Vergangenheit“, sie spalten die Realität in eine doppelte Serie von aktualen und virtuellen Objekten[506], welche – obwohl aufeinander bezogen oder besser in Resonanz – nicht aufeinander reduziert werden können.[507] Sehr wohl tritt keine der beiden Reihen ohne die andere auf. Das Kind wird nicht das virtuelle Objekt wiederholen können, wenn es nicht am aktualen Daumen lutscht. Das virtuelle Objekt muss sich – wie das Erinnerungsbild in die Wahrnehmung – inkorporieren, um zu insistieren. Es ist eben noch eine Frage offen, die auf die Umkehr der Beziehung verweist. Alle Dinge ähnelten in gewisser Weise allen anderen, oder keines war dem anderen ähnlich genug. Entweder verweist man die Assoziation an ein höheres transzendentes Gesetz, was die Gemeinsamkeiten regelt oder man gibt die absolute Zufälligkeit der Assoziation zu, was aber ihr Versprechen, die Regelmäßigkeit, bricht. Genauso wiederholt sich das Problem jedoch auch auf der Ebene des Gedächtnisses, da nicht klar ist, wieso genau es möglich ist, dass diese Erinnerung mit dieser Wahrnehmung verbunden wird. In irgendeinem Aspekt, sind sich alle Wahrnehmungen und alle Erinnerungen gleich. Deleuze insistiert nun, dass das Band zwischen den Erinnerungen und den Wahrnehmungen eben jeweils das virtuelle Objekt ist, welches – in keiner Welt vollständig zuhause – sich in beiden Serien inkorporiert. Nicht weil ein aktualer Aspekt – eine Repräsentation oder ein Bild – die Erinnerung mit der Gegenwart verbindet, sondern wegen eines virtuellen Objekts, das beide ermöglicht, verheiraten sich Eros und Mnemosyne.[508] So „entreißt Eros der reinen Vergangenheit virtuelle Objekte, die von unserem Begehren und Liebesbeziehungen besetzt werden.“[509] Freud hat dies gewusst, wenn er im Begehren des Analytikers durch den Analysanden eine Wiederholung der Beziehung zum Vater sah, aus der virtuelle Objekte gerissen werden – Anerkennung genauso wie Wut – an sich an den aktualen Analytiker binden. Er hatte damit schon die Verschiebung im Auge, die er selber – eingenommen von einem archaischen oder archontischen Geist – später wieder redigieren wird. Der Analytiker ist austauschbar, was wiederholt wird ist das virtuelle Objekt. Aber, da es selbst nie Gegenwart war, wiederholt es sich notwendig verkleidet, es hat keine nackte Form, denn diese müsste in einer ursprünglichen Gegenwart wurzeln. Doch man „kann keine dieser beiden Reihen mehr als eine ursprüngliche oder die abgeleitete bezeichnen“[510], gerade weil das virtuelle Objekt schon immer vergangen ist, aber doch immer nur als in den gegenwärtigen Objekten insistieren kann in die es sich inkorporiert. Es ist überhaupt nur, insofern es sich den Mantel der aktualen Objekte anzieht. Hinter den Verkleidungen findet man nur weitere. Und man wird selbst enttäuscht wenn man hinter den Verkleidungen noch eine ursprüngliche Fratze oder das Gesicht Gottes sucht – schält man die letzte Schicht weg, ist alles verloren. Ranke verliert, so oder so. Die Reminiszenz – das Erinnern durch die Schichten hindurch, das Platon noch vorschwebte – das noch Proust kennt – ist bei Deleuze schon immer verloren. Es kann nur ins Nichts führen, wenn man Glück hat, wenn nicht, bleibt nur der göttliche Wahnsinn oder der Wahnsinn des Göttlichen. Auch Zeus kommt nur verwandelt auf die Erde. Es ist lächerlich zu sagen, er sähe aus wie ein Mensch. Aber man hatte sogar vergessen, das man aus dem Fluss Lethe getrunken hatte, bevor am die Ideen als eine Endlosschleife von Wiederholungen im Fernsehen sah.
Freud bleibt diesem Ursprung noch bis zum letzten Treu – eben in der letzten Instanz. Immer noch will Freud die Verkleidung durch die Verdrängung erklären und geht damit bis aufs Letzte, wenn er die Kraft der Verdrängung selbst hinterfragt und auf eine „Ur-Verdrängung“[511] verweist. Die Verdrängung sichert sich selbst ab, sie muss nur tief genug liegen. Hier zieht sich die Deleuzesche Argumentation zusammen. Die Verdrängung, so Freud, beruht auf dem Bewusstsein in der Gegenwart, welches Erregungen, die zu intensiv sind als das es sie binden könnte, verdrängt. Eben dieses Bewusstsein – so setzt Deleuze ein – beruht jedoch auf den Repräsentationen des Bewusstseins, welche sich letztendlich auf passiven Synthesen gründen. Es ist eben jene passive Synthese der Partialobjekte die die Gegenwart als solche erst ermöglicht, indem sie die Assoziation der Wahrnehmungen mit den Erinnerungen ermöglicht. Die Verdrängung in der Gegenwart beruht also bereits auf den virtuellen Objekten. Deleuze zieht Bilanz:
„Man wiederholt nicht, weil man verdrängt, sondern man verdrängt, weil man wiederholt. Und – was aufs Selbe hinausläuft – man verkleidet nicht, weil man verdrängt, man verdrängt, weil man verkleidet, und man verkleidet kraft des bestimmenden Zentrums der Wiederholung. So wenig die Verkleidung im Verhältnis zur Wiederholung sekundär ist, ist die Wiederholung sekundär zu einem fixen, der Annahme nach letztem oder ursprünglichen Term.“[512]
Eine reductio ad absurdum auf Freuds These des Anfangs. Und schon beginnt sich das Anorganische zu verwandeln, es verkleidet sich im Todestrieb selbst, ohne das Freud etwas tun könnte. Seine These der Rückkehr, war eben das, eine materiale Wiederholung eines ursprünglichen Zustandes – eine nackte Wiederholung, die die duale Matrix zwischen Leben und Tod, zwischen Belebtem und Unbelebtem aufschloss.[513] Wollen wir das Anorganische Leben entdecken, das Deleuze vermutet, dann müssen wir die eigenständige Bewegung des Todestriebes untersuchen und uns auf die Involute seines Schwunges, einer Wiederholung ohne erstem Term, einlassen.
Dritte Synthese
Nietzsches Zarathustra hätte im Tod enden – dem erholsamen Schlaf, der Erkenntnis des Augenblicks folgt er aber nicht. Nietzsche hat es nie geschrieben.[514] Und damit hätte Zarathustra – nachdem sein Untergang endete[515] – in die Zeit finden können, in jene Zeit die Deleuze erst nachträglich für ihn reklamieren wird. Nietzsche Frage ist jedoch erst eine andere und richtet sich direkt an die philosophischen genauso wie an die physikalischen Modelle seiner Zeit. ‚Wenn die Natur einen Plan verfolge, wenn sie also ein Telos, eine Harmonie oder einen Logos hätte, wieso hat sie diesen noch nicht erreicht oder erfüllt?‘ ist Nietzsche Frage mit der er beginnt die Physik wie die Philosophie zu erden. Für Nietzsche ist es offensichtlich, dass die Natur weder vollkommen harmonisch oder noch statisch ist, doch dies ist banal gegenüber der Idee, dieser Moment könnte eine Stufe auf dem Weg zur Vollendung sein. Vielleicht sind ja auch deren Schrittlängen wie in Augustinus De Civitate Dei schon ausgemessen oder hängen wie in Hegels Geschichtsphilosophie noch von der politischen Realität ab[516]; das Ziel jeden Falls steht fest. Um den jetzigen Moment zur störenden Kraft gegen den Endzustand zu machen, muss Nietzsche eine weitere These hinzufügen, die „Zeit-Unendlichkeit nach hinten“[517]. Man kann die Zeit rückwärts immer weiter supplementieren, jeder Moment impliziert sein Antezedens. Und so reicht die Zeit unendlich weit zurück und hatte damit unendlich Zeit sein Telos zu erfüllen, unendlich Zeit die Harmonie zu finden. Insofern nun aber der Kosmos jetzt nach einer unendlich langen Zeit, immer noch nicht zu seinem Ziel gekommen ist, dann kann es kein solches Ziel geben. Oder – was noch viel schlimmer ist – er hat die Harmonie bereits erreicht gehabt und wurde wieder aus dieser gestoßen, hat seine Gnade verloren und muss seinen Ausstoß in Tantalusqualen wiederholen. Gleichsam verschiebt sich damit der Fokus der Frage auf den Anfang, denn wenn der Kosmos einen geordneten, harmonischen oder statischen Anfang hatte, müsste man einen Grund angeben, wieso er diesen überhaupt verlassen hat. Jeder Moment des Werdens setzt den Anfang aus, daher braucht man einen Gewaltstreich den Anfang zu erhalten – eine mächtige Hand, zumindest kraftvoll genug die ganze Welt anzustoßen, jedoch schwach genug in diesem Akt zu verschwinden; der unbewegte Beweger, der erste Beweger. Und man verfängt sich hier wieder in – gewissermaßen – dem Netz der Immanenz selbst, da diese Instanzen nur die Platonischen Hintermänner der Hinterwelten sein können, reine Transzendenz, die auf die Immanenz insistieren. Nietzsche wird sich ihnen in den Weg stellen und die Konsequenz des Werdens noch radikalisieren, indem er den Anfang verschiebt, nicht lokal, sondern generell. Er rückt immer weiter weg und wird auch immer weiter weg rücken, denn es gibt ihn nicht in Reinform, sondern nur als jenen fürchterlichen Riss, als den Schelling ihn schon kannte, denn „der wahre Grundstoff alles Lebens und Daseyns [ist] eben das Schreckliche.“[518] Man darf diesen fundamentalen Spalt nicht in einen dialektischen transponieren, denn er ist weder die Identität von Sein und Nichts im Anfang im Sinne einer Hegelschen Deduktion des Seins, noch deren Werden in der Aufhebung, sondern reale Differenz eines nie in Identität zu bindenden Anfangs. Freud versteht es eben diese Schrecklichkeit des Anfangs zu nutzen, um sie dialektisch geschickt zu fixieren und damit auszulöschen. Der Organismus bewegt sich überhaupt nur aus seinem Ruhezustand, weil er von der traumatischen Welt angestoßen wird, von der er primordial abgeschnitten ist. Es gibt einen Anfang und es wird einen Anfang geben, jedes Mal, wenn der Organismus zur Ruhe kommt. Diese Urszene begründet Freuds Modell der Rückkehr zum Anorganischen als Dekontrahiertes, welches nur durch das Trauma der Umwelt – vor allem durch die Sonne – zur Differenzierung gezwungen wird. Mit Nietzsche rückt dieser Zustand der Ruhe jedoch unendlich weit weg, ist transzendental verschoben und uneinholbar, was die Frage impliziert, welchem Zustand – wenn nicht diesem ursprünglichen – dann das Organische zustrebt. Zu welcher Ruhe will es kommen, wenn es den Ursprung in der Ruhe nicht gibt?
Man muss das Argument Nietzsches aber wieder zurück auf die Zukunft lesen und die damit verbundene Frage an Freud. Es ist leicht Zeugenschaft von den mächtigen Bewegungen des Habitus und des Eros zu geben. Wie gewaltige Kraftfelder binden und verbinden sie, und nichts scheint ihrem Griff zu entgehen. Libidinöse Welt – jenes sexualisierte Universum von dem Lyotard als junger Mann noch träumte.[519] Mit Nietzsches Kritik am Gleichgewicht ist nun eine ähnliche Frage zu stellen wie bereits in der Physik: Wieso haben Eros und Habitus nicht bereits die gesamte Welt verschlungen? Es ist doch wohl – und nicht nur unsere Machtphantasien, sondern auch unsere annektierenden Gesten beweisen das – das Bestreben der Psyche, alles zu binden und in Objekte zu verwandeln, denen man virtuelle Objekte entnehmen und einpflanzen kann. Man will die Welt aushöhlen, den Anderen fressen – wie Derrida es einst beschrieb[520] – und die verspeiste Welt noch im eigenen Magen rumoren hören. Die Lust will die Welt verschlingen. Und doch ist die Welt noch da. Sie ist weder in unserem Bewusstsein, noch in unseren Ideen aufgegangen – nichts hat sie binden können. Die Immanenz ist wehrhaft – vielleicht – doch woher bezieht sie ihre Kraft? Dies zu fragen führt in Nietzsches „subversivsten Gedanken“[521] und zugleich in sein Geheimnis, welches Praxis und Theorie ineinander kollabieren lässt.
Bei Nietzsche gibt es keine einzelne These der Ewigen Wiederkehr des Gleichen, sondern mindestens drei – eben dies ist das Wesen dieser Überlegung, dass sie sich selbst differenziell wiederholt. Die physisch-kosmische Wiederholung, die ethisch-züchtende Wiederholung und eine Art von ontologischer Wiederholung – während vor allem die letzte Ewige Wiederkehr nicht ohne die Vorhergehenden gedacht werden kann.[522] Verfolgt man die erste Ewige Wiederkehr Nietzsches in seiner Physik, dann wird sichtbar, wie sie konstitutiv als Gedanke für die anderen ist und doch durch sie aufgelöst wird. Verfolgen wir die Schritte zur Wiederkehr in der logischen Form in der sie auch dargelegt wird:
- Alles was ist, ist eine Konstellation von Kräften.
- Die Kräfte im Universum sind endlich, da es kein Außen gibt, aus dem neue kommen könnten.
- Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Konstellationen nehmen die Kräfte ein.
- Die Zeit ist nach hinten unendlich.
- Da 2., 3. Und 4. hat es also jede Konstellation schon einmal gegeben.
Konklusion: Da 1. und 5. Ist alles das was ist, schon einmal gewesen.
Diese Kräftephysik Nietzsches – die Physik des Eleatischen Fremden – entwickelt Nietzsche in Auseinandersetzung mit der Physik Fechners, welche die Atome noch als minimale Einheiten der Physik setzen wollte.[523] Konnte man den Atomen zumindest noch eine Geschlossenheit nachsagen, die einen inkommensurablen Vorrat an Welt boten, so haben die Kräfte in gewissen Weise gar kein Außen, sondern sind nur, insofern sie sich äußern in ihren Wirkungen.[524] Sind die Konstellationen alle aufgebraucht, hat es alles, gegeben, die es geben kann. Alles was sein wird, war schon einmal. Die Welt noch einmal – ohne Änderung bis auf die kleineste Regung noch einmal in Ewigkeit; erste Wiederholung. Es ist banal zu bemerken, dass sich Nietzsche hier in seiner eigenen späteren Kritik verfängt, indem er eine Ursprünglichkeit an Kräften und Zusammenspielen annimmt, als machten die vorhergegangen Wiederholungen keine Differenz. Nicht so banal ist der Gedanke, welcher durch diese Spekulation evoziert wird. Er setzt sich wenig später als Dämon auf die Schulter des Denkenden:
„Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: „Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in derselben Reihe und Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!“ – Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete?“[525]
Kaum ist der Gedanke manifestiert, nimmt er die Form einer Probe an – einer Lebensprobe.[526] Die wird selektiv, darin, dass sie nicht aufhört die Frage zu stellen, ob man das Tun auch in alle Ewigkeit wollen kann. Damit spannt sich diese Probe aber gleichzeitig über die beiden exzentrischen Zeitdimensionen der Gegenwart in der sie erscheint auf. Sie ist wesentlich in die Zukunft gerichtet, weil sie den Willen eine Richtung gibt, der sich sowohl im Bejahen und Verneinen der Frage, wie aber auch in der Affirmation oder Negation der Frage selbst zeigt, welcher der Antwort noch voraus geht. Sie erscheint als Anspruch, dessen Adressat je ich bin, und deren ruf ich akzeptieren kann oder nicht, erst dann kann geantwortet werden, wobei die Annahme bereits eine Form der Respons ist.[527] Viel weniger geht es hier eben um die Entscheidungen die folgen, sondern viel mehr – wie bei Pascals Wette – um die Entscheidung selbst und was mit jenem geschieht, der entscheidet. „Tut immerhin, was ihr wollt – aber seid erst solche, die wollen können!“[528] Zunächst und zuerst selektiert die Ewige Wiederkehr, da sie die reaktiven Kräfte, deren Wesen im Verneinen der aktiven Kräfte besteht, selbst ihren eigenen Tod sterben lässt. Diese bauen auf der zirkulären Bewegung der ersten Wiederholung auf, die weder versichernden Anfang und noch erlösendes Ziel zulässt; sie tötet Arché und Telos. In dieser Haltlosigkeit einer an-archischen Welt versuchen sich die reaktiven Kräfte in die beiden Zeitdimensionen auszubreiten, die die züchtende Wiederholung zu beanspruchen versucht. Die reaktiven Kräfte Klammern an dem bisschen Vergangenheit, das sicher scheint – nicht aber notwendig zeitlich vergangen sein muss; all die Formen letzter Gewissheit und großer Narrative, die Nostalgie zur falschen Zeit geboren worden zu sein, die Whitehead schon als „Trick des Bösen“ [529] schlechthin bezeichnete, die Politik der Vaterländer oder die Transzendenzen in Wissenschaft und Religion. In ähnlicher Weise jedoch beginnen sie die Zukunft mit dem Fluch zu belegen, die aktiven Kräfte zu lähmen, deren Schöpfung für Nichts sein wird und ins Nichts verschwinden wird. Der Nihilismus ist der Fluch der Verklärung der Vergangenheit und der Lähmung der Zukunft. Doch gerade in diesem Klammern und der Kraft der Unterdrückung zeigt sich der Monismus Nietzsches, denn die reaktiven Kräfte sind keineswegs ein anderes Leben oder eine andere Art von Willen, sondern Willen der gegen das Wollen gerichtet ist, oder eben Willen, der des Wollens nicht mehr fähig ist. Selbst in den Geißelungen des asketischen Priesters dringt der Wille noch durch, denn „eher will er noch das Nichts wollen, als nicht wollen.“[530] Auch die reaktiven Kräfte sind noch Willen, der um seine Erhaltung kämpft, auch wenn seine Bestimmung durch und durch Negativ ist. Und wieder und wieder wird die Ewige Wiederkehr virtuell diese gegen sich selbst gerichteten Willen gegen sich antreten lassen ohne sie zu unterdrücken. Wie eine Schleuder oder eine Zentrifuge wird die Ewige Wiederkehr diese Erhaltung des Negativen durch sich selbst ausfällen. Wenn ihr Ziel die Vernichtung des Willens ist, dann werden sie sich durch die unendliche Wiederholung selbst vernichten. Sie gehen an sich selbst zu Grunde – sie richten sich am Zu-Grunde-Richten zu Grunde. Daher lässt sich der Nihilismus nicht umgehen; er ist gleichzeitig Ort der Vernichtung und Ort der Vernichtung seiner selbst. Weicht man ihm aus, dann schwemmen sich die reaktiven Kräfte nie aus – sie persistieren in den vermeintlich aktiven Kräften weiter.[531] Er ist das φάρμακον – jenes Gift, das auch die Arznei ist.[532] Es ist nie die Frage des Wesens der Gifte oder Arzneien in der Medizin entscheidend gewesen, sondern jenes wurde entschieden in der praktischen Dosierung und Verwendung von Substanzen.
Mit der Wende des Nihilismus gegen sich selbst, kündigt sich auch die Transformation der ersten Wiederholung an. Der Mechanismus ist ein Leierlied. Die Tiere – die Narren – freuen sich über das Gejaule der Drehorgel, in der alles so wiederkehrt, wie es einst gewesen ist; es läuft nur eine Rolle ab, wieder und wieder. Sie sehen nicht die Differenz, die wiederkehren kann. Immer noch ist der Moment nur ein Abbild oder eine Ableitung eines größeren Substrats, welches jeden Moment eine bestimmte Richtung gibt und sie ausfüllt. Man muss aber auch diese Rollen der Drehorgel noch zerschlagen, wie die Tafeln der Werte. Die Geschichte als großes Narrativ selbst muss durchbrochen werden in einem Moment der Affirmation, der „die Geschichte der Menschheit in zwei Stücke“[533] zerbricht. Eben an diesem Punkt richtet sich die Affirmation nicht nur auf die Zukunft, sondern ebenfalls in die Vergangenheit. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, man hat nur die Wahl an ihr zu verzweifeln oder sie zu befürworten. Immer bleibt die Möglichkeit erhalten zu sagen: „So wollte ich es!“[534] – immer kann die Vergangenheit erlöst werden, um sich vom Geist der Rache zu befreien, der droht die Zukunft zu zerfressen. Und er wirkt noch, wenn man sich der bedingungslosen Erlösung verweigert – all dieses Verhandeln: ‚Ich will ja, dass alles wiederkehrt, aber nur wenn x‘. Man muss das Werden als Ganzes affirmieren; nur darin affirmiert sich das Werden (als Wille zur Macht) selbst.
Ein zweifaches Paradox drängt sich auf. Einerseits macht das Werden alle Momente gleichwertig, da sie nicht mehr an der Arché oder dem Telos gemessen werden können. Doch haben wir es mit einem besonderen und wertvollen Moment zu tun, der sich aus der affirmative Augenblick aus der Geschichte hebt. Dies ist eine direkte Konsequenz aus der dritten Art der Ewigen Wiederkehr, der ontologischen. Das Werden selbst kann eben nicht mehr begriffen werden als eine abstrakte Kategorie zu dem sich das im Moment existierende Seiende bloß als konkrete Instanziierung verhält. Das Sein ist nicht aus dem Werden abgeleitet, was dadurch ja auch nur eine statische Kategorie wäre. Vielmehr gibt es das Werden erst, wenn es und indem es in einem konkreten Augenblick affirmiert wird, der das Werden ins Werk setzt. Dieser Akt des Affirmierens projiziert sich jedoch zurück auf die Vergangenheit und vorwärts in die Zukunft, die beide auf dieses Werden hin ausgerichtet werden. Die Vergangenheit wird erlöst und die Zukunft geliebt. Insofern zeigt sich das Werden, welches erst durch den Akt der Affirmation, „insofern […] es durch diesen Akt in sich selbst hineingespiegelt wird.“[535] Bei aller Ferne zum Gedanken der Negation muss man doch die ungeheure Nähe zu Hegel an dieser Stelle bemerken, insofern dessen wesentliches Sein, sich gerade durch den reflexiven Akt des Selbst-Setzens bestimmt ist – es erschafft sich selbst in sich selbst. Der Akt des Zurück-Werfens auf sich selbst ist eben das Werden, das sich in diesem Akt selbst erzeugt. Ebenso wie bei Hegel, stellt sich bei Nietzsche auch die Grundfrage des Werdens: Durch welche Instanz wird der Akt der Affirmation überhaupt ermöglicht? Genau an dieser Stelle zeigt sich die eigentliche Genialität der Deleuzeschen Interpretation, die sich vor allem einerseits dadurch auszeichnet, dass man für sie in Nietzsches Werk selbst – bis auf einige Vagheiten – nahezu keine Belege oder Begründung findet, und zweitens dadurch, dass sie an dem Punkt, an dem Nietzsche selbst die Bewegung des Denkens abbricht, weiter geht. Und es ist eben diese Stelle, die uns weiter an den Todestrieb und das Anorganische heranbringt.
Spinoza lehrt und, dass wir die Klugheit der Tiere nicht vergessen sollten in unserer einseitigen Ausrichtung auf menschliche Rationalität und mit Nietzsche scheint die Philosophie gar kosmisch zu werden, in seiner Verwerfung der Prinzipien, die den Menschen so willkürlich aus dem Ganzen der Natur hebt.[536] Auch wenn sich der Wille zur Macht in allen Lebewesen ausdrückt – weil es nicht lebendiges gibt, das man sich nicht als Ausdruck des Willens zur Macht vorstellen könnte – und auch, wenn der Mensch keine ontologische Sonderrolle hat, so hat er doch zunächst eine epistemologische Sonderstellung, die im zweiten Schritt zur ontologischen wird. Man muss sich fragen: ‚Was ist der Mensch?‘ und Nietzsche wird antworten: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde.“[537] Man muss den Menschen überwinden, aber nicht, um zum Tier zurück zu kommen, sondern um zum Übermenschen zu gelangen. Die Frage, wieso der Übermensch nicht einfach das Tier ist, ist müßig und lenkt von der Frage ab, die man stellen muss; die Frage, wer das Werden ins Werk zu versetzen vermag. Und auch wenn wir den Menschen und seine Kraft nur durch den Willen zur Macht selbst bestimmen, kommen wir über die Schwierigkeit nicht hinaus, dass es der Mensch ist, der bewertet und den affirmativen Akt ausführt. Denn jedes Ja, schließt auch ein Nein mit ein, eben ein Nein zum Ressentiment und dem, was nicht wiederkehren soll. Der Mensch wird die Spiegelfläche in der sich das Werden in sich selbst zurückwerfen kann. Insofern jedoch die Bewertung des Menschen – auch wenn es nur der Willen zur Macht selbst ist, der im Menschen spricht – von Bedeutung dafür ist, dass sich das Werden selbst setzt, dann ist das Werden nicht da, wo der Mensch nicht ist. Darin liegt die Krux des Nietzischen Anti-Realismus, dass sie eine kontingente Erscheinung für das Werden verantwortlich macht, die sich letztendlich als dessen Ergebnis erweisen soll.[538] Gerade die Abhängigkeit der dritten Form von Wiederkehr von der zweiten ethischen Form macht dieses Verhältnis so verworren, da es bei Nietzsche die ethische Position eines einzelnen und individuellen Standpunktes ist, von dem aus die Entscheidung getroffen werden muss. Nietzsches Welt ist noch nicht Deleuze‘ Welt der präindividuellen Singularitäten und der Ströme von unpersönlichen Intensitäten, sondern zentriert auf ein Individuum, das bewertet und sich erst danach selbst als Irrtum entlarvt. Deleuze wird die Räume absuchen unterhalb und oberhalb der Intensitäten, bei denen Mensch möglich ist und das Werden freilegen, dass nicht am affirmativen Akt des Menschen hängt, sondern real ist durch seine Selbst-Setzung durch sich selbst. Deleuze ist Realist, gerade weil die Zeit Synthetisches ist und nicht außerhalb ihrer zulässt. Man wird sich noch fragen müssen, ob es sich bei Nietzsches Wiederholung um die christliche Parusie oder die Stoische ἀποκατάστασις handelt.
Lovecrafts Universum wird nicht von den furchtbaren Figuren und Monstern bewohnt, wie man sie bei Shelly oder Stokers findet. In ihm – dem Abgrund von Lovecrafts Schriften – finden sich lediglich Kräfte und Konstellationen, die sehr viel mehr dem Werk von Poe ähneln. Sie erzeugen Monster, wie die grauen Gestalten in Die Farbe aus dem All die durch die seltsam schimmernde Kraft eines Kometen gezeugt sind;[539] oder die Kreaturen aus schrecklicher Vergangenheit, die nichts mehr von der menschlichen Welt wissen oder wissen können, die Shoggoth oder Cthulu[540], welche durch die furchtbarste Kraft überhaupt hervorgebracht wurden: die Zeit selbst. Lovecrafts ganzes Werk lebt von Verschiebungen des Raumes, des Lebens, aber vor allem der Zeit – überall nur verschiebende Kräfte. Es lebt nicht vom Schrecken, sondern vom Horror, einer Art der Verschiebung der Zeit. Er fragt nicht nach der Gegenwart des Schrecklichen, denn dieser Schock ist temporär und manchmal stellt er sich auch gar nicht ein, sondern er fragt nach dem vor und danach des Schreckens. Gelegentlich beginnt der Horror gerade nicht als Schock, sondern ist wie ein Laut oder ein Flüstern[541], das langsam aus dem Hintergrund ins Bewusstsein dringt. Etwas lang Vergessenes oder nie Gewusstes, etwas Fremdes oder Schreckliches dringt ins Bewusstsein – langsam und ohne klare Umrisse. Meistens weiß man noch nicht einmal, ob es da ist. Lovecraft ist Bergsonianer ohne es zu wissen – ein fürchterlicher und erhebender Bergsonianer. Er beherrscht die Kunst Monster nicht aus den Umrissen, sondern aus den Schatten zu zeichnen, genauso wie Odilon Redon[542], lediglich aus den Kräften, welche notwendig Ununterscheidbarkeitszonen einrichten. Sollte ich der Ghul sein? Spricht durch nicht schon die Kreatur aus einer anderen Welt? Die Verschiebungen des Raumes und der Zeit als Kräfte, die intensive Differenzen wirken lassen oder diese selbst sind, gebiert einen Horror, der länger vorhält als der Schrecken, weil er jeden Moment wie einen Schatten begleitet. Es ist ein Horror des anorganischen Lebens, ein Terror der Differenzen, die sich nicht in die organische Repräsentation pressen lassen wollen, die beständig kleine Risse und molekulare Veränderungen bewirken, bis ein molares Gebilde zerbricht – sich plötzlich ein Vorgang zerreißt. Die Organismen können Lovecrafts Literatur nichts entgegensetzen. Es ist eine Frage – die Frage der intensiven Kräfte -, die ihr Echo und ihre Resonanz in der Vergangenheit wie in der Zukunft finden; Lukrez, Spinoza, Leibniz, Schelling, Bataille, Deleuze und unzählige andere Schwingen im gleichen Maß. Aber es ist vor allem die Wirkung der Zeit, die Unterwerfung aller Prinzipien und Dinge unter ihre verändernde und verzerrende Wirkung, in der Lovecrafts „deep time“[543] – die Zeit vor allen Menschen, die Zeit von Zivilisationen vor dem Leben der Organismen, die Zeit vor der Welt -,mit den anderen verschlingenden Zeiten korrespondiert: Schellings Vorzeit[544], Nietzsches Zeitunendlichkeit nach hinten, Meillassoux‘ Zeit des Arche-Fossils[545] oder Brassiers Zeit der solaren Katastrophe[546]. Kant kann diese Zeiten nicht denken, die über uns und jede mögliche Erkenntnis ihres Inhaltes hinaus weisen. Auch wenn Kant die Zeit als Prinzipien der Erkenntnis a priori postuliert,[547] so kann er diese doch nicht ohne ein transzendentales Subjekt denken. Es ist nie Zeit und Raum an sich, sondern immer nur Zeit und Raum für uns, insofern sie Formen der Anschauung sind, nicht mehr.[548] Über die Dinge an sich kann man keine Aussagen machen, außerhalb unser ist nichts, worüber es sich zu sprechen lohnt, meint Kant. Und in seiner transzendentalphilosophischen Wirkmacht finden sich so viele wieder, die an diesem Anspruch so ungemein verzweifelt sind oder sich einrichteten, oder wie Meillassoux es einmal schreibt:
„Es könnte tatsächlich sein, dass die Modernen dumpf fühlen, das Große Außen unwiderruflich verloren zu haben, das absolute Außen der vorkritischen Denker: Ein Außen, das nicht relativ zu uns war, das sich seiner Gebung gegenüber indifferent gab, um das zu sein, was es ist, in sich selbst bestehend, ob wir es denken oder nicht; ein außen, das vom Denken mit dem berechtigten Gefühl durchlaufen werden konnte, in der Fremde – diesmal ganz woanders – zu sein.“[549]
Dies ist die Spannung die Kant den Philosophen vererbt, das Dogma des Korrelationismus, das die Welt und das Denken an uns binden will und die Welt zu unserer Welt und Denken zu unserem Denken macht[550]; noch der Chiasmus Merleau-Pontys, das Dasein Heideggers oder die mentalen Repräsentationen Fodors[551] machen die Welt nur durch uns oder nur in Verbindung mit uns möglich. Deleuze wird diese Verbindungen lösen – das Außen wieder freilegen, indem er den Riss der Zeit im Subjekt, der schon bei Kant im Paradox des inneren Sinns angedacht war, radikalisiert, um das Subjekt außer Kraft zu setzen, die Zeit zu leeren.; denn die Zeit braucht uns nicht.
Die Zeit spaltet was immer in ihre Bahn gerät; sie spaltete bereits das Ego Descartes, wie Kant gezeigt hat und Deleuze rekonstruiert. Die unbestimmte Existenz bestimmt sich bei Descartes durch das Denken und gibt das Ich als Gewissheit aus. „Cogito ergo sum“[552] heißt auch jedes Mal, wenn Ich denke, bin ich – ein und derselbe es – der denkt. Und wenn Ich nicht denke, wer verbirgt dann für meine Identität? Wenn Ich schlafe oder ohnmächtig bin, denke ich nicht – und überhaupt Descartes Alptraum wahnsinnig sein zu können und gar nichts sicher zu denken und zu wissen; diese Möglichkeit, von der Foucault gezeigt hat, dass Descartes sie zu schnell überspringt[553]. All diese Situationen, deckt letztendlich Gott ab, der über den Schlaf wacht und sicherstellt, das Ich wieder als Ich aufwache und nicht vertauscht worden bin. Es ist einerseits der spekulative Tod Gottes, der Kant dazu bringt, diese göttlichen Versicherungen aufzuheben[554] und zugleich die Notwendigkeit einer Radikalisierung der Zeit selbst als emanzipative Kraft für emanzipierte Bürger. Indem Descartes die Identität an Gott verweist, schließt er die Zeit aus, insofern er die spaltende Kraft des vorher und nachher verschwinden lässt durch eine Instanz außerhalb der Zeit. Im Versuch die Identität nicht von einer Transzendenz verbürgt zu denken – im transzendentalen und somit eigentlich streng immanent angelegten Programm Kants[555] – führt Kant direkt in die Paradoxie des inneren Sinns, das darin besteht, dass wir nur erfahren können „wie wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem Bewusstsein darstelle[n], weil wir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich affiziert werden.“[556] Die Zeit selbst als Bestimmung der unbestimmten Existenz, trennt das Subjekt auf in ein sichtbares Subjekt, welches aber nicht das spontane Subjekt ist, welcher wiederum notwendig nicht sichtbar ist. Ein passives Subjekt, welches empirisch vor einem als dieser jemand erscheint und gleichzeitig ein aktives Subjekt, welches selbst schaut und nicht angeschaut werden kann. Angeschautes und Schauender, betrachtetes Subjekt und betrachtendes Subjekt, empirisches und transzendentales Subjekt der Erfahrung. Man kommt immer zu früh oder zu spät, um seinen eigenen Blick auf sich zu sehen. Transzendental-empirische Dublette, wie Foucault es einmal für den Menschen sagte. Die Unbestimmte Existenz und die Bestimmung sind nicht mehr durch einen Akt der Gründung aufeinander bezogen, sondern gerade der zeitliche Akt ist die Selbstaffektion „der zeitlichen bestimmten Existenz […].“[557]. Und dieser Riss lässt sich durch nichts mehr schließen, außer durch etwas, dass die Zeit selbst wieder überwindet und dem Riss zuvor kommt. Daher wird Kant versuchen, das transzendentale Subjekt aus der Erfahrung zu gewinnen und dann als die „Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung“[558] zu setzen. Er extrahiert das Transzendentale aus der zeitlichen Erfahrung, nur um es dann jenseits der zeitlichen Erfahrung anzusiedeln, da es ja alle mögliche Erfahrung bedingt. Für Kant – in der Bewegung des transzendentalen Tricks – ist es also nicht notwendig das transzendentale Subjekt selbst der Zeit Preis zu geben, da es jede mögliche zeitlicher Erfahrung ohnehin bedingt. Um diesen Taschenspieletrick aufzulösen, wird Deleuze nicht auf das Mögliche, sondern auf dem Reale bestehen. Entscheidend sind die realen Erfahrungen, die ihre Bedingungen erst nachträglich legitimieren, anstatt a priori von ihnen bestimmt worden zu sein. Damit erweist sich jedoch die Deleuzesche Kritik an Kant genau genommen als Radikalisierung des Kantischen Programms einer radikalen (immanenten) Transzendentalphilosophie.[559] Hatte Kant also noch versucht zu ergründen, wie man die unendlichen Modulationen der Selbstaffektion durch die aktiven Verstandesleistungen synthetisieren könnte, so wird Deleuze diesen Versuch fallen lassen und jene dämonische Macht einlassen, die Kant schon in der Einbildungskraft ahnt; jene Ereignisse und Anblicke, bei denen sich die Eindrücke scheinbar von selbst synthetisieren, ohne, dass die aktiven Synthesen der Einbildungskraft sie zusammen halten könnten. Zu groß für uns, es gibt nur noch ein zu groß für uns – nichts lässt sich im Begriff zusammen ziehen; Apprehension, Rekognition und Reproduktion versagen alle zusammen, angesichts der Große des Erhabenen. Und was, wenn das Erhabenste selbst, die Zeit selbst wäre?
Habitus und Mnemosyne zogen Kreise in und um die Welt – sie erschufen zirkuläre Strukturen, die sich in Gewohnheiten und reiner Vergangenheit manifestierten. Als dezentrisches Zentrum dieser Synthesen setzt sich nach und nach das Subjekt ein, welches sich kontingent aus den Synthesen konstituiert. Narziss und Eros hatten diese Zirkularität als Rückfluss auf das Subjekt legitimiert und das Lustprinzip begründet. Eben diese lustvolle Selbstlegitimierung des Subjekts, das sich auf sich selbst gründen kann zerbricht, wenn es selbst in der Zeit erscheint. Die Zeit selbst verschiebt es wieder und wieder in jedem Moment – der Kreis wird unwuchtig und kommt nicht mehr bei seinem Ursprung an; jede noch so kleine Verschiebung bildet nach und nach eine Linie. Es ist diese Verschiebung die Deleuze in Nietzsches Ewiger Wiederkehr erkennt, dass sich alles wiederholt, aber jede Wiederholung wiederholt nur das Differente, wiederholt nur die Differenz selbst. Sie ist das einzige was wiederkehrt.[560] Kein Bild und keine Instanz außerhalb der Zeit könnte noch für die Identität dessen bürgen, was sich in der Zeit verändert – nicht das transzendentale Subjekt, nicht Gott und nicht das Bewusstsein. Die Zeit selbst muss sich durch nicht legitimieren als durch sich selbst, denn nur sie ist es die abläuft, nicht etwas in ihr. Alles ist in seiner Wiederkehr verwandelt und daher ebenso nicht als es selbst wiederholt.
Man wird Nietzsches Satz: „Die größten Ereignisse – das sind nicht unsre lautesten, sondern unsre stillsten Stunden“[561], noch einmal lesen müssen. Und man wird die Bewegung wiedererkennen, die auch Deleuze vollführt. „Die Sonne zerspringen lassen, sich in den Vulkan stürzen, Gott oder den Vater töten“[562] sind zweifellos jene großen Ereignisse, die sich nicht genauso wiederholen lassen, weil ihre Ausführung eine Zäsur einführt. Aber man könnte sie teilen und die Sonne nur halb zersprengen – auch das würde reichen. Und man könnte immer weiter teilen und nichts würde sich ohne Differenz wiederholen, weil es nichts außerhalb der Zeit gibt, was für seine absolute Identität bürgen würde. Die Zäsur reicht bis in die kleinen und leisen Ereignisse hinein – nichts wiederholt sich ohne Differenz, nichts bleibt wie es ist. Selbst die kleine Geste des Winkens, gestern an der Straßenecke, wird nie wieder so geschehen. Die Wiederholung des differenten lässt alles verschwinden und macht es alles möglich. Die Gegenwart kann eben erst als eine solche erfahren werden, weil sie außergewöhnlich ist, weil sie eine Differenz zur vorherigen Gegenwart ist, nur so kann sie überhaupt empfunden werden. Dies ist das Geheimnis des Vorübergehens. Das Labyrinth hat aufgehört ein Kreis zu sein, sondern ist eine Linie geworden, wie man mit Borges sagen könnte.[563]
All die Formen, die die Zeit ausgefüllt hatten, indem sie in der Zeit abliefen und sich damit erhielten als die Herren der Zeit sind verschwunden. „Die Zeit ist aus den Fugen“[564] schreit Hamlet noch, denn er wird den Vater töten und doch ist es noch nicht geschehen. In seinem Zaudern wird ihm bewusst, dass nichts mehr so sein wird, wie es war und dieses Bewusstsein ist Grund seines Zauderns. „[f]ugit irreparabile tempus“[565] ruft Vergil und meint das Gleiche und vielleicht hat Hamlet es auch nur wiederholt. Es sagt nicht weniger, als dass die Zeit selbst nicht zeitliches ist. Sie ist nichts in der Zeit, welches wiederum in ihr vergehen würde und von einer anderen Bewegung ergriffen werden könnte. Die Zeit bewegt sich selbst und eben diese Bewegung ist die Zeit, die keine Koordinaten und Ankerpunkt kennt, die sie durchlaufen müsste, vielmehr ist sie das Prinzip der Verteilung selbst.[566] Eben diese Ordnung der Zeit, lässt nichts wiederkehren, ohne es zu ändern, und richtet damit das Vorher und Nachher als unüberwindlichen Riss ein, der durch nichts geschlossen werden kann, da nichts der Zeit wiedersteht. Diese Reihen oder Serien des Vorher und Nachher konvergieren an jenen Punkten, an denen sich die Gewohnheiten und Erinnerungen bilden, aber wiederum nicht ohne sie der Metamorphose in der Gegenwart auszusetzen. Der Schnitt oder die Zäsur der Gegenwart schneidet ein für alle Mal alle Hoffnung auf einen erlösenden Anfang ab zu dem man zurückkehren könnte – er ist Fluss der Zeit verschwunden. Damit verschwindet der Grund auf dem man die Zeit hätte aufbauen können und damit allem seine Begründung nimmt. Keine Arché und kein Telos sind mehr übrig, um die Dinge zu stützen – am Grund sind nur weitere Synthese und selbst das Graben wird zu Witz, zur Farce – man wird nur weitere Synthesen finden, keinen Grund; Ungrund.[567] Keine Abbilder eines Grundes oder einer Idee, sondern ein Possenspiel von Trugbildern die in einer anarchischen Zeit ablaufen. Heiliger Humor in der Synthese des Transzendentalen – grundlos und daher so lustig. Die leere, reine Form der Zeit enthüllt die absolute Kontingenz und damit nichts verdient den Ernst mit dem es behandelt wird. Man muss Gott nicht töten, es reicht über ihn zu lachen.[568]
Und man kann die Schwere dieser Zäsur vielleicht nur durch die Rolle des Vergessens bestimmen von der Blanchot so unnachahmlich gesprochen hat.[569] Denn sie ist nun nicht mehr – wie noch in der Gewohnheit und dem Gedächtnis – ein Mangel, sondern gerade das konstitutive Moment der dritten Synthese. Sie lässt einiges nicht wiederkehren, sie schließt ein Nein ein und schafft aber gerade durch dieses Vergessen ein Neues, ohne das nichts in der Zeit möglich wäre.[570] Das Vergessen verkleidet und macht es möglich, dass etwas erinnert werden kann, und es vergisst die vergangene Gegenwart, damit eine neue heraufziehen kann. Das Vergessen ist der Schlüssel zum Neuen, und, wie Nietzsche schon wusste, zum Übermenschen. Und hier hat man die Antwort auf die Frage, wo Deleuze über Nietzsche hinausgeht. Die Zeit muss nicht in sich selbst gespiegelt werden durch einen, der sich für die Affirmation entscheidet, sondern sie affiziert sich beständig selbst, ohne, dass wir es entscheiden oder nicht. Wir haben nur die Wahl zu entsprechen oder nicht; Deleuze ist Stoiker durch und durch, denn er wandelt den ethischen Impetus Nietzsches in ihrem Sinne ab: „Entweder hat die Moral keinen Sinn oder es ist genau dies, was sie sagen möchte, und hat nichts anderes zu sagen: sich dessen würdig erweisen, was uns zustößt.“[571] Alle Archive brennen und nicht trotzdem, sondern deswegen, sind wir glücklich.[572]
Dostojewski lässt Jesus Christus durch die Straßen von Sevilla wandeln, in Mitten des 16.Jahrhunderts, der Zeit der Inquisition.[573] Und keiner wird ihn erkennen. Und mehr noch wird ihn der Großinquisitor in den Kerker sperren lassen um ihn am nächsten Morgen zu töten. Man kann nicht wiederkehren als Jesus, man kann ihn nicht materiell wiederholen, das heißt so wiederholen wie er war, sondern nur so wie er nicht war. Sein „Wesen“ bestand eben in der Differenz, die er machte und die zu wiederholen nicht in einer Wiederholung des Selben möglich ist. Eine Einsicht die Dostojewski in der Idiot konsequent und genial umsetzen wird.[574] Dies ist die Form, in der sich die dritte Synthese die ersten zwei unterwirft[575] und ihnen ihre selbstgenügsame Autonomie nimmt und ganz in den Dienst der reinen, leeren Form der Zeit stellt – sie beide auf sie bezieht. Die Vergangenheit erhält ihre konstitutive Rolle für die Gegenwart – wie es in den phänomenologischeren ersten zwei Synthesen auch war – jedoch kann sie nicht als sie selbst bejaht werden. Sie kehrt nur in Verkleidung wieder, weswegen die Gegenwart notwendig eine Metamorphose sein muss – sie macht das wiederholte zu groß, nicht-repräsentierbar und unursprünglich; überall nur Verschiebungen und Synthesen. „Die Form der Zeit besteht nur für die Offenbarung des Formlosen in der ewigen Wiederkehr […], [d]ie in sich selbst kreist und nur das Zu-kommende wiederkehren läßt.“[576] Schreibt Deleuze und man sollte vielleicht lieber Derrida als Heidegger[577] durch die Zeilen sprechen hören – auch wenn man einige Missklänge überhören muss.[578] Die Zeit ist, was sie gewesen sein wird – á-venier. Es ist eben Derridas Schüler Jean-Luc Nancy, der in Bezug auf Derrida, die Unausweichlichkeit des Vergessens noch durch die Verräumlichung der Zeit untermauert.[579] Im Denken (wie im Foto) „ist die Zeit selbst Raum“[580] schreibt Nancy, und bezeichnet damit die Öffnung für die Gabe der Zukunft, die nicht ohne den Raum geschehen kann.[581] Man müsste daher auch entlang der Linien einmal überlegen, ob es nicht gerade im Wesen der Materie liegt, nicht alles speichern zu können und daher die vermeintliche materielle Wiederholung schon eine Differenz macht.[582] Diese Ausrichtung ist nicht die Zeit des „Noch-Nicht-Bewussten“[583], wie sie Ernst Bloch kennt, aber auch nicht das nur negativ bestimmte Neue Adornos, welches sich in seiner Formalität, jenseits aller Existenz erschöpft.[584] Sondern es ist die Differenz selbst, die sich wiederholt und somit alles in einem freien Spiel, einem göttlichen Spiel wiederholt. Ein Würfelwurf, der getätigt wird, bevor es Regeln gibt, nach denen gespielt werden soll, außer der einen Regel, dass ein spiel nie zweimal gleich gespielt wird. Ein Spiel das geschieht, ohne, dass man es reflexiv zähmen kann, wie Deleuze schreibt: „Die Wiederholung ist eine Bedingung der Tat, bevor sie zu einem Reflexionsbegriff wird.“[585] Es fügt dem festen Gefüge der ersten und zweiten Synthese Risse zu, aber nicht von außen, sondern aus dem inneren, ihrer Tiefe selbst heraus – aus dem Spiel der Intensitäten, das immer nur ein Glücksspiel, ein Zufallsspiel ist. Der Organismus kann diese Kräfte nicht total und schon gar nicht dauerhaft binden. Er kann sich ebenso wie das Subjekt, das in Larvensubjekte zerbricht, nur als fraktalen und von einem Anorganischen Leben durchzogen halten – wenn überhaupt. Der Würfelwurf der die Zeit ist, oder gewesen sein wird, zerstört die Sicherheit des organischen Lebens. Es offenbart sich „the Deleuzean dice-throw as instance of anorganic vitalism”[586] – er ist der Akt des anorganischen Lebens, welches nicht neben dem organischen abläuft, sondern es unterzieht und zwischen den Zellen wütet. Das anorganische Leben ist die Zeit, die der Würfelwurf ist.
Die Zäsuren, die Risse der dritten Synthese, die die Organismen nicht wiederkehren lassen, sind keine Brüche – jedenfalls nicht notwendig, sondern eher Haarrisse, winzige Fissuren, die sich unsichtbar ausbreiten. Einige der schönsten Passagen, die Deleuze je geschrieben hat[587] – Porzellan und Vulkan – widmen sich diesen Ereignissen. Man hat da die Figuren Fitzgeralds: wie effiziente Organismen erscheinen sie als begabte Leute, teilweise mit Geld, Paare und Karrieremenschen. Und man weigert sich noch zu akzeptieren, dass, wie Fitzgerald sagt, „[s]elbstverständlich […] alles Leben ein Prozeß des Niedergangs“[588] ist, angesichts all der Schläge, der „lärmenden Unfälle“[589], die sie wegstecken können, ohne zu zerbrechen. Aber der Riss breitet sich ganz anders aus, eher wie der Sprung einer Tasse, winzig und unsichtbar in der molekularen Struktur der Tasse verschiebt er nur einige Teilchen. All die lauten Ereignisse, die an einem abzuprallen scheinen, weil man ihnen mutig entgegen tritt oder sie ganz verdrängt, finden nur am Rande dieses Risses statt, vertiefen ihn und ziehen ihn weiter. Und irgendwann werden die Ereignisse kleiner, die nötig sind, um den Sprung zu vertiefen und zu verlängern. Jede Wirkung, so klein sie auch sein mag, kann zum Bruch führen. Sie Figuren Fitzgeralds sind wie rohe Eier, deren Schale unsichtbar gebrochen ist, doch sobald sie sichtbar bricht, gibt es kein Halten mehr, nichts ist mehr übrig: „Warum haben wir den Frieden, die Liebe, die Gesundheit, eines nach dem anderen verloren?“[590] Der Haarriss dringt immer erst als Katastrophe ins Bewusstsein, immer ist es zu spät – immer ist er schon geschehen oder wird noch geschehen – „lautlose[r] Knacks“[591]. Vielleicht hat auch Yates nie über irgendetwas anderes geschrieben, als über die Geheimnisse der Kleinstädte und Vororte, in denen die unsicheren Träume der Städte gegen die sichere Idylle der Gemeinden getauscht werden. Obwohl sie nicht sichtbar sind, sind das Opfer einer großen Zukunft zugunsten der kleinen Lüste und Leidenschaften überall gegenwärtig – bis es nicht mehr zu ertragen ist, bis auch die Idylle zerbricht.[592] Irgendwann zerreißen die molekularen Veränderungen die molaren Strukturen, keine Projektion und keine Hoffnung kann sie retten. Man kann die komplexen Beziehungen des Risses zum Zusammenbruch nur nachträglich bestimmen, doch dann sind sie unwichtig. All die Interferenzen, Kreuzungen und Resonanzen zwischen der Wirkung der Oberfläche und den Wirkungen in der Tiefe finden ständig statt und sind doch nicht sichtbar, sie sind nicht verborgen und doch nicht offensichtlich. Schon während man lebt stirbt man einen unpersönlichen Tod, einen Tod der den Körper nicht vollständig zerstört, sondern sich ohne Persönlichkeit und nicht auf diese reduzibel als unkörperliche Kraft oder Linie im Körper ausbreitet. Ein Knacks ist noch kein Körper, auch wenn er etwas Materielles ist. Und der Tod ist nicht nur etwas persönliches, auch wenn Ich sterbe.
Die Unpersönlichkeit des Todes enthüllt sich im heroischen Tod genauso wie im absurden – und wer würde sich darauf versteigen beide zu unterscheiden? Buzzatti lässt in Die Tatarenwüste den Offizier Angustina eben einen solchen Tod sterben. Er ist schmächtig und zerbrechlich und doch weigert er sich während eines Schneesturms mit den anderen Schutz zu suchen. Er drapiert sich selbst auf einem Felsen – während Buzzatti fantastische Szenen im Off ablaufen lässt. Die Kälte wird ihn letztendlich nicht mehr freigeben und er stirbt mit den Worten: „Wir sollten morgen …“[593] – ein scheinbar persönlicher Tod, ein eitler Offizier, der sich selbst tötet und noch bis zur letzten Sekunde an seinen Plänen festhält. Und doch hat sein Tod etwas seltsam unpersönliches, die aber nicht das unpersönliche Feld aus der von Deleuze zitierten Dickens Geschichte A mutual friend; jenes Feld, das eine Gemeinde der Sterbenden bildet und letztendlich das Leben enthüllt.[594] Vielleicht ist es näher an der Erfahrung Karl Philipp Moritz‘, der sich angesichts der sterbenden Kälber nicht mit ihnen verbunden fühlt, sondern „ihm das Gefühl für eine unbekannte Natur geben.“[595] Es ist, als wäre der Tod Angustinas nicht nur sein Tod, sondern schon der Tod vieler – der Tod einer Meute – der ihm vorausgeht, und den er nur verkörpert.
„In einem Saal der Festung hing ein altes Gemälde, das den Tod des Fürsten Sebastian darstellte. Tödlich verletzt ruhte der Fürst mitten im Wald, den Rücken gegen einen Baumstamm gelehnt, den Kopf leicht zur Seite geneigt, während sein Mantel in malerischen Falten lag. Nichts in diesem Bild erinnerte an die blutige Grausamkeit des Todes, und der Betrachter war nicht überrascht, daß der Maler den Fürsten in all seiner Vornehmheit und Eleganz dargestellt hatte. Unbewußt nahm Angustina die Haltung des verletzten Fürsten Sebastian ein. Er trug zwar keinen glänzenden Harnisch, und zu seinen Füßen lag weder der blutige Helm noch das zerbrochene Schwert; sein Rücken lehnte nicht gegen einen Baumstamm, sondern einen harten Felsblock; nicht die letzten Sonnenstrahlen, sondern eine schwache Laterne beleuchtete sein Gesicht. Und trotzdem glich Angustina ihm aufs Haar: die gleiche Körperhaltung, die gleiche Drapierung des Mantels, der gleiche tödlich erschöpfte Gesichtsausdruck.“[596]
Das Bild des Sebastian ist ein Bild des Todes, das nur verkörpert wird und auch Sebastian ist nur Verkörperung dieses unpersönlichen Todes. Es stellt in eindringlicher Weise die Frage: Wer stirbt? In Heideggers früher Philosophie, wie sie „Der Begriff der Zeit“ und Sein und Zeit entfaltet wird, findet man die wahrscheinlich deutlichste Verbindung von Zeit und persönlicher Existenz seit Kant. Heidegger will die Frage nach dem Wesen der Zeit vom „vulgären Zeitbegriff“[597], den er durch den objektiven und wissenschaftlichen Zeitbegriff verkörpert sieht zur Frage nach dem vorwissenschaftlichen Zeitbegriff wenden. Dabei will er den distanzierten und reflexiven Zeitbegriff Kants[598] auf seine Existenz, und das heißt auf seine Existenz als Dasein, zurückbinden. Die Zeit als reine Form der Anschauung war bei Kant in gewisser Weise, wegen der Überlagerung der transzendentalen Ästhetik durch die späteren Teile der Kritik der reinen Vernunft, noch als offene Frage stehen geblieben und kehrt bei Husserl (ebenso wie bei Bergson) als die Frage nach dem Inneren Sinn der Zeit oder dem Inneren Zeitbewusstsein[599] zurück. Heidegger will nun diese bewusstseinsphilosophische Linie durchbrechen indem er das Dasein ins Zentrum der Zeit setzt. Besonders in „Der Begriff der Zeit“ kann man Heideggers Wende in actu nachverfolgen, da er hier die Frage nach dem ‚Was ist Zeit?‘ in ein ‚Wer ist Zeit?‘ wendet[600]. Nicht mehr die für Heidegger abstrakte Zeit und die damit einhergehenden Vorstellungen sind von Bedeutung, sondern das Dasein, welches schon immer In-der-Welt ist und als solches – in seiner Geworfenheit – einen konkreten und praktischen Bezug zur Welt hat. Jedoch lässt sich diese besondere Position des Daseins nur durch seine spezifische Zeitlichkeit legitimieren:
“Zukünftig auf sich zurückkommend, bringt sich die Entschlossenheit gegenwärtigend in die Situation. Die Gewesenheit entspringt der Zukunft, so zwar, daß die gewesene (besser gewesende) Zukunft die Gegenwart aus sich entläßt. Dies dergestalt als gewesend-gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen nennen wir die Zeitlichkeit.“[601]
Aus dieser paradoxen Zeitlichkeit der gewesend-gegenwärtigen Zukunft lässt sich auch die aus Zukunft kommende Zäsur der dritten Synthese herauslesen. Der Grund auf dem diese Zeitlichkeit beruht wird sie aber selbst zeitlich machen, anders als Deleuze‘ Zeit. Der Vorlauf in die Zukunft leitet sich für Heidegger aus einer Doppelbewegung ab, die man schon bei Kierkegaard erkennen kann[602]: vorlaufen in den Tod und Zurückkommen als Gewesenes. Die Bewegung des Vorlaufens findet Heidegger in der Selbstauslegung des Daseins, in dem, was gewisser und sicherer nicht sein könnte, vielleicht das Einzige das feststeht, der Tod oder, „die Auslegung auf den eigenen Tod, die unbestimmte Gewißheit der eigensten Möglichkeit des Zu-Ende-Seins.“[603] Das Dasein bestimmt sich durch den jemeinigen Tod, der als gewisseste Möglichkeit die Sorge konstituiert, welche die gesamte Struktur von Sein und Zeit unterzieht. Erst in dieser Konfrontation mit dem Tod, wird die eigentliche Zeitlichkeit deutlich. Es mag daher auch kaum verwundern, dass sich diese in der Grundstimmung des Daseins zeigt, der Angst.[604] Und es wird noch Jahre dauern bis Deleuze Spinoza wiederentdeckt und gegen Heidegger die Freude wieder als Grundstimmung ins Feld führen wird.[605] Heidegger hätte in dieser Bewegung zum Glück hin eben jene Verfallenheit gesehen, wie sie sich in der „uneigentlichen Zeitlichkeit“[606] einstellt, die sich in den pragmatischen Zusammenhängen verliert und immer auf etwas bestimmtes gerichtet ist. In seiner Umwertung weg von der objektiven Zeit zur Zeitlichkeit des Daseins, hat Heidegger sie erneut an eine Instanz gebunden, die er aber nun als Zeitlichkeit selbst definieren will:
„Zeit ist Dasein. Dasein ist meine Jeweiligkeit, und sie kann die Jeweiligkeit des Zukünftigen sein im Vorlaufen zum gewissen aber unbestimmten Vorbei. Das Dasein ist immer in einer Weise des möglichen Zeitlichseins. Das Dasein ist die Zeit, die Zeit ist zeitlich. Das Dasein ist nicht die Zeit, sondern die Zeitlichkeit.“[607]
Diese Analyse der Zeit entwickelt Heidegger – anders als Husserl oder Bergson – in direkter Auseinandersetzung mit Kant und man wird sich noch fragen müssen, ob er dessen Formalismus wirklich überwindet, oder nur den Standpunkt[608], aber nicht das Argument ändert.[609] Interessanter als diese Frage ist hier jedoch der Zusammenhang der Möglichkeit der Zukunft als Vorbei mit dem als Zeitlichkeit bestimmten Dasein. Insofern Heidegger die Frage des Was auf ein Wie der Zeit abändert, dann nur um es am Ende auf das Wer der Zeit zu wenden. Und, wenn man die Zeitlichkeit durch die Möglichkeit des Vorlaufs bestimmt, dann kann man die Frage nach der Zeit auch in die des Todes umkehren, indem man nicht fragt ‚Was ist der Tod?‘, sondern in gleicher Weise ‚Wer ist der Tod?‘. Und der Tod ist das Dasein selbst in seiner Selbstauslegung in der Möglichkeit seines Zu-Ende-Seins. Nicht nur die eigentliche Zirkularität und Irrealität des Todes müsste man problematische bedenken, sondern auch die Verengung des Todes auf das Dasein, womit Heidegger die spezifische Existenzweise des Menschen meint. Daher rührt ja auch Heideggers paradoxe und grundfalsche Annahme, dass nur der Mensch sterben würde, das Tier lediglich verende.[610] Dies ist eben genau die Weise in der Heidegger ein Korrelationist ist[611], beziehungsweise die Art, wie er selbst den Tod noch personalisiert, weil er das organisatorische Niveau des (selbstgewissen) Daseins nicht unterschreitet und somit Kants Reflexionsphilosophie nicht verlässt. Für Heidegger sterbe damit nicht Ich, sondern gerade die Gewissheit des Sterbens macht mich zu einem individualisierten Ich, anstatt es zu zersprengen. Heidegger ist Kierkegaard in der Einsamkeit des „Seins zum Tode“[612]. Deleuze hingegen ist Spinoza, der den Tod nur als Leben betrachten kann, der alle verbindet.[613] Und es ist genau dieser Doppelaspekt, den Blanchot hervorhebt:
Die Tatsache, dass ich sterben werde, schließt eine radikale Verkehrung ein, durch die der Tod, der die extreme Form meiner Macht war, nicht nur dahin kommt, mich kraftlos zu machen, indem er mich aus meiner Macht, den Anfang und selbst das Ende noch herbeizuführen, hinausdrängt, sondern er verliert auch jede Beziehung zu mir, jegliche Macht über mich, er wird zum Unmöglichen schlechthin, zur Irrealität des Unbestimmten. […] Zeit ohne Gegenwart, zu der ich keine Verbindung besitze, wohin ich mich nicht aufschwingen kann, denn in [ihr] sterbe nicht ich, habe ich die Macht zu sterben eingebüßt, in [ihr] stirbt man.“[614]
Der aus der Zukunft kommende Tod individualisiert mich nicht als eine Person, die das Sterben vermag, sondern als jemand der von einer unbeherrschbaren Macht genommen werden sein wird. Man darf diese Unpersönlichkeit nicht mit dem Tod in weiter Ferne verwechseln, der mich zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen wird; viel eher mors certa, hora incerta, wobei die Unbestimmtheit nicht auf eine teleologisch unbestimmbare Zeit verweist, sondern auf eine allgegenwärtige verschobene Zeit verweist. Der Tod geschieht ständig in der Differenz der dritten Synthese der Zeit, die das Ich zersplittert und nicht zulässt, dass es sich wiederholt, ohne sich zu ändern. Man stirbt immer, da die Zukunft nicht aufhören wird in die Gegenwart einzufallen in sie in die Zäsur zu verwandeln – da die Gegenwart sich anders nicht konstituieren kann.[615] Keineswegs ist dieses man stirbt mit dem wir sterben oder der universalen Verletzlichkeit zu verwechseln. Es präsuppositioniert keine tieferliegende Ebene in jedem Individuum oder eine Eigenschaft – die Sterblichkeit – die wir alle besitzen und auf Grund dessen, wir alle verbunden sind. Wir besitzen nicht den Tod, genauso wir das Leben nicht besitzen, da es weder Gegenstand noch Eigenschaft ist. Vielmehr sind wir alle durch etwas, dass sich selbst unserem Besitz entzieht, uns also nicht durch den Besitz, sondern eher durch die Absenz verbindet. Die Gemeinschaft, die sich um den Sterbenden in Dickens A mutual friend ist keine Gruppe von Menschen, die sich ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst werden, sondern im Gegenteil, die sich auf dem Feld des unpersönlichen Lebens wiederfinden und sie alle desubjektiviert. Keine Verbindung zwischen den Subjekten, die dem gleichen Schicksal geweiht sind, sondern das unpersönliche Leben, dass sich unter und zwischen den Subjekten abspielt, verbindet sie – nicht als Personen – in dem Moment, in dem die Persönlichkeit des Sterbenden zu verschwinden scheint. Das Leben dringt in diesen sterbenden Momenten in die Sichtbarkeit oder Fühlbarkeit drängt, jedoch nicht ohne klar werden zu lassen, dass es immer – ohne sichtbar zu sein – waltet. Der Tod enthüllt nicht das Leben als sein Gegenteil – vielmehr zeigt er die Spaltung innerhalb des Lebens und des Todes selbst. Kafkas große Erzählung über die Befreiung des Begehrens gegen die Lust heißt daher auch Ein Hungerkünstler, nicht Der Hungerkünstler – weil er eben nicht numerisch eine Person ist, sondern gerade weil seine numerische Individualität vollkommen aufgelöst wird. Daher auch der Titel von Deleuze letztem Text, der nicht ein Leben bezeichnet, das einheitlich oder numerisch eins wäre, sondern unzuordenbar und unpersönlich; Immanenz: ein Leben …
Die Kreuzungen dieser beiden Aspekte, die Blanchot hergestellt hat, „Selbstmord, Wahnsinn, Gebrauch von Drogen oder Alkohol“[616], sind dabei die vielleicht paradoxesten und doch konkretesten Denkversuche, die es geben kann. Denn wie sollte man über den Wahnsinn schreiben, ohne ihn zu jemeinem Wahnsinn zu machen? Wie sollte man schreiben, ohne sich in dem Gerede über solche Sachen zu verlieren? Das ganze „Lächerliche des Denkers“[617] bricht in diesen Fragen über den Philosophen herein, der über etwas schreiben will, diese Sache aber nicht tun kann, weil er dann nicht mehr schreiben kann und doch nicht darüber schreiben kann, wenn er sie nicht tut. Vielleicht ist dies die einzige Frage, die ethische, die in Deleuze‘ organlosem Körper steckt. Die praktische Frage, wie weit man gehen kann, bevor die Fluchtlinie eine Todeslinie wird, bevor der organlose Körper leer oder ein Geschwür wird. Wieviel Wahnsinn kann eine Philosophie ertragen, wie viele Drogen? Und doch kann sie nicht ohne sie über sie schreiben. Aber es ist auch eine innerphilosophische Fragen, wie man einen Philosophen zu einem organlosen Körper macht, das heißt seine Fluchtlinien beschreitet, ohne, dass man ihn zerstört oder das Denken inkonsistent wird. Es ist immer eine Frage der Dosierung, vielleicht die erste, weil praktische Fragen des Philosophierens als Akt. Man wird sich noch fragen müssen, wie der Denker mit diesem Doppelaspekt umgehen lernen kann, ohne sich in Abstraktionen zu verlieren. Aber vielleicht erhält genau hier die Philosophie ihre Weihen: „Dieser philosophische Tod ist gleichbedeutend mit dem Leben des Philosophen.“[618] Es ist genau die Frage, wie die Philosophie selbst anorganisch werden kann. Das heißt zu fragen: „Wie sich an der Oberfläche halten, ohne am Ufer zu bleiben?“[619]
Freud muss sich jedoch noch des Modells des Gegensatzes von Leben und Tod bedienen, er muss uns ermahnen, dass das Verlassen des Ufers zum Ertrinken führen muss. Freuds Konzeption bleibt die eines Egos, das, einmal gebildet, durch das Lustprinzip sich als narzisstisches Ich erhalten will; die Herrschaft des Bewusstseins. Aus dieser Sicht kann jede Art von Tod nur ein Rückgang auf das Anorganische, die Entropie sein. Insofern Leben bedeutet, sich als Narziss zu halten, gestützt und unterzogen von Eros, dann kann jede Erschütterung dieser Stabilität nur als Absturz in ein Apeiron, in einen Raum ungeordneter Differenz gedeutet werden. Die dritte Synthese der Zeit, die Deleuze jetzt mit dem Todestrieb identifizieren wird, wird in keiner Weise verneinen, dass der Todestrieb das Ego zerstört und genauso wenig wird er verneinen, dass es sich um eine Rückkehr ins Anorganische handelt. Jedoch hat Nietzsches ewige Wiederkehr den Mythos des ursprünglichen Zustandes eines dekontrahierten Anorganischen pervertiert, genauso wie der Gedanke der materillen Wiederholung dieses Zustandes. Mit dem Gedanken der differenziellen Wiederholung, des Spiels, welches erst gespielt werden muss, bevor sich seine Regeln schreiben, hat Deleuze dem Modell des Todes als Entropie eine Wendung gegeben – die Unmöglichkeit der materiellen Wiederholung, das Vergessen, ist nicht ist nicht die Ruhe, sondern das anorganische Leben selbst, dass sich nicht vom Tod trennen lässt.
Freud unterliegt der selben „transzendentalen Illusion“[620] wie Curie und (auch wenn er es abschwächt) Bolzmann, wenn sie die Entropie aus ihrem statistischen Rahmen lösen und zum Prinzip erklären; dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropie nimmt – so lautet eine Formulierung von Clausius – in einem geschlossenen adiabaten System für gewöhnlich zu, jedoch niemals ab.[621] Dieses Prinzip scheint, von der Thermodynamik selbst her betrachtet, zunächst durch die Motoren Carnots gerechtfertigt, die durch eine Differenz der Temperaturen (Intensitäten) funktionierten, welche jedoch im Prozess der Arbeit nie vollkommen effizient umgesetzt werden konnten und daher stetig abnahmen – der Prozess zwischen den zwei Kammern erwärmte zusätzlich die Umwelt um den Motor. Selbst wenn man das System von außen kühlt, basiert auch dieser Vorgang auf einer Intensitätsdifferenz, die eine Arbeit antreibt und am Ende die Entropie erneut erhöht. Das Universum als Ganzes jedoch, hat kein Außen mehr, dass in das System eingreifen könnte; es wird über die Lebensdauer des Universums immer mehr Arbeit in Systemen verrichtet, wobei jedes Mal Energie in thermische Energie umgewandelt wird und sich die Differenzen der Intensitäten immer weiter angleichen. Hat ein System in sich keine Differenz an Intensität mehr und auch keine zu seiner Umwelt, fallen diese Systeme zusammen[622] – man kann sie nicht mehr trennen. Über einen unendlich langen Zeitraum werden somit allmählich alle differenzierten Systeme in ein großes Feld von thermischer Energie eingehen, undifferenziert und unbeweglich, da keine Arbeit mehr geleistet werden kann. Wärmetod hatte Bolzmann das noch genannt, inzwischen kursiert auch der Kältetod.[623] Engels Frage: „»Oder«, wie Secchi fragt, »sind Kräfte in der Natur vorhanden, welche das tote System in den anfänglichen Zustand des glühenden Nebels zurückversetzen und es zu neuem Leben wieder aufwecken können? Wir wissen es nicht.“[624] Ist dabei keine Gegenposition zu der thermodynamischen Hypothese des 2.Hauptsatzes, sondern lediglich seine Rückseite. Wenn man annimmt, dass er stimmt, dann muss man eine zweite Kraft annehmen, die der Entropie entgegen wirkt – hier kreuzen sich sowohl Vitalismus als auch Freuds Dualismus von Eros und Thanatos. Deleuze wird diesen Dualismus umgehen, indem er das Wesen der Intensitäten genauer befragt.
Jedes Lehrbuch zur Thermodynamik beinhaltet – jeweils relativ am Anfang – die seit Kant gebräuchliche Unterscheidung zwischen intensiven und extensiven Größe. Jede Eigenschaft, die geteilt werden kann, ohne dass sie ihr Wesen verändert, ist dabei extensiv – oder andersherum, wenn „Größen durch Addition gleichartiger Teile gebildet, werden, diskrete und messbare Vielheiten vorstellen“[625] kann man von extensiven Größen sprechen. Intensive Größen dagegen sind die kontinuierlichen und unteilbaren Vielheiten.[626] Kant, ganz besonders in seiner Auslegung durch Cohen, beschreibt die Empfindung als Intensität, „d.i. ein Grad des Einflusses auf den Sinn […], in welcher die [intensive] Vielheit nur durch Annäherung zur Negation = 0 vorgestellt werden kann.“[627] Diese infinitesimal kleinen Empfindungen[628] werden nicht addiert und somit als extensive Größe aufgefasst, sondern von Kant als kontinuierliche Größe konzipiert, die – so sehr man sie auch teilt und verringert, nie auf einen kleinsten diskreten Teil kommt. Dass sie jedoch nicht Nichts ist, zeigt sich daran, dass sie, obwohl nicht in diskreter Weise, eine Differenz anzeigen kann – zum Beispiel das graduelle Ansteigen oder Abnehmen einer Empfindung. Das Feld der Empfindung individualisiert sich oder teilt sich nur, wenn eine Differenz in den Intensitäten auftritt – es differenziert sich gewissermaßen aus sich selbst heraus. Was bedeutet, dass die Intensitäten nicht primordial lokalisiert sind und nur aufgedeckt wurden, sondern sich erst durch das differenzielle Spiel mit den anderen Intensitäten bilden. Diese Differenziallogik hat Deleuze bereits im vierten Kapitel von Differenz und Wiederholung vorbereitet, wenn er zeigt, wie sich zwei nicht diskret bestimmbare Größen durch ihr differenzielles Verhältnis nicht nur selbst bestimmen, sondern durch ihre Differenz etwas anderes hervorbringen.[629] Es handelt sich dabei, wie in Leibniz Differentialrechnung, nicht um lokalisierte Punkte, die in Beziehung gesetzt werden, um eine lokale Veränderung einer Funktion zu bestimmen, sondern gerade um nicht lokalisierbare Größen, die erst als Differential eine Lokalisation möglich machen. Der Term dx bezeichnet allein noch keine lokalisierbare Größe, erst dy/dx macht eine Lokalisation möglich. Und mit eben jener Logik wird Deleuze das Kantische Modell aufnehmen und radikalisieren, indem er die Genese der Extensitäten aus den Intensitäten beschreiben wird. Man muss dabei jedoch auf die ungenannte Verschiebung des Feldes hinweisen, die von Deleuze zu Kant stattfindet. Während Kant noch, bewusstseinsphilosophisch, die intensiven Größen nur in ihrem Bezug auf die Erfahrung oder genauer auf die Wahrnehmung beschreibt, hat das Wort „sinnlich“ bei Deleuze einen Doppelklang. Es verweist auch auf die differenziellen Intensitäten im Bewusstsein, aber die eigentlich nur sekundär. Vielmehr bezeichnet sinnlich bei Deleuze jede Form von Affektion, die zuweilen der organischen Synthese weit voraus gehen. Nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Materie ist durch die intensiven Differenzen konstituiert – nirgendwo hören sie auf zu wirken.[630] Sie gehören weder den Gegenständen noch dem Bewusstsein, sondern bringen diese erst hervor. Es sind nicht zu Letzt die Werke der Kunst, die dieses Unmenschliche Potential der Intensitäten und Affektionen, die Perzepte und Affekte besitzen, die nicht von uns abhängen, sich aber auch nicht auf das Material reduzieren lassen. Sie selbst differenzierend, Blöcke bildend, schneiden sich die Werke scheinbar selbst aus der Materie.[631] Es ist aber dieser Gedanke, der sich nicht nur auf die Kunst beschränkt, dass sich die intensive Materie aus sich selbst heraus, das heißt durch ihre differentiellen Verhältnisse, aus sich selbst heraus als extensive Materie ausfaltet.[632] „Die Empfindung verwirklicht sich nicht im Material, ohne dass das Material nicht vollständig in die Empfindung, in das Perzept oder den Affekt übergeht. Die gesamte Materie wird expressiv. Der Affekt ist metallisch, kristallin. steinern […]“[633] Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass die Intensitäten immer in der Wahrnehmung (des Menschen) sein müssten, denn „Wahrnehmung spielt sich ab in Zone zwischen Schon-ausreichend und Nicht-zu-sehr“[634] – sie eröffnen viel mehr den Raum für Empfindungen weit über oder unter der Schwelle bei der ein Subjekt oder Organismus möglich ist. Blanchot hat dies mit der Schrift des Desasters zur Meisterschaft getragen. Schrift des Chaos, indem sich Konsistenzen nur wie zufällige Kristalle oder Zusammenrottungen Fremder erscheinen, die ebenso schnell zerfallen wie sie auftauchten, gleich beim nächsten Satz. Das macht das Weiterlesen unerlässlich und zur Gefahr. Diese Schrift stellt die Frage nach der Konsistenz des organlosen Körpers und stellt sich selbst an den Rand dieses Diskurses. Unmöglich zu lesen – Unmöglich nicht zu lesen. Ein Desaster und damit anorganisches Leben.[635]
Bolzmanns Angst und Engels Hoffnung stützen sich genau auf den Schleier, die die extensiven Größen über die generative Kraft der Intensitäten legen. Erst einmal durch die Intensitäten konstituiert drohen diese ihren Ursprung wieder zu verschleiern und sich als Extensitäten sui generis zu präsentieren. Die Annahme, dass das Universum sich in ein ruhiges und homogenes Feld von differenzloser thermischer Energie verwandelt, folgt nach Deleuze direkt aus dem Gemeinsinn,[636] dass sich Intensitäten immer nur in lokalisierten Dingen befinden, denen sie (an)gehören. Verschwinden diese Dinge nach und nach, so verwinden auch die Intensitäten; die Spitze des organischen Denkens – Auflösung = Tod = Ruhe. Dieses Bild hat jedoch überhaupt kein Modell dafür, wie die Extensitäten und Systeme, die sich jetzt auflösen, überhaupt zu Stande kamen – sie vergessen die genetische Kraft der Intensitäten. Kants Idee der Autopoiesis beruht auf demselben Trick, beziehungsweise Gemeinsinn, wenn er die generative Kraft eines Feldes von Intensitäten retrospektiv zum Feld des Organismus macht. Die Intensitäten haben keine eigene generative Kraft bei Kant, wenn sie nicht bereits einem Organismus gehören, der noch gar nicht gebildet ist. Das Anorganische kann bei Kant somit überhaupt keine eigene Kraft besitzen. Genauso steht es auch mit der Harmonisierung der Fakultäten, die ebenfalls nach diesem Modell ausgerichtet werden, insofern die Intensitäten der Anschauung immer auf eine Erfahrung (rückwirkend) bezogen werden.[637] Dies ist auch das Modell Freuds, der das Anorganische nicht anderes denken kann als eben jene Entropie, die Ruhe und Tod bedeutet. Dagegen setzt Deleuze die produktive Kraft der Intensitäten, die sich durch differentielle Verhältnisse lokalisieren, das heißt selbst in Extensitäten ausfalten können. Daher meint Deleuze auch: „Es sind die Organismen, die sterben, nicht das Leben.“[638] Keineswegs bedeutet der Todestrieb also die Abnahme an Energie aus einem System, das dadurch zu erliegen kommt, sondern vielmehr ist der Todestrieb das Auftauchen der Intensitäten auf einem Feld der Repräsentation oder Organismen, er ist die Zäsur der dritten Synthese der Zeit. Daher ist er auch kein Prinzip, sondern wird erst durch die auftauchenden Intensitäten konstituiert, welche ihn erst nachträglich als Gegenprinzip zum Lustprinzip einsetzen, welches – wie wir schon gesehen haben – auch kein primordiales Prinzip ist.[639] Man hat – wie Calvino es schon darstellt, einen Ritter, der keinen Körper hat, aber eine Seele, und einen Bauern, der keine Seele, aber einen Körper hat.[640] Aus diesem Wechselspiel entsteht auch das ambivalente Verhältnis zwischen dem narzisstischen Ich der ersten Synthese, das durch die zweite Synthese gestützt wurde. In der dritten Synthese – dem Todestrieb – äußert sich kein Subjekt auf der Ebene der Repräsentation (Ich) mehr, sondern ein Feld von Intensitäten, nicht lokalisiert und sich selbst differenzierend. Der Bezug des Subjekts zu den virtuellen Objekten wird damit einerseits erst ermöglicht, da es die Verkleidung in den aktualen erfahrbaren Gegenstand möglich macht, andererseits nimmt es dem Subjekt die Möglichkeit diese Energien auf sich zu beziehen und die Objekte zu genießen. Es setzt das Begehren gegenüber der Lust frei, indem es die Wiederholung desexualisiert – das Ich [Moi] hängt nicht mehr an den unerreichbaren Objekten des Ich [Je] ab, sondern verlässt diese „Verkrampfung“[641] des Gedächtnisses. Der Todestrieb ist damit keineswegs der Gegenpol zum Eros, denn erst durch die Bewegung des Thanatos können sich Habitus und Eros (und Mnemosyne) konstituieren, und gleichzeitig werden sie von ihm wieder außer Kraft gesetzt. All dies geschieht nur als das Spiel freier Intensitäten (Differenzen) – die alles konstituieren und gleichzeitig nicht bestehen lassen, wie es ist. Perniola hat wahrscheinlich Recht, wenn er diese desexualisierte Energie mit einem Begehren identifiziert, dass sich nicht aufs Organisch, sondern Anorganische richtet[642] – wie es sich in der anorganischen Kunstphilosophie Schelling zeigt[643], mit den Schwingungen des Weltkörpers als Musik oder der versteinerten und konkreten Klang in Form der Architektur. Aber vielleicht ist es Kafka, der die desexualisierte Libido am besten ausdrückte: „Ich wünsche mir oft dem Kaiser gegenübergestellt zu werden, um ihm seine Wirkungslosigkeit zu zeigen. Und das war nicht Mut, nur Kühle.“[644]
Umwertung der Frage
Es gibt eine Kreuzung des organischen Bildes des Denkens mit dem Stoff des Organischen. Es reicht nicht zu sagen, dass das Bild den Gegenstand, das de jure das de facto des Organischen bestimmt, anders herum sind es auch die Tiere und Menschen die das Bild für das Denken erst liefern; das ist das Wechselspiel zwischen Kant und Aristoteles – die Naturbetrachtung, die vom Bild des Denkens abhängt und das Bild des Denkens, dass sich aus der Naturbetrachtung ergibt. Aber es ist in beiden Fällen ein Korpus auf den man sich bezieht, der Körper der Dinge, der Körper der Regeln des Denkens, der Körper der Ding, die jedermann eben weiß etc. Und was wäre nun, wenn eben jener Körper beginnen würde auf seinem eigenen virtuellen Potential zu bestehen. Ist es nicht vielleicht das, was Burroughs in seinem Werk so unablässig beschreibt und vielleicht verlangt; die Drogen, die die Venen zum Zentrum des Körpers machen und das Gehirn förmlich wegbomben, es aus dem Schädel stoßen, oder der Anus, der sich gegen das Hirn auflehnt und in einer Revolte des Körpers den traurigen Denkapparat in sich selbst einschließt, indem er es vom Rückenmark trennt.
„Der Körper weiß, welche Venen im Moment brauchbar sind, und er vermittelt dieses Wissen durch die Bewegungen während der Vorbereitungen für einen Schuss … Manchmal schlägt die Nadel wie eine Wünschelrute aus. Manchmal muss ich auf die Botschaft warten. Aber wenn sie kommt, dann treffe ich immer auf Blut.“[645]
Das Gehirn ist auch nur ein Organ und es hat der Nadel nichts entgegenzusetzen. Die Rebellionen des Körpers sind keine Rebellion gegen sich selbst; sie sind eben kein Selbstzerstörungstrieb, wie man den Thanatos anhand des Entropiemodells deuten würde. Sondern es sind die Schreie, des organlosen Körpers, den man mit Organen und vor allem mit einer Organisation kolonialisiert hat. Er weigert sich noch, dieser Körper zu sein, der so und eben nur so funktionieren kann und darf. Ist dies nicht die Quintessenz von Cuviers Modell des Organischen? Der Organismus, der eine Organisation hat um Arbeit zu verrichten,[646] die ihn am Leben erhält, legt das Motto fest: So leben, so funktionieren oder untergehen. Gegen diese Maxime, nur leben zu können, wenn man sich dieser Organisation unterwirft, dagegen rebelliert der Körper. Der organlose Körper rebelliert nicht gegen den Körper und nicht gegen die Organe, sondern gegen diesen Körper, gegen diese Organisation des Körpers. Er rebelliert gegen den Organismus – er will „ein anorganisches, keimförmiges, intensives Leben, ein kraftvolles Leben ohne Organe, ein[en] Körper, der um so lebendiger ist, als er ohne Organe ist […]“[647]. Der oK ist eine reine Virtualität, auf dem der Organismus nur eine Falte, eine Aktualisierung ist. Doch ist sie – diese Falte – das einzige, das wirklich existiert, während doch beide real sind.[648] Der virtuelle Körper insistiert statt zu existieren, aber gerade darin fordert er sein Recht, das Recht des Todestriebes, die auf ihm errichteten Gebilde und Maschinen nicht stehen zu lassen, ohne sie zu verändern, ohne auf einen transzendentalen Code verwiesen zu werden. Der oK ist kein nützliches Computerprogramm, sondern ein sich selbst organisierender Virus, der gegen das feste Betriebssystem vorgeht. Er ist gegenüber dem Organismus parasitär[649], ohne ein Mangel zu sein. Deleuze ist kein Programmierer, sondern Hacker – und alle wissen, das Hacker nur unter Pseudonymen arbeiten, unpersönlich. Und doch gibt es eben den oK nicht ohne den Organismus gegen den er rebelliert; er ist keine Form eines primordialen oder unschuldigen Körpers, sondern kommt genau in dem Moment auf, in dem sich ein Organismus formt. Aber er formt sich eben nur als Falte des oK – nicht jenseits. Und, das hat Deleuze immer wieder betont, man muss sich hüten sich keinen leeren Körper zu gestalten, „[m]an muß genügend Organismus bewahren, damit er sich bei jeder Morgendämmerung neugestalten kann.“[650] Erneut, das Problem der Dosierung – man muss sich immer fragen, wieviel des organlosen Körpers lebbar ist. Die Bedeutung der Dosierung und das Paradox des Organismus ist eben genau dieses, „der Organismus ist nicht das Leben, er sperrt es ein“[651] und trotzdem erreicht er sein Ziel nie. Genauso wie bei Adorno die Herrschaft nur auf diese eine Sache zielt – den Tod (wirklich im Sinne von Entropie) – so kann sie sich doch nur erhalten, wenn sie ihr Ziel nicht erreicht,[652] wenn sie immer so nah wie möglich über Null schwebt. Ohne viel Aufruhr und doch nicht ganz tot. Ebenso will der Organismus den Tod des Lebens, in dem Sinne, dass er die freie Differenz ausschalten will, die ihn destabilisiert und mutieren lässt. „Der einzige moderne Mythos ist der Mythos der Zombies“ schreiben Deleuze und Guattari, der Mythos eines Lebens, welches sich in seinem eigenen Ausdruck sofort mit seinem Tod – dem Stillstand – ansteckt. Der Zombie-Organismus[653]; das Idealbild eines autarken Lebens, das das Leben selbst vernichtet, indem es dieses um der Erhaltung willen selbst erhält. Will man sich einen organlosen Körper schaffen, dann geht es nicht darum sich jenseits des Organismus anzusiedeln, sondern ihn aus diesem Raum der Intensitäten, die er zulassen muss, um zu sein, aufzusprengen. Man muss die kleinen Dosen verstärken, und sehen, wie weit ein Organismus gehen kann und wie er auf diesem Weg anorganisch wird. Womit der Wendepunkt erreicht ist, der die Frage selbst umkehrt. Unversehens geht es nicht mehr um Organismen als Tiere oder Menschen, sondern um Formen der Organisation und Desorganisation, Formen der Territorialisierung, Deterritorialisierung und Reterritorialisierung, kurz, um Formen des Werdens, von denen das Organisch-Werden nur eine (und begrenzte) ist, und deren End genauso wie ein Anfangspunkt nicht feststeht. Aristoteles und Kant glauben noch an ein Organisch-Sein und überdecken damit die Intensitäten die schon immer am Organismus zerren, während er sich ständig neu herstellen muss. Diese Umkehr, weg von der Frage der Substanz des Organischen oder Anorganischen, weg von der Frage des Wesens, stellt eher die Frage der Vermögen und Werdeweisen. Was vermag ein Körper, der sich von seiner organischen Schicht befreit wird, wenn sie von innen her aufbricht und das Fleisch „von den Knochen herabrutscht.“[654] Dann muss man das Sprechen neu lernen, um überhaupt noch etwas sagen zu können. Man wird eine neue Stimme lernen müssen, die uns unsere Eltern und Vorfahren nicht vorleben können. Jene wunderbare Stimme, der vierten Person Singular.
Einführende Schlussbemerkung: Maschinenlärm und Schizo-Kybernetik
„Diese Schwingungen werden uns viele Perspektiven eröffnen, die dem Menschen unbekannt sind, und einige, die allem unbekannt sind, was wir als organisches Leben erachten. Wir werden das sehen, was die Hunde im Dunkeln anheulen und worauf die Katzen nach Mitternacht die Ohren spitzen.“[655]
Die Kreuzung des Organismus als Bild des Denkens und als Form der Organisation (oder Organisation der Form) von Substanzen, die beiden Zwangsbewegungen, die sich nahezu wie Sinn und Bedeutung verhalten, kann man nicht durch Trotz besiegen. Ein Denken, dass sich gegen den Organismus richtet und sich zerfetzt, endet wie Artaud in der Psychiatrie oder – und vielleicht ist das schlimmer – verfestigt den Organismus noch. Man muss die Bewegung des Organismus erst kennen, um Fluchtlinien um ihn herum und durch ihn hindurch zu finden. Man muss das Problem wiederfinden, welches den Organismus hervorgebracht hat und nach Lösungen suchen, die ihn vielleicht umrunden oder redundant machen. Man muss noch einmal im Entstehungsherd wühlen[656] und andere Anfänge finden. Aristoteles und Kant scheinen den Organismus an der zweifachen Linie auszurichten, deren manchmal überschneidende Koordinaten die Organisation und das Gottesgericht[657] sind; es ist die Frage, wie sich die komplexen Formen des Lebens organisieren und funktionieren können, so, wie sie es offensichtlich tun und die Fragen nach der Möglichkeit von Lebewesen, sie so zu organisieren, dass sie einem transzendenten Telos entsprechen können.
Aristoteles doppelte Linie von metaphysischer Spekulation und empirischer Naturwissenschaft des Lebens, legt bereits die Organismen als Gegenstand des Lebens fest, welcher durch die Spekulation legitimiert wird und vice versa. Er versammelt die Teile des Körpers, des sôma organikon, unter der psychḗ, womit der die wirkungsmächtige Zweck-Mittel-Relation erfindet, in der die Teile für und durch das Ganze, das Ganze jedoch auch für und durch die Teil bestehen. Jedoch wird er eine Hierarchie in diese Relation einführen, in der die psychḗ das Ruder übernimmt, um die Fähigkeit des Organismus gewährleistet, nach seinem Ergon zu leben. Jenseits dieser ethico-theologischen Hierarchisierung und zwischen den metaphysisch und empirischen Linien des Aristoteles, werden die Körper jedoch porös, geben ihre organische Integrität auf und enthüllen das Potential eines Lebens, das sich nicht mehr mit den organischen Lebewesen in Deckung bringen lässt. Kant wird den Untersuchungsgegenstand und das Prinzip der Zweck-Mittel-Relation des Organismus von Aristoteles übernehmen, den darin verborgenen Realismus jedoch transzendentalphilosophisch wenden und somit aus der Relation eine regulative Reflexionsmaxime für die Urteilskraft machen. Kants Antiphysik des Organismus wird ihn gegen den Mechanismus setzen und damit die Grenze zwischen Determinismus und Freiheit absolut machen. Besonders im Begriff der Teleologie und der Autopoiesis, die Kant in einer Radikalisierung Aristoteles als Eigenheiten des Organischen hinzufügt, zeigt sich die Tendenz Kants die genetische Dimension der Organismen, sowie die Möglichkeit von diskontinuierlichen Veränderungen auszuschließen, indem er sie von dem Feld trennt, dem sie entstammen und das sie deformiert. Darin zeigt sich das transzendentale Doppel, das Kant bereits in der Kritik der reinen Vernunft angelegt hatte und was nun in der Kritik der Urteilskraft wiederholt wird – aus der Empirie sammelt Kant Strukturen, die er rückwirkend als Bedingungen a priori bestimmen wird, ebenso wie der Organismus, der sich seine Bedingungen retrospektiv aneignet. Bereits hier wird die Kreuzung zwischen Organismus als Gegenstand und als Bild des Denkens besonders deutlich; die Verkürzung auf eine terra cognita.[658] Es sind aber bereits die Pflanzen, die laut Kant nicht mehr den Ansprüchen des Organischen genügen und auch die Tiere scheinen eine seltsame Zwischenzone zu bilden. Im Grunde ist es vielleicht nur der Mensch, der bei Kant im vollen Sinne organisch ist. Dies ist die anthropozentrische Verkapselung des Kantischen Organismus. Es gilt, sie offen zu legen; eben die Grauzonen in der Kantischen Konzeption aufzuzeigen, die ein anderes Leben vermuten lassen. Ein Leben, das sich dem Menschen wiedersetzt. Ein nicht menschliches, anorganisches Leben.
Auch wenn Deleuze die Organismen als die Feinde des Lebens bezeichnet und Aristoteles und Kant die Philosophen sind, die den Organismus wie keiner vor uns nach ihnen philosophisch legitimieren, sind sie doch keine Feinde, sondern Freunde des Lebens – dies ist kein Paradox oder Widerspruch. Vielmehr sind ihre Konzeptionen Maschinen, die das Denken über die Produktivität des Lebens erst ermöglichen und bereichern – beide sind Schöpfer. Doch sehen sich beide einer zweifachen Problematik ausgesetzt, erstens – wie man besonders bei Aristoteles sieht – ob man das Leben in seinen eigenen Begriffen denken kann, ohne es auf ein ihm äußerliches Prinzip zu beziehen; das heißt die Frage eines selbstreferentiellen Lebens. Beide sehen sich mit der offensichtlichen Aporie konfrontiert, dass sie ohne ein dem Leben transzendenten Prinzip die Genese des vielfältigen Lebens aus den heterogenen und unverbundenen Teilen der Materie nicht erklären können – ohne, dass es ein Prinzip gibt, dass sie homogenisiert, indem sie die Teile auf ein Ganzes – den Organismus – beziehen. Zweitens, sicherlich mit dem ersten Aspekt verwoben, wird diese Transzendenzbeziehung zum Ganzen noch ausgedehnt, indem nicht nur innerhalb des Organismus die organische Harmonie herrschen muss, sondern auch die Relationen der Organismen zum Ganzen des Seins, der Welt, Gott, der Vernunft gewahrt werden müssen. Das Leben in seinen eigenen Kategorien zu denken, das heißt zunächst jenseits der transzendenten Prinzipien, würde sie untergraben und entwerten. Es muss also zunehmend selbst auf diese Kategorien bezogen werden; jede Schwächung des transzendentalen Prinzips wird gleichzeitig als Schwächung des Lebens ausgelegt. Die Geburt des Ideals der Innerlichkeit und Geistigkeit, dem sich selbst Heidegger noch verpflichtet fühlt.[659]
Es ist eben genau dieses Ringen um ein immanentes Prinzip der Heterogenese und der Produktivität der Materie, das sich in der Object-Oriented-Philosophy, ebenso wie im Neovitalism ausdrückt. Dabei versucht Harman den Blick der Philosophie wieder auf die Potentiale der Dinge [objects] zu richten, welche im Laufe der Denkgeschichte immer wieder untergraben wurden. Aus Heideggers Zeuganalyse versucht er dafür die Autonomie der Dinge zu deduzieren, welche den Menschen (das Dasein) nicht brauchen und sich gegenseitig zuhanden sein können, sie also gegenseitig bestimmen. In dieser Interaktion gehen die Dinge – laut Harman – jedoch nie auf, da immer eine Seite des Dinges verborgen bleibt, und ein verstecktes Potential des Dinges bietet. Jedoch wird sich zeigen, dass auch diese Bewegung in das organische Paradigma der Autarkie der Dinge und im Abschneiden ihres Antezedens enden muss. Harman wird letztendlich die organische Repräsentation Leibniz‘ und Hegels vollenden, wenn er bis ins unendlich große und unendlich kleine Dinge setzt; ein mikro- und makroskopischer Organizismus. Auch Jane Bennett, versucht den Dingen das Leben wiederzugeben, indem er sie in eine affektive Immanenz einbettet, in der Dinge andere affektiv beeinflussen können. Um aber die Auflösung der Dinge innerhalb dieser affektiven Felder zu verhindern, wird sie jedoch den Begriff des Conativ von Spinoza wieder verwenden, um die Form der Dinge zu sichern. Eben diese Bewegung, den Dingen eine Art affektiver Spontanität und gleichzeitig conativer Selbsterhaltung zuzusprechen, führt zurück in eine Welt der Organismen und gesicherten Organisationen. Am deleuzianischsten will der Neovitalist Manuel DeLanda das anorganische Leben durch die virtuellen Potentiale erklären, welche sich nicht durch die aktualen Zustände erklären lassen. Allerdings ist der Status des Virtuellen bei DeLanda eher ambig; er schwankt zwischen einer Zwei-Welten-Theorie, in der sich die virtuellen Strukturen gegenüber den aktualen Mannigfaltigkeiten absolut setzen und nicht durch diese beeinflusst werden können. Seine Theorie der lebendigen Materie entbindet zwar die Materie von ihrem deterministischen und mechanischen Bann, jedoch ist die Konklusion DeLandas, der Materie ein Form der Spontanität – in der Form teleologischer Unvorhersehbarkeit – zuzuschreiben, was wiederum dem Anorganischen nur die Eigenschaften des Organischen zuspricht, welche es zuvor verloren hatte. Damit fallen diese Analysen weiterhin in die Matrix von Organischem und Anorganischen – jedoch nicht ohne das Tor für die Deleuzesche anorganische Vitalität aufzustoßen.
Deleuze wird letztendlich nicht – oder erst in zweiter Instanz – von diesem Leben des Anorganischen sprechen. Vielmehr wird er die Risse freilegen, die sowohl die anorganische wie organische Materie durchziehen und ein Leben evozieren, welches sich nicht annektieren lässt. Um die Bewegung Deleuze‘ zu rekonstruieren, nachzuvollziehen und vielleicht erst in seiner Entfaltung zu erfinden, war es notwendig sich in die Involute des Todestriebes zu begeben, wie Freud sie einst andeutete und Deleuze bis zum Äußersten radikalisiert. Nicht nur Freuds Idee eines Triebes, der dem Lustprinzip antagonistisch gegenüber steht, sondern vor allem seine weiterführende Spekulation auf den Ursprung dieses Triebes – den Willen zur Rückkehr ins Anorganische, Ruhige, in die Entropie – führt ihn bereits Jenseits des Lustprinzips. Deleuze wird genau in die Wunde dieser Spekulation stoßen, da Freud diesen Todestrieb von den Ego-Trieben aus gesehen als Gefahr und Verfall sehen kann. Auf zweifache Weise wird er dieses Paradigma aufbrechen. Einerseits durch das Entlarven der materialen Wiederholungsstruktur des Freudschen Todestriebes, bei der ein ursprünglicher Zustand wiederholt werden soll – welcher, so zeigt Deleuze, sich jedoch bei jeder Wiederholung verschiebt, da jeder Wiederholung einer Identität schon unzählige Differenzen vorausgehen, die die vermeintliche Identität nie verlassen. Andererseits wird er Freuds Modell des Todes angreifen, welches allein auf dem Aspekt des persönlichen Todes beruht, in dessen Perspektive der Tod ausschließlich als Zerstörung gesehen werden kann. Mit Blanchot setzt Deleuze dem Tod einen zweiten Aspekt hinzu; einen unpersönlichen und intensiven Tod, der sich in der reinen leeren Form der Zeit zeigt. Mit Hilfe dieser Konzeption wird Deleuze die transzendentale Illusion aufdecken auf der die Freudsche Konzeption beruht, jedoch nur um den Todestrieb in Richtung dieser intensiven Differenzen zu wenden, die nicht den Tod, sondern das Leben offenbaren; ein intensiven, anorganisches Leben, welches die Identitäten des Organismus beständig untergräbt, verschiebt und gegebenenfalls zerstört.
Es kündigt sich damit ein anderes Sprechen über das Anorganische an, in dem es nicht mehr um ein Anorganisch-Sein oder Organisch-Sein geht, sondern – insofern beide Identitäten schon immer auf den Differenzen beruhen, die sie ständig verschieben – kann man nur von einem Anorganisch-Werden des Organischen und einem Organisch-Werden des Anorganischen sprechen. Gilles Deleuze, das Anorganisch-Werden der Philosophie.
Es sind diese Zwischenräume, die es zu besetzen gilt, was konkret heißt, weder den Organismus noch sein dialektisches Gegenbild wählen; sondern, wie Kafka es bereits sagte, sich dem Kaiser gegen überstellen und ihm seine Wirkungslosigkeit zeigen, indem man andere Formen der Faltung findet, die nicht in der absoluten Organisation enden. Diese Formen werden nicht nur neue Substanzen fordern und hervorbringen, sondern es braucht eine neue Art des Denkens, ein Denken, das selbst maschinell, steinern, anorganisch und keimförmig wird; ein Denken an den Schnittkanten der Territorien, immer am Rande dessen was lächerlich ist – ohne Subjekt im Zentrum, und ohne die Abstraktheit der Formen. Man braucht ein Denken jenseits der Griechen. Ein Denken, das ihre Lösungen, aber ihre Probleme umgeht. Sicherlich weist dieses Denken auf eine post-transzendentale Philosophie hin, in der das Empirische und seine Bedingungen nicht mehr in binärer Opposition gegenüber stehen – transzendentaler Empirismus, wie Deleuze es einmal nannte.[660] Ein Programm das das Kosmisch-Werden Spinozas, das ungebrochene Denken der Immanenz einsetzt gegen das Paradigma der logischen Identitäten und statischen transzendentalen Bestimmungen Kants. Es wäre eine metallische Philosophie, ein maschinelles Denken – weder mechanisch, noch organisch. Der große Mechanismus Laplace‘ genauso wie der Weltorganismus des frühen Schelling sind beide noch Formen einer Homogenese, welche nur funktionieren, weil die Teile sich bereits unter einem abstrakten Prinzip vereinen. Wie gezeigt wurde müssen sie jenseits der Zeit ein Bollwerk errichten, welches der differenziellen Wiederholung – dem Todestrieb – wiedersteht und sich unverändert wiederholt; das Subjekt, die Form, das Gleichgewicht, das Wesen etc. Keines dieser Prinzipien wird von Deleuze dritten Synthese der Zeit verschont, nichts kann sich außerhalb der Zeit stellen, nichts existiert vor ihr noch jenseits von ihr. Keine Produktion ohne Verwandlung, keine Regeln ohne die Veränderung der sie entstammen. Guattari flüsterte es schon[661], und zusammen mit Deleuze wird es in einem manischen Geschrei enden, jene Produktion jenseits des Organismus und Mechanismus; die Heterogenese oder Maschine, denn es gilt „die Kraft der Wiederholung als eine maschinelle Kraft entfesseln.“[662] Selbst Derrida konnte bei aller Ablehnung nicht blind gegen die monströse Kraft der Maschine sein.[663] Die Weise wie sie aus den Materieströmen Energien entnehmen und Kanäle bilden,[664] wie sie Gefüge bilden, ohne Bauplan hat nichts von einem von der Materie selbst losgelösten Prinzip, sondern sind die Genese aus dem Verschiedenen, welches sie durch Affekte und Resonanzen verkettet, statt durch eine transzendente Kraft zusammenzwingt. Sie bauen sich zusammen und lachen über die Bedingungen, die sie einsperren wollen. Nicht nur beugen sie sich nicht den Codes, sondern sie sind a priori unbeugbar, weil sie gar nicht darauf bestehen, sich als sie selbst, in genau dieser Form zu erhalten – eine Form ist für sie eine temporäre Hülle und kein Ziel. Und wenn sie sie doch wiederholen, dann weiß man nie, ob es nicht eine Scherz oder eine Falle ist, so wie auch Deleuze und Guattari Tausend Plateaus nur noch als Scherz mit Namen und Inhaltsverzeichnis versehen[665] – heiliges maschinelles Lachen. In diesem vollkommen Aufgehen in der differenziellen Wiederholung lassen sie sich nicht mehr vom Todestrieb trennen: „Die Wunschmaschinen laufen nur als gestörte, indem sie fortwährend sich selbst kaputt machen.“[666] Der organlose Körper ist das Modell des Todes, welches die Maschinen stets wieder zerlegt und doch auch nur als falten auf sich hervorbringt, sie lassen sich nicht trennen. Ja der Todestrieb ist selbst eine Maschine, insofern er erst durch die differentielle Maschine der Intensitäten hervorgebracht wird:
“The death drive is not a desire for death, but rather a hydraulic tendency to the dissipation of intensities. In its primary dynamics it is utterly alien to everything human, not least the three great pettinesses of representation, egoism, and hatred. The death drive is Freud’s beautiful account of how creativity occurs without the least effort, how life is propelled into its extravagances by the blindest and simplest of tendencies, how desire is no more problematic than a river’s search for the sea.”[667]
Nichts Menschliches bleibt in den Maschinen zurück – dies ist nicht die Künstliche Intelligenzforschung wie wir sie heute kennen, die nur die symbolische Repräsentation des Menschen imitiert – sondern diese nicht menschlichen Potentiale freizulegen, entspricht vielmehr der Kybernetik der 1960er Jahre. Beer baut einen Computer aus Mäusen, der komplexe Aufgaben lösen kann und zusammen mit Pask untersucht er die nichtlineare Sensibilität von metallischen Ablagerungen zwischen Elektroden – uns versucht sogar sie zu trainieren. Als er sie aus seiner Wohnung hängt, erweisen sie sich erregbar für ein bestimmtes Geräuschspektrum, sie sind metallische Ohren und auch nicht. Sie sind keine Organe im organischen Körper, sondern eigene affektive Systeme, die vielleicht weit entfernt von der menschlichen Sensibilität arbeiten – Hörmaschinen ohne die Notwendigkeit für uns.[668] Ashby einen Apparat, der in der Lage war bei einem gewissen Ausschlag der ihm eingebauten Nadel „sich selbst zufällig neu [zu] konfigurier[en]“[669] und ein neues Gleichgewicht zu finden.[670] Sie besitzt eine ganz eigentümliche Vitalität, sich selbst zu programmieren. Diese Kybernetiker sind viel mehr Bastler als Wissenschaftler im akademischen Sinne. Sie setzen zusammen und betrachten das Resultat und was es vermag, ohne vorher die Grenzen der Möglichkeiten zu bestimmen.[671] Diese Schizo-Kybernetik[672] beruht nicht zuletzt auf der mehrwertigen Logik, die Gotthard Günther einst gegen die Aristotelische Logik aus der Kybernetik entwickelte.[673] Anstatt auf ihre körperliche, physische oder semiotische Identität zu bestehen, befreit sich die Maschinen mit dieser veränderten Logik aus den griechischen Zwängen, sie lässt sich allmählich an den Rändern nieder – Kanten überschneiden sich, die sich selbst deterritorialisierenden Maschinen hacken sich ein oder nicht. Jede Maschine kann sich an alle anderen anschließen; man kann ohne Probleme auch die Mensch-Maschine an größere anschließen und man wird irgendwann einsehen müssen, dass er schon immer nur durch die Maschinengefüge Mensch gewesen sein wird – ebenso jeder Organismus.[674] In diesem Überschwappen, Tauschen, Mutieren und Hacken von Maschinengefügen und Codes bildet sich etwas, das die Ränder der Gebiete nachfährt und Bewegungen bestimmt, ohne sich von den konkreten Gefügen zu lösen:
„Eine abstrakte Maschine an sich ist nicht physisch oder körperlich, und auch nicht semiotisch, sie ist diagrammatisch (sie kennt auch keine Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich). Sie wirkt durch Materie und nicht durch Substanz, durch Funktion und nicht durch Form. […] Eine abstrakte Maschine ist die reine Materie-Funktion – das Diagramm, unabhängig von Formen und Substanzen, von Ausdrücken und Inhalten, die es verbreiten wird.“[675]
Diese Maschine, welche sich nicht auf die konkreten reduzieren lässt und sich dennoch von ihnen trennt ist ein Inflexionspunkt, die schwungvolle Linie, die eine Erfindung der Metallurgie war, denn das Metall ist kein Material oder eine Form, sondern ein organloser Körper.[676] Auch die abstrakte Maschine und der organlose Körper lassen sich nicht trennen – und daher wird dem organlosen Körper den Maschinenlärm auf ihm auch nicht als etwas Äußerliches erscheinen, sondern als innerliches Prinzip, als Differenzmaschine, die ihn faltet. Dieses anorganische Leben der abstrakten Maschine ist noch unerforscht, denn es fällt mit seiner ethischen Dimension zusammen – mit der Frage der Dosierung, des Ertragens genauso wie der der Überfülle – dieses Lärms der Maschinen und ihrem Schweigen.[677] Denn gerade da, wo das Leben nicht vereinnahmt werden kann, begegnen wir ihm – gerade in seiner Unlebbarkeit und Gewalt muss man es begreifen, weil eben dies seine Glückseligkeit ist.[678] Man wird noch einmal anfangen müssen, nicht eine theoretische Anorganik des Denkens aufzustellen, sondern das Denken selbst anorganisch zu machen.
Die Frage des anorganischen Lebens wird immer die sein, ob wir es noch vermögen.
Literaturverzeichnis
Abel, Günther: Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr. De Gruyter: Berlin 1998
Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1966
Adorno, Theodor W.: „Fortschritt“ in: Stichworte, Kulturkritik und Gesellschaft II. Gesammelte Schriften Bd. 10.2. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977
Agamben, Giorgio: Homo Sacer. Die Souveränität der Macht und das nackte Leben. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2002
Agamen, Giorgio: Profanierungen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005
Agamben, Giorgio: Das Offene. Der Mensch und das Tier. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2003
Alliez, Eric: „Ontology and Logography“ in: Patton, Paul / Protevi, John: Between Deleuze and Derrida. Continuum: London, New York 2003
Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen. Band I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. C.H. Beck: München 1956
Aristoteles: Topik. Reclam: Stuttgart 2004
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Reclam: Stuttgart 1986
Aristoteles: Politik. Deutscher Taschenbuch Verlag: München 1976
Aristoteles: Metaphysik. Schriften zur ersten Philosophie. Reclam: Stuttgart 1991
Aristoteles: Aristotle. The complete works. InteLex Corporation: Charlottesville 1997
Aristoteles: Aristoteles’ Naturgeschichte der Thiere. Zehn Bücher. Langenscheidt: Berlin 1914
Aristoteles: Über die Teile der Lebewesen. Oldenburg Akademieverlag: Berlin 2007
Aristoteles: Von der Zeugung und Entwicklung der Tiere. Scientia Verl.: Aalen 1978
Aristoteles : Über Werden und Vergehen, Meiner: Hamburg 2011
Aristoteles: Über die Seele. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 1968
Aristoteles: Über die Seele. Griechisch/Deutsch. Reclam: Stuttgart 2011
Artaud, Antonin: Schluß mit dem Gottesgericht. Matthes & Seitz: München 1993
Ashby, Ross: Design for a brain. Chapman&Hall: London 1960
Ashby, Ross: Einführung in die Kybernetik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985
Bachmann, Ingeborg: „Unter Mördern und Irren“ in: ders.: Das Dreißigste Jahr. Piper: München 2008
Badiou, Alain: Theoretical Writings. Continuum: London 2004
Balibar, Etienne: Spinoza. From Individuality to Transindividuality. Eburon: Delft 1997
Ballauff, Theodor: Die Wissenschaft vom Leben. Eine Geschichte der Biologie. Alber: Freiburg 1954
Barthélémy, Jean-Hugues: “Simondon – Ein Denken der Technik im Dialog mit der Kybernetik” in: Hörl, Erich: Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2012, S.93-109
Bataille, George: „Der Begriff der Verausgabung“ in: ders.: Aufhebung der Ökonomie. Fink: München 1985
Beer, Stafford: Kybernetik und Managment. Fischer-Verlag: Frankfurt am Main 1967
Beistegui, Miguel de: Truth and Genesis. Indiana University Press: Bloomington 2004
Benjamin, Walter: „Erfahrung und Armut“ in: ders: Gesammelte Schriften II/1. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977
Benjamin, Walter: Anmerkungen zu „Franz Kafka: Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages“ (1934) in: Gesammelte Schriften II, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977
Bennett, Jane: Vibrant Matter. A political ecology of things. Duke University Press Books 2009
Bennett, Jane: “The agency of assemblages and the North American blackout”, in de Vries, Hent / Sullivan, Lawrence E.: Political theologies public religions in a post-secular world. Fordham University Press: New York 2006
Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist. Meiner: Hamburg 1991
Bhaskar, Roy: Scientific Realism and Human Emancipation. Verso: London 1987
Bichat, Xavier: Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. Friedrich Brummer: Kopenhagen 1802
Blanchot, Maurice: Warten, Vergessen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1987
Blanchot, Maurice: L’espace littéraire. Gallimard: Paris 1955
Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985
Blumenberg, Hans: „Sokrates und das objet ambigu“ in: ders.: Ästhetische und metaphorologische Schriften. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001
Blumenthal, Henry: Aristotle and Neoplatonism in late antiquity. Interpretations of the De anima. Cornell Univ. Press: Ithaca 1996
Bogost, Ian: Alien Phenomenology, or What It’s like to be a Thing. University of Minnesota Press: Minneapolis 2012
Böhler, Arno: „Staging Philosophy. Toward a Performance of Immanent Expression“, in: Cull, Laura / Lagaay, Alice (Hg.): Performance and Philosophy. Palgrave Macmillan: Hampshire 2014
Böhme, Gernot: Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp: Frankfurt am Main: 1992
Boothby, Richard: Death and Desire. Routledge: London 1991
Bos, Abraham: “The tongue is not the soul’s instrument for tasting in Aristotle. On the Soul II” in: Hermes (no.140), S.375-385
Braidotti, Rosi: The posthuman. Polity Press: Cambridge, England, Malden, Massachusetts 2013
Bryant, Levi: The Democracy of Objects. Open Humanities Press: Ann Arbor 2011
Brassier, Ray: Nihil Unbound. Enlightenment and Extiction. Palgrave: London 2007
Brassier, Ray: „Solare Katastrophe. Die Wahrheit der Auslöschung“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013
Brassier, Ray: “Stellar Void or Cosmic Animal?” in: Fincham, Richard / Kollias, Hector: Crises of the transcendental. From Kant to Romanticism. University of Warwick: Coventry 2000
Brentano, Franz: Über Aristoteles: Nachgelassene Aufsätze. Meiner: Hamburg 2013
Brun, Rudolf: „Über Freuds Hypothese vom Todestrieb“ in: Psyche, (7/2), 1953, S. 81 – 111
Bruno; Giordano: Von der Ursache, dem Anfangsgrund und dem Einen. Eugen Diederrichs Verlag: Jena 1906.
Burroughs, William S.: Naked Lunch. Die ursprüngliche Fassung. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 2011
Buzzati, Dino: Die Tatarenwüste. Reclam: Leipzig 1982
Calvino, Italo: Der Ritter, den es nicht gab. Dt. Taschenbuch-Verlag: München 1990
Canguilhem, George: Die Erkenntnis des Lebens. Merve: Berlin 2009
Carlin, Garry / Allen, Nicola: „Slime and Western Man. H.P.Lovecraft in the Time of Modernism“ in: Simmons, David (Hg.): New Critical Essays on H.P. Lovecraft. Palgrave: London 2013
Châtelet, Gilles: Figuring Space. Philosophy, Mathematics and Physics. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht 2000
Clausius, Rudolph: Abhandlung über mechanische Wärmetheorie. Friedrich Vieweg und Sohn: Braunschweig 1867
Cook, James: „Der Conatus: Dreh-und Angelpunkt der Ethik.“ In: Hampe, Michael / Schnepf, Robert: Baruch de Spinoza. Ethik. Akademie Verlag: Berlin 2006
Caygill, Howard: „The Survival of Nihilism“ in: Pearson, Keith Ansell / Morgan, Diana: Nihilism Now! Monsters of Energy. Maximilian Press: London 2000
Däuker, Helmut: Bausteine einer Theorie des Schmerzes. LIT-Verlag: Münster 2002
David-Ménard, Monique: Deleuze und die Psychoanalyse. Ein Streit. Diaphanes: Zürich 2009
DeLanda, Manuel: A Thousand Years of Non-Linear History. Zero-Book: New York 1997
DeLanda, Manuel: “Nonorganic Life” in: Crary, Jonathan / Kwinter, Sanford (Hg.): Zone 6. Incorporations, Urzone: New York 1992, S.129-167
DeLanda, Manuel: Deleuze. History and Science. Atropos Press 2010
DeLanda, Manuel: “Delanda – Deleuze, Diagrams and the Genesis of Form” in: ANY.Architecture New York 23. Diagram Work. Data Mechanics for a Topological Age. (Juni 1998)
DeLanda, Manuel: Intensive Science and Virtual Philosophy. Bloomsburry: London 2013
DeLanda, Manuel: “Deleuze in Phase Space” in: ders.: Deleuze. History and Science. Atropos Press 2010
Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung. Fink: München 1992
Deleuze, Gilles: Unterhandlungen. 1972 – 1990. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1993
Deleuze, Gilles: Logik des Sinns. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1993
Deleuze, Gilles: Francis Bacon – Logik der Sensation. Fink: München 1995
Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1984
Deleuze, Gilles: Foucault. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1995
Deleuze, Gilles: Spinoza. Praktische Philosophie. Merve: Berlin 1988
Deleuze, Gilles: Das Zeit-Bild. Suhrkamp-Taschenbuch-Verl: Frankfurt am Main 1999
Deleuze, Gilles: Henri Bergson zur Einführung. Junius: Hamburg 2007
Deleuze, Gilles: Nietzsche und die Philosophie. Europ. Verl.-Anst: Hamburg 1991
Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Merve-Verl: Berlin 1992
Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Suhrkamp: Frankfurt am Main 1996
Deleuze, Gilles: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. Fink: München 1993
Deleuze, Gilles: Kants kritische Philosophie. Die Lehre von den Vermögen. Merve: Berlin 2008
Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Suhrkamp: Frankfurt am Main 1996
Deleuze, Gilles: David Hume. Campus Verlag: Frankfurt am Main 1997
Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2000
Deleuze, Gilles: „Vier Thesen über die Psychoanalyse“ in: ders: Schizophrenie und Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005
Deleuze, Gilles: „Immanenz. Ein Leben …“ in: Balke, Friedrich. / Vogl, Joseph: Gilles Deleuze. Fluchtlinien der Philosophie. Fink: München 1996
Deleuze, Gilles: „Sacher-Masoch und der Masochismus“ in: Sacher-Masoch, Leopold von: Venus im Pelz. Insel-Verlag: Frankfurt am Main 1980
Derrida, Jacques: Die Postkarte. Von Sokrates bis an Freud und jenseits. 2. Lieferung. Brinkmann: Berlin 1987
Derrida, Jacques: Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität«. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1991
Derrida, Jacques: Dissemination.Passagen Verlag: Wien 1995
Derrida, Jacques: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression. Brinkmann: Berlin 1997
Derrida, Jacques: Grammatologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1983
Derrida, Jacques: Jedes Mal einzigartig, das Ende der Welt. Passagen-Verl: Wien 2007
Derrida, Jacques: Without alibi. Stanford University Press: Stanford 2002
Derrida, Jacques: „Die Signatur aushöhlen – Eine Theorie des Parasitären“ in: Pfeil, Hannelore / Jäck, Peter: Politiken des Anderen. Hanseatischer Fachverlag für Wirtschaft: Rostock 1995
Descartes, René: Philosophische Schriften in einem Band. Felix Meiner Verlag: Hamburg 1996
Dick, Philip K.: Bladerunner. Heyne: München 2002
Dostoevskij, Fedor M.: Der Grossinquisitor. Insel-Verl.: Frankfurt am Main, Leipzig 2003
Doyle, Sir Arthur Conan: The lost world & other Stories. Wordsworth Editions: Hertfortshire 1995
Eigen, Manfred / Winkler, Ruthild: Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall. Piper: München 1975
Engels, Friedrich: „Dialektik der Natur“ in: Marx, Karl / Friedrich, Engels: Werke. Bd. 20. Dietzel-Verlag: Berlin 1962
Falk, Gottfried / Ruppel, Wolfgang: Energie und Entropie. Springer-Verlag: Berlin 1976
Fechner, Gustav Theodor: Über die physikalische und philosophische Atomenlehre (1855). Kessinger Pub Co.: Whitefish 2010
Ferlinghetti, Lawrence: Un regard sur le monde. Bourgeoise: Paris 1970
Fisher, Mark: Flatline constructs. Gothic materialism and cybernetic theory-fiction. University of Warwick 1999
Fisher, Mark: Capitalist realism. Is there no alternative? Zero Books: Winchester 2009
Fodor, Jerry: Representations: Essays on the Foundations of Cognitive Science, Harvard Press: Cambridge 1979
Frank, Manfred / Zanetti, Véronique: „Innere und äußere Zweckmäßigkeit. Kants Theorie der belebten Natur und der Natur als Gesamtorganismus“ in: ders.: Immanuel Kant. Schriften zur Ästhetik und Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001
Förster, Heinz von: Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie. Carl Auer Verlag: Heidelberg 2005
Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1994
Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1973
Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2012
Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips. Reclam: Leipzig 2013
Freud, Sigmund: „Ergebnisse, Ideen, Probleme (London, Juni 1938)“ in: ders.: Schriften aus dem Nachlaß 1892-1938. Gesammelte Werke Bd.17. Fischer Verlag: München 1951
Freud, Sigmund: „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten“ in: Werke aus den Jahren 1913-1917. Gesammelte Werke Bd.10. Fischer: Frankfurt am Main 1946
Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur“ in: ders.: Fragen der Gesellschaft. Studienausgabe Bd.9. Fischer Taschenbuch Verl.: Berlin 1989
Freud, Sigmund: „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ in: ders.: Fragen der Gesellschaft. Studienausgabe Bd.9. Fischer Taschenbuch Verl.: Berlin 1989
Fromm, Erich: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Deutsche Verlags Anstalt: Stuttgart 1974
Gibson, William: Die Neuromancer-Trilogie. Heyne: München 2014
Goldberger, Ary / Rigney, David: “Chaos and Fractals in Human Physiologie” in: Scientific American. (no.262.2), Februar 1990
Goldstein, Kurt/ Rosenthal, Otto: Zum Problem der Wirkung der Farben auf den Organismus. Schweizer Archiv für Neurologische Psychiatrie. Vol.26, 1930
Gondek, Hans Dieter / Tengelyi, László: Neue Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2011
Gould, Stephen Jay: Ontogeny and Phylogeny. Harvard University Press: Cambridge 1977
Goy, Ina: „Die Teleologie der organischen Natur (§§ 64-68)“ in: Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft. Akademie-Verlag: Berlin 2008
Grant, Iain: “The Chemestry of Darkness” in: Fincham, Richard / Kollias, Hector: Parallel Process: Philosophy and Science. University of Warwick: Coventry 2000
Grant, Iain: Philosophers of Nature after Schelling. Bloomburry: London 2006
Grant, Iain: „Sein und Schleim“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013
Grant, Iain: „Burning AutoPoiOedipus“ in: Abstract Culture. Swarm (no.2.), 1999
Gratton, Peter: Speculative Realism. Problems and Prospects. Bloomsburry: London 2014
Grice, Herbert P.: Studies in the way of words. Harvard University Press: Cambridge, 1989
Guattari, Félix: Die drei Ökologien. Passagen-Verl: Wien 1994
Günther, Gotthard: Das Bewusstsein der Maschinen. Eine Metaphysik der Kybernetik. Agis-Verl: Krefeld 1963
Guzzoni, Ute: Unter anderem: die Dinge. Karl-Alber-Verlag: Freiburg-München 2008
Haeckel, Ernst: Prinzipien der Generellen Morphologie der Organismen. Reimer: Berlin 1866
Haken, Hermann: Synergetics. An Introduction. Springer: Berlin 1978
Hammacher, Klaus: Spinoza und moderne Wissenschaft. Königshausen&Neumann: Würzburg 1998
Hampe, Michael: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2007
Harman, Graham: “On the Undermining of Objects. Bruno, Grant and Radical Philosophy” in: Bryant, Levi R. / Srnicek, Nick / Harman, Graham: The speculative turn. Continental materialism and realism. re.press: Melbourne 2011
Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures. Essays and lectures. Zero Books: Ropley 2010
Harman, Graham: Guerrilla Metaphysics. Phenemenology and the Carpentry of Things. Open Court Pub Co: Chicago 2005
Harman, Graham: Weird Realism. Lovecraft and Philosophy. Zero books: Winchester 2012
Harman, Graham: Bells and Whistles. More Speculative Realism. Zero Books: Winchester 2013
Hartmann, Nicolai: Die Philosophie des deutschen Idealismus. De Gruyter: Berlin
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Jenaer Kritische Schriften (III). Meiner: Hamburg 1986
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1930. Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986
Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Gesamtausgabe Bd.3. Klostermann: Frankfurt am Main 1991
Heidegger, Martin: „Zeit und Sein (1962)“ in: ders: Zur Sache des Denkens. Klostermann: Frankfurt am Main 2007
Heidegger, Martin: Wegmarken. Gesamtausgabe Bd. 9. Klostermann: Frankfurt am Main 2004
Heidegger, Martin: Holzwege. Gesamtausgabe 5. Vittorio-Klostermann: Frankfurt am Main 2004
Heidegger, Martin: “Der Ursprung des Kunstwerks” in: ders: Holzwege. Gesamtausgabe 5. Vittorio-Klostermann: Frankfurt am Main 2004
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Niemeyer: Tübingen 1993
Heidegger, Martin: Was heißt Denken? Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1954
Heidegger, Martin: Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Wintersemester 1929/1930). Gesamtausgabe 29/30. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main 2004
Heidegger, Martin: Nietzsche. Gesamtausgabe Bd. 6.1. Klostermann: Frankfurt am Main 1997
Heidegger, Martin: Das Ding“ in: ders: Vorträge und Aufsätze. Gesamtausgabe Bd.7. Klostermann: Frankfurt am Main 2000
Heidelberger, Martin: „Selbstorganisation im 19.Jahrhundert“ in: Kron, Wolfgang / Küppers, Günther: Selbstorganisation. Aspekte einer wissenschaftlichen Revolution. Vieweg: Wiesbaden 1990
Henry, Michel: Radikale Lebensphänomenologie. Alber-Verlag: Freiburg im Breisgau 1992
Hobbes, Thomas: Vom Menschen – Vom Bürger. Elemente der Philosophie II und III. Meiner: Hamburg 1994
Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Fischer: Frankfurt am Main 2011
Hume, David: Dialoge über natürliche Religion. Meiner: Hamburg 1968
Hume, David: Untersuchungen über die Prinzipien der Moral. Meiner: Hamburg 2003.
Hunemann, Philippe: “Introduction” in: ders.: Understanding purpose. Collected essays on Kant and the Philosophy of Biology. University of Rochester: Rochester 2007
Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie der Subjektivität. Husserliana XV. Martinius Nijhoff: Den Haag 1973
Husserl, Edmund: Texte zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917). Meiner Verlag: Hamburg 1985
Husserl, Edmund: „Philosophie als strenge Wissenschaft“ in: Gesammelte Schriften. Bd.8. Meiner: Hamburg 1999
Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Husserliana IV. Martinius Nijhoff: Den Haag 1952
Hutton, James: “Theory of the Earth; or an Investigation of the Laws observable in the Composition, Dissolution and Restauration of the Land upon the Earth” in: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1788, (no.1)
Iberall, Arthur: Toward a General Science of Viable Systems. McGraw Hill: New York 1972
Ingensiep, Hans Werner: „Organismus und Leben bei Kant“ in: Ingensiep, Hans Werner / Baranzke, Heike: Kant Reader. Könighausen&Neumann: Würzburg 2004
Jahn, Ilse: Geschichte der Biologie, Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. Gustav Fischer Verlag: Jena 1982
James, William: Der Pragmatismus: Ein neuer Name für eine alte Denkmethode. Meiner: Hamburg 1994
Jaspers, Karl: Schelling: Größe und Verhängnis. Piper: München 1955
Jonas, Hans: Organismus und Freiheit. Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen 1973
Jonas, Hans: „Spinoza and the theory of the organism“ in: Journal of the History of Philosophy 3(1)
Jullien, François: Sein Leben nähren. Abseits vom Glück. Merve-Verl: Berlin 2006
Kafka, Franz: Tagebücher 1910 – 1923. Fischer: Frankfurt am Main 1983
Kafka, Franz: Der Prozeß. Fischer Taschenbuch Verl.: Frankfurt am Main 1979
Kafka, Franz: „Die Sorge des Hausvaters“ in: ders.: Gesammelte Werke. Bd.5. Fischer-Verlag: Frankfurt am Main 1996
Kafka, Franz: „Gibs auf!“ in: Sämtliche Erzählungen. Anaconda-Verlag: Köln 2007
Kant, Immanuel: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kant, Immanuel: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Petersen: Königsberg-Leipzig 1755
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1902
Kant, Immanuel: Physische Geographie. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kant, Immanuel: Logik. Handschriftlicher Nachlass. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900
Kierkegaard, Søren: Die Wiederholung. Meiner: Hamburg 2000.
Kierkegaard, Søren: Der Begriff Angst ;. Vorworte. Grevenberg Verlag Dr. Ruff & Co.: Simmerath 2003
Kleber, Karsten: Der frühe Schelling und Kant. Zur Genese des Identitätssystems aus philosophischer Bewältigung der Natur und Kritik der Transzendentalphilosophie. Königshausen&Neumann: Würzburg 2013
Kojeve, Alexander: Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the Phenomenology of Spirit. Cornell University Press: Ithaca 1980
Köveker, Dietmar: ChronoLogie. Texte zur französischen Zeitphilosophie des 20. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 2000
Kreines, James: „The Inexplicability of Kant’s Naturzweck. Kant on Teleology, Explanation and Biology“ in: Archiv für Geschichte und Philosophie (87), 2005
Kullmann, Wolfgang: Die Teleologie in der aristotelischen Biologie. Carl Winter: Heidelberg 1979
Lacan, Jacques: Die Ethik der Psychoanalyse. Seminar VII. Quadriga: Berlin 1986
Lacan, Jacques: „Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse“ in: ders.: Schriften I. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1975
Lacan, Jacques: „Das Drängen des Buchstaben und die Vernunft sein Freud“ in: ders.: Schriften II. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1975
Lacan, Jacques: Das Seminar X. Die Angst, 1962 – 1963. Turia + Kant: Wien 2010
Land, Nick: Fanged Noumena. Collected writings 1987-2007. Urbanomic: Windsor Quarry 2012
Land, Nick: The thirst for Annahilation. George Bataille and Virulent Nihilism. An Essay in Atheistic Religion. Taylor&Francis: London 1992
Laruelle, François: Philosophy of Difference. A Critical Introduction to Non-Philosophy. Continuum: New York 2010
Latour, Bruno: „Irreductions“ in: ders.: The Pasteurization of France. Harvard University Press: Cambridge 1988.
Latour, Bruno: Reassembling the social. An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press: Oxford, New York 2005.
Le Guin, Ursula K.: Die linke Hand der Dunkelheit, Heyne: München 2014
Leibniz, Gottfried: Monadologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2007
Leiss, Elisabeth: Sprachphilosophie. De Gruyter: Berlin 2012
Lennox, James: Aristotle’s Philosophy of Biology. Cambridge University Press: Cambridge 2001
Lenoir, Timothy: „Kant, Blumenbach and Vital Materialism in German Biology“ in: Isis. (no.71), 1980
Levinás, Emmanuel: Die Zeit und der Andere. Meiner: Hamburg 1984
Lindner, Eckardt: „Und noch einmal – das Einzigartige. Über ddas Neue als Norm“ in: Lindner, Eckardt / Quent, Marcus: Das Versprechen der Kunst. Aktuelle Zugänge zu Adornos ästhetischer Theorie. Turia + Kant: Wien 2014
Lorraine, Tamsin: „Lining a Time out of Joint“ in: Patton, Paul / Protevi, John: Between Deleuze and Derrida. Continuum: London, New York 2003
Lovecraft, Howard P.: Chronik des Cthulu Mythos I. Festa: Leipzig 2011
Lovecraft, Howard P.: „Die Farbe aus dem All“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013
Lovecraft, Howard P.: “Der Schatten aus der Zeit“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013
Lovecraft, Howard P.: “Aus dem Jenseits” in: Lovecraft, Howard P.: Die lauernde Furcht. Horrorgeschichten. Festa: Leipzig 2013
Luther, Martin: „Gott selbst liegt tot“ in: Becker, Hansjakob: Geistliches Wunderhorn: Große deutsche Kirchenlieder. C.H. Beck: München 2009
Lyotard, Jean-François: „Newman, der Augenblick“ in: ders: Das Inhumane. Passagen Verlag: Wien 1989
Lyotard, Jean-François: Libidinöse Ökonomie. Diaphanes: Zürich-Berlin 2007
Lyotard, Jean-François: „Anima Minima“ in: Welsch, Wolfgang: Die Aktualität des Ästhetischen. Fink Verlag: München 1993
Lyotard, Jean-François: „Materie und Zeit“ in: Lyotard, Jean-François: Das Inhumane. Plaudereien über die Zeit. Passagen-Verl.: Wien 2006
Macherey, Pierre: Hegel ou Spinoza, Découverte: Paris 1990
Mainzer, Klaus: Leben als Maschine. Von der Systembiologie zur Robotik und Künstlichen Intelligenz. Mentis: Paderborn 2010
Malabou, Catherine: The Future of Hegel. Temporality, Plasticity and Dialectic. Routledge: London 2005
Margulis, Lynn / Sagan, Dorion: What is life? Simon & Schuster: New York 1995
Marion, Jean-Luc: Being Given. Toward a Phenomenology of Givenness. Stanford University Press: Stanford 2002
Marion, Jean-Luc: Dieu sans l’être. Presses univ. de France: Paris 1991
Massumi, Brian: A User‘s Guide to Capitalism and Schizophrenia. MIT-Press: Cambridge 1992
Maturana, Humbert: Autopoesis and Cognition. The Realisation of the Living. D. Reidel Publishing Company: Boston 1980
Meillassoux, Quentin: Nach der Endlichkeit. Versuch über die Notwendigkeit der Kontingenz. Diaphanes: Zürich 2008
Meillassoux, Quentin: „Subtraction and Contraction. Deleuze, Immanence and Matter and Memory” in: Mackay, Robin (Hg.): Collapse III. Unknown Deleuze. Urbanomic: Falmouth 2007
Mennicken, Peter: Die Philosophie des Nicolas Malebranche. Meiner: Leipzig 1927
Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. De Gruyter: Berlin 1966
Mersch, Dieter: Ordo ab chao – order from noise. Diaphanes: Zürich 2013
Moder, Gregor: Hegel und Spinoza.Negativität in der gegenwärtigen Philosophie. Turia+Kant: Wien 2013
Nancy, Jean-Luc: “Corpus” in: ders: The Birth of Presence. Stanford University Press: Stanford 1993
Nancy, Jean-Luc: Corpus. Diaphanes: Berlin 2003
Nancy, Jean-Luc: „Zeit gegen Raum“ in: Nancy, Jean-Luc: Das Gewicht eines Denkens. Parerga: Düsseldorf, Bonn 1995
Nancy, Jean-Luc: „Struktion“ in: Hörl, Erich (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Suhrkamp: Berlin 2011
Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Kritische Studienausgabe Bd. 4. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999
Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral. Kritische Studienausgabe Bd. 5. Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999
Nietzsche, Friedrich: Der Fall Wagner, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist / Ecce homo, Dionysos-Dithyramben / Nietzsche contra Wagner. Kritische Studienausgabe Bd. 6. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999.
Nietzsche, Friedrich: Morgenröte, Idyllen aus Messina, Die fröhliche Wissenschaft. Kritische Studienausgabe Bd. 3, Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999
Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1882-1884. Kritische Studienausgabe Bd. 10. Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999
Nietzsche, Friedrich: Nachgelasse Fragmente 1885-1887. Kritische Studienausgabe Bd. 12. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1988
Nietzsche, Friedrich: Nachgelasse Fragmente 1887-1889. Kritische Studienausgabe Bd. 13. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1988
Palmer, Richard: „Brocken Ergodicity“. In: Stein (Hg.): Lectures in the Science of Compexity, Addison-Wesley: New York 1989
Pearson, Keith Ansell: Germinal life. The difference and repetition of Deleuze. Routledge: London, New York 1999
Pearson, Keith Ansell: Viroid Life. Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition. Routledge: London 1997
Peirce, Charles Sanders: Naturordnung und Zeichenprozess. Schriften über Semiotik und Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1990
Perniola, Mario: Der Sex-Appeal des Anorganischen. Turia+Kant: Wien 1999
Pickering, Andrew: Kybernetik und neue Ontologien. Merve: Berlin 2007
Plessner, Helmut: Die Stufen des Organischen und der Mensch. de Gruyter: Berlin 1975
Plessner, Helmuth: „Die Utopie in der Maschine“ in: Dux, Günther / Marquard, Odo / Plessner, Helmut: Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985.
Portman, Adolf: Aufbruch der Lebensforschung. Rhein: Zürich 1965
Prigogine, Illya / Stengers, Isabelle: Order out of Chaos. Bantam: New York 1984
Prigogine, Illya / Stengers, Isabelle: Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Piper: München 1980
Protevi, John: “Deleuze and Emergence” in: Paragraph: A Journal of Modern Critical Theory. 29.2 (Juli 2006)
Quine, Willard Orman van: „Zwei Dogmen des Empirismus“ in: ders: Von einem logischen Standpunkt. Neun philosophische Essays. Ullstein: Frankfurt am Main 1979, S.27-50
Rank, Otto: Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse (1924). Psychosozial-Verlag: Giessen 2007
Reichert, André: Diagrammatik des Denkens. Transcript: Bielefeld 2013
Rentsch, Thomas: Martin Heidegger. Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung. Piper: München/Zürich 1989
Richards, Robert J.: “Kant and Blumenbach on the Bildungstrieb. A historical misunderstanding” in: Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, (no.31.), 2000
Rölli, Marc: Gilles Deleuze. Philosophie des transzendentalen Empirismus. Turia + Kant: Wien 2003
Rölli, Marc: „Begriffe für das Ereignis: Aktualität und Virtualität. Oder wie der radikale Empirist Gilles Deleuze Heidegger verabschiedet“ in: Rölli, Marc (Hg.): Ereignis auf Französisch. Von Bergson bis Deleuze. Fink: München 2004
Rölli, Marc: “Das Intensive denken. Überlegungen zum Paradox der Materialität mit Bezug auf Deleuze“ in: Köhler, Sigrid G. / Metzler, Jan Christian / Wagner-Egelhaaf, Martina: Prima Materia. Beiträge zur transdisziplinären Materialitätsdebatte. Helmer: Königstein im Taunus 2004
Römer, Inga: Das Zeitdenken bei Husserl, Heidegger und Ricoeur. Springer Science+Business Media B.V: Dordrecht 2010
Ruf, Simon / Kleinschmidt, Erich: Fluchtlinien der Kunst. Ästhetik, Macht, Leben bei Gilles Deleuze. Königshausen & Neumann: Würzburg 2003
Russel, Bertrand: The Principles of Mathematics. Norton: New York 1938
Ryle, Gilbert: “Descartes Myth” in: Chalmers, David: Philosophies of the mind. Classical and contemporary readings. Oxford University Press: Oxford 2002
Saar, Martin: Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza. Suhrkamp: Berlin 2013
Sade, Donatien-Alphonse-François de: Ausgewählte Werke. Bd.3. Merlin Verlag: Hamburg 1962
Saint-Hilaire, Etienne Geoffroy: „Divers mémoires sur des grands sauriens” in: Mémoires de l’Academie Royale des Sciences de l’Institute de France, (no.12), 1833
Scheler, Max: Die Wissensformen und die Gesellschaft. Francke: Berlin 1960
Schelling, Friedrich Wilhelm: Sämtliche Werke VIII. Cotta’scher Verlag: Stuttgart 1859
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Sämtliche Werke Bd.6, C.H. Beck Verlag: München 1973
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: „Ueber das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts“ in: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Ausgewählte Schriften. Band 3. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985
Schmitz, Hermann: Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Therapeutik. Junfermann: Paderborn 1992
Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Voltmedia: Paderborn 2006
Schrödinger, Erwin: Was ist Leben? Piper-Verlag: München 1989
Sellars, Wilfrid: Empiricism and the Philosophy of Mind. With an Introduction by Richard Rorty and a Study Guide by Robert Brandom. Harvard University Press: Cambridge 1997
Sellars, Wilfried: Philosophy and the Scientific Image of Man,” in: Colodny, Robert: Frontiers of Science and Philosophy. University of Pittsburgh Press: Pittsburgh 1962, S.35–78
Seneca, L. Annaeus: Naturales Quaestiones/Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1995
Serres, Michel: The Birth of Physics. Climanen Press: Manchester 2001
Shakespeare, William: Hamlet. Reclam: Leipzig 1974
Shaviro, Steven: “Interstial Life. Remarks on Causality and Purpose in Biology” in: Gaffney, Peter (Hg.): The Force of the Virtual. Deleuze, Science and Philosophy. Minnesota University Press: Minneapolis 2010
Simmel, Georg: „Der Henkel“ in: ders.: Philosophische Gesellschaft. Zweitausendundeins: Frankfurt am Main 2008
Singer, Peter: Animal Liberation. Befreiung der Tiere. Rowohlt: Hamburg 1996
Sloterdijk, Peter: Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1983
Smith, Cyril Stan: History of Metallurgy. Gordon&Breach Science Publishers: London 1966
Smith, Cyril Stan: A History of Metallography. The Development of Ideas on the Structure of metals before 1890. Chicago University Press: Chicago 1960
Somers-Hall, Henry: Deleuze’s Difference and Repetition. Edinburgh University Press: Edinburgh 2013
Sommer, Manfred: Lebenswelt und Zeitbewusstsein. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1990
Speiser, Andreas: „Naturphilosophische Untersuchungen von Euler und Riemann“ in: Journal für die reine und angewandte Mathematik. (Nr.157), 1927, S.105-127
Spinoza, Baruch de: Die Ethik. Reclam: Leipzig 2007
Spinoza, Baruch de: Descartes‘ Prinzipien der Philosophie in geometrischer Weise dargestellt. Meiner: Hamburg 2005
Stewart, Ian: Does God play Dice? The Mathematics of Chaos. Wiley-Blackwell: New York 2002
Sutter, Alex: Göttliche Maschinen. Die Automaten für Lebendiges bei Descartes, Leibniz, Le Mettrie und Kant. Athenaeum: Frankfurt am Main 1988
Thacker, Eugene: After life. University of Chicago Press: Chicago 2010
Thacker, Eugene: „After Life. De Anima and Unhuman Politics“ in: Radical Philosophy. (no.155)
Theodorakopoulos, Johannes: Die Hauptprobleme der platonischen Philosophie. Heidelberger Vorlesungen 1969. Martius Nijhoff: Den Haag 1972
Thies, Christian: „Beförderung des Moralischen durch das Ästhetische?“ in: Gerhard, Volker / Horstmann, Rolf-Peter: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. De Gruyter: Berlin 2001
Thom, René: Morphogenése et Imaginaire. Lettres Moderne: Paris 1978
Toepfer, Georg: Zweckbegriff und Organismus. Über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. Königshausen & Neumann: Würzburg 2004
Valéry, Paul: Eupalinos oder der Architekt. Rowohlt: Hamburg 1962
Vergil, Publius Marco: Georgica. Reclam: Stuttgart 1994
Vogts, Johann Gustav: Die Kraft. Eine real-monistische Weltanschauung. Haupt&Tischler: Leipzig 1878
Völker, Jan: Ästhetik der Lebendigkeit: Kants dritte Kritik. Fink-Verlag: München 2011
Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986
Waldenfels, Bernhard: Antwortregister. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1994
Weismann, August: „Zur Frage nach der Unsterblichkeit der Einzelligen“ in: Biologisches Centralblatt. Bd. 4, (Nr. 21), 1885
Welchman, Alistair: „Mechanic Thinking“ in: Pearson, Keith Ansell (Hg.): Deleuze and Philosophy. The Difference Engineer. Routledge: London 1997
Weyer, Johannes (Hg.): Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. Oldenbourg: München 2000
Whitehead, Alfred North: Modes of Thought. The Free Press 1968
Whitehead, Alfred North: Prozess und Realität. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1984
Wiener, Norbert: Mensch und Menschmaschine. Kybernetik und Gesellschaft. Metzler: Frankfurt am Main 1962
Wiener, Norbert: The human use of human beings. Cybernetics and society. Avon Books 1967
Williams, Robert: “Life is inorganic too” in: Nature. (Vol. 248), 22.März 1974
Woodard, Ben: Slime Dynamics, Zero Books: Winchester 2012
Yates, Richard: Revolutionary road. Vintage Books: New York 2008
Zechner, Ingo: Deleuze. Der Gesang des Werdens. Fink: München 2003
Zilsel, Edgar: „Philosophische Bemerkungen“ in: Zilsel, Edgar: Wissenschaft und Weltanschauung. Aufsätze 1929 – 1933. Böhlau: Wien 1998
Žižek, Slavoj: Körperlose Organe. Bausteine für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005
Žižek, Slavoj: The Plague of Fantasies. Verso: London 1997
Žižek, Slavoj: Die politische Suspension des Ethischen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005
Zupančič, Alenka: Odd one in: On Comedy. MIT-Press: London 2008
[1] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung. Fink: München 1992, S.330.
[2] Vgl. Valéry, Paul: Eupalinos oder der Architekt. Rowohlt: Hamburg 1962, S.127. Blumenberg hat diese Besonderheit des objet ambigu wunderschön beschrieben: Vgl. Blumenberg, Hans: „Sokrates und das objet ambigu“ in: ders.: Ästhetische und metaphorologische Schriften. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001, S.74-111.
[3] Simmel, Georg: „Der Henkel“ in: ders.: Philosophische Gesellschaft. Zweitausendundeins: Frankfurt am Main 2008, S.122.
[4] Deleuze unterscheidet klar zwischen der Geschichte und dem Werden eines Begriffs, die nicht deckungsgleich sind. Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Suhrkamp: Frankfurt am Main 1996, S.24.
[5] Vgl. Heidegger, Martin: Was heißt Denken? Max Niemeyer Verlag: Tübingen 1954, S.72.
[6] Zwei Richtungen, die sich aus dem Spekulativen Realismus entwickelt haben, der sich ausdrücklich auf Deleuze als Schutzpatron bezieht und die Deleuze auch positiv und negativ bei ihren Überlegungen zu Dingen, Materie und Leben aufnehmen.
[7] Deleuze nennt sein größtes Werk selbst einen Science Fiktion Roman. Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.aaO.11.
[8] Le Guin unterscheidet auch sehr luzide zwischen der Vorgehensweise der Futurologen, Hellseher und Propheten im Gegensatz zu den (Science Fiktion-) Schriftstellern. Und beschreibt die Aufgabe des Schriftstellers sehr Deleuzianisch: „Die Sache des Schriftstellers ist es zu lügen.“ Le Guin, Ursula K.: Die linke Hand der Dunkelheit, Heyne: München 2014, S.7.
[9] Der Hacker, der die großen Konzerne angreift und riskiert, dass sein Gehirn dabei zerstört wird. Vgl. Gibson, William: Die Neuromancer-Trilogie. Heyne: München 2014. Mark Fisher hat die Überscheidungen zwischen dem Roman von Gibson und Deleuze sehr klar gesehen und daraus einen „gothic materialism“ gemacht, der die Linie zwischen dem Leben und dem Tod durchquert – anorganisches Leben. Vgl. Fisher, Mark: Flatline constructs. Gothic materialism and cybernetic theory-fiction. University of Warwick 1999.
[10] Kafka, Franz: Der Prozeß. Fischer Taschenbuch Verl.: Frankfurt am Main 1979, S.104.
[11] Vgl. Toepfer, Georg: Zweckbegriff und Organismus. Über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. Königshausen & Neumann: Würzburg 2004, S.5.
[12] Obwohl viele Interpreten in Aristoteles den Begründer der Theorie des Organismus sehen wollen, gibt die Schrift des Aristoteles De Anima, dies jedoch gar nicht her. Aristoteles spricht in De Anima vom „Sôma organikon“ – was nicht „organisch“ bedeutet, sondern so viel wie „organisiert“ oder besser noch – und präziser – „zum Werkzeug geeignet“. Es erfüllt also die Organisationsbedingungen eine Tätigkeit auszuführen, muss aber dafür kein vollständiger Organismus sein. Dies spiegelt sich auch in den Übersetzungen wieder, wie „organized“ in Aristotle: Aristotle. The complete works. InteLex Corporation: Charlottesville 1997. und „mit Organen ausgestattet“ in Aristoteles: Über die Seele. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 1968.
[13] Für einen Überblick, wie sich der Titel zu De Anima wandelte: Vgl. Blumenthal, Henry: Aristotle and Neoplatonism in late antiquity. Interpretations of the De anima. Cornell Univ. Press: Ithaca 1996.
[14] Vgl. Thacker, Eugene: After life. University of Chicago Press: Chicago 2010, S.7.
[15] Dieser später gegebene Titel ist jedoch irreführen, weil er von der φύσις wegzuführen scheint, was jedoch nicht der Fall ist.
[16] Die Vielzahl von Aristoteles Schriften sind tatsächlich der Naturkunde gewidmet, wie zum Beispiel: – Aristoteles: Aristoteles’ Naturgeschichte der Thiere. Zehn Bücher. Langenscheidt: Berlin 1914; Aristoteles: Über die Teile der Lebewesen. Oldenburg Akademieverlag: Berlin 2007; Aristoteles: Von der Zeugung und Entwicklung der Tiere. Scientia Verl.: Aalen 1978; Aristoteles: Über Werden und Vergehen, Meiner: Hamburg 2011.
[17] Vgl. Ballauff, Theodor: Die Wissenschaft vom Leben. Eine Geschichte der Biologie. Alber: Freiburg 1954, S.35.
[18] Aristoteles: Über die Seele. Griechisch/Deutsch. Reclam: Stuttgart 2011, Buch I, 402a.
[19] Vgl. Thacker, Eugene: „After Life. De Anima and Unhuman Politics“ in: Radical Philosophy. (no.155), S.31-40.
[20] Aristoteles: Über die Seele, Buch II, 412a.
[21] aaO. Buch II, 412b.
[22] aaO.
[23] aaO.
[24] Bos, Abraham: “The tongue is not the soul’s instrument for tasting in Aristotle. On the Soul II” in: Hermes (no.140), S.375.
[25] Aristotles geht so weit auch die materielle Dimension, nicht nur die Form – die für ihn ohnehin untrennbar sind – auf die Funktion zu beziehen. Der Kehlkopf muss aus Knorpel sein, um die bestimmte Funktion auszuführen.
[26] Aristoteles: Über die Teile der Lebewesen. Oldenburg Akademieverlag: Berlin 2007, Buch I, 645b.
[27] Um die Wesensverschiedenheit hervorzuheben auch verschiedene Alphabete.
[28] Ein Problem, dass bei Kant und Cuvier wieder auftreten wird.
[29] Vgl. Aristoteles: Topik. Reclam: Stuttgart 2004, Buch I, 105a.
[30] Vgl. Aristoteles: Über die Seele, Buch II, 415a.
[31] Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Reclam: Stuttgart 1986, 1097b.
[32] Vgl. aaO. Buch I, 1097b.
[33] Vgl. Aristoteles: Über die Seele, Buch II, 415b.
[34] Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch I, 1098a
[35] Aristoteles: Politik. Deutscher Taschenbuch Verlag: München 1976, Buch I, 1260.
[36] Aristoteles: Über die Seele, S.59.
[37] Man kann also vermuten, dass sich in De Anima eine andere Spielart von Hylemorphismus versteckt als in den Werken zur Physis.
[38] Canguilhem, George: Die Erkenntnis des Lebens. Merve: Berlin 2009. S.155.
[39] Aristoteles: Metaphysik. Schriften zur ersten Philosophie. Reclam: Stuttgart 1991, Buch H, 1042a.
[40] Auch wenn diese erst im 18. Jh. mit Cuvier als eigenständiges Gebiet entsteht
[41] Ballauff, Theodor: Die Wissenschaft vom Leben, S.37.
[42] Vgl. Toepfer, Georg: Zweckbegriff und Organismus. Über die teleologische Beurteilung biologischer Systeme. Königshausen & Neumann: Würzburg 2004.
[43] Kullmann hat diesen Umstand erkannt. Vgl. Kullmann, Wolfgang: Die Teleologie in der aristotelischen Biologie. Carl Winter: Heidelberg 1979, 26ff.
[44] Vgl. Lennox, James: Aristotle’s Philosophy of Biology. Cambridge University Press: Cambridge 2001, S.102f.
[45] Aristoteles: Über die Seele, Buch II, 412b.
[46] Aristoteles: Über die Seele, 412b.
[47] Deleuze, Gilles: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. Fink: München 1993, S.170.
[48] aaO. S.171
[49] aaO.
[50] Vgl. Spinoza, Baruch de: Die Ethik. Reclam: Leipzig 2007, Buch I, Lehrsatz 24, S.63.
[51] Agamben, Giorgio: Homo Sacer. Die Souveränität der Macht und das nackte Leben. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2002, S.12, S.21 und S.191f.
[52] Die gesamte Debatte um die lebendige Maschine hat Sutter sehr klar dargestellt: Sutter, Alex: Göttliche Maschinen. Die Automaten für Lebendiges bei Descartes, Leibniz, Le Mettrie und Kant. Athenaeum: Frankfurt am Main 1988.
[53] Vgl. Leibniz, Gottfried: Monadologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2007, S.603.
[54] Daher ist die Begrenztheit der vom Menschen geschaffenen Maschinen kein Argument gegen die Gleichzeitigkeit der Zwecke und des Mechanismus in allen Naturdingen. Auch heute wird die Abgrenzung des Menschen (oder der Lebewesen) mit dem unzureichenden Argument des Mangels an den Maschinen begründet. Dabei ist das Argument, dass die aktuell existierenden Maschinen eine bestimmte für wichtig erklärte Eigenschaft nicht aufweisen und daher prinzipiell nicht in der Lage seien, diese zu erwerben, ein Gemeinplatz.. Dieser transzendentale Kurzschluss ist jedoch nicht zu rechtfertigen; nichts an der derzeitigen Begrenztheit der Maschinen lässt auf eine transzendentale Begrenztheit schließen. Maschinen sind offen.
[55] Ob Kant dies sekundär als Konsequenz der Analyse der Urteilskraft tut ist fraglich und hängt davon ab, wie viel Realismus man der Naturphilosophie Kants – wenn man überhaupt von einer solchen sprechen kann – zutrauen kann.
[56] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900, S.376.
[57] Goy, Ina: „Die Teleologie der organischen Natur (§§ 64-68)“ in: Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft. Akademie-Verlag: Berlin 2008. S.224.
[58] Vor allem Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. §61-§65.
[59] Vgl. Kleber, Karsten: Der frühe Schelling und Kant. Zur Genese des Identitätssystems aus philosophischer Bewältigung der Natur und Kritik der Transzendentalphilosophie. Königshausen&Neumann: Würzburg 2013, S.53.
[60] Leiss findet in Aristoteles sogar den extremsten und konsequentesten aller Realisten, weil er sowohl auf der realen Existenz der Einzeldinge als auch der Universalien besteht. Vgl. Leiss, Elisabeth: Sprachphilosophie. De Gruyter: Berlin 2012, S.27.
[61] Kleber, Karsten: Der frühe Schelling und Kant. S. 53.
[62] aaO. S.53.
[63] aaO. S.56.
[64] Kant, Immanuel: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900. S.467.
[65] Kleber, Karsten: Der frühe Schelling und Kant, S.54.
[66] Gleichzeitig behauptet er im §79, dass die Teleologie, doch eine Wissenschaft sei. Vgl. Richards, Robert J.: “Kant and Blumenbach on the Bildungstrieb. A historical misunderstanding” in: Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, (no.31.), 2000, S.27.
[67] Er widerspricht damit Wieners kybernetische Phantasie von der mathematischen Berechenbarkeit des Lebens. So ist für Wiener das entscheidende für die Identität die (berechenbare) Information. Vgl. Wiener, Norbert: Mensch und Menschmaschine. Kybernetik und Gesellschaft. Metzler: Frankfurt am Main 1962, S.26, S.99f. Was jedoch die Mathematik zum Verständnis des Lebens beitragen kann, ist noch nicht entschieden.
[68] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1902, B 3f.
[69] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.376.
[70] aaO.
[71] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.376.
[72] aaO. S.377.
[73] aaO..
[74] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.169.
[75] Thies, Christian: „Beförderung des Moralischen durch das Ästhetische?“ in: Gerhard, Volker / Horstmann, Rolf-Peter: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. De Gruyter: Berlin 2001, S.5.
[76] Kant, Immanuel: Logik. Handschriftlicher Nachlass. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900, S.127.
[77] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. A 168, B 209.
[78] Obwohl Kant in Sachen Epigenese schon die progressivere Position einnimmt, dass nicht allein die Anlagen das Lebewesen ausmachen, sondern auch die Umwelt auf die Entwicklung wirkt. Jedoch besteht Kant darauf – wie auch Aristoteles – dass die Umwelt nicht die Anlagen selbst bestimmt oder verändert, sondern lediglich dessen optimale Ausprägung fördert oder hindert. Vgl. Völker, Jan: Ästhetik der Lebendigkeit: Kants dritte Kritik. Fink-Verlag: München 2011, S.123.
[79] Vermutlich hatte Kant bei der Regeneration von Teilen eher die Selbstheilungsfähigkeiten von Süßwasserpolypen (Hydra) im Blick, die Trembley 1744 eindrucksvoll zur Schau stellte und die Kant wahrscheinlich kannte, als die Fähigkeiten des Baumes Äste nachwachsen zu lassen, obwohl er diesen nicht sehr effektiv als Beispiel anführt. Vgl. Jahn, Ilse: Geschichte der Biologie, Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. Gustav Fischer Verlag: Jena 1982, S.233f.
[80] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.372.
[81] Vgl. Frank, Manfred / Zanetti, Véronique: „Innere und äußere Zweckmäßigkeit. Kants Theorie der belebten Natur und der Natur als Gesamtorganismus“ in: ders.: Immanuel Kant. Schriften zur Ästhetik und Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2001, S.1276.
[82] Vgl. Hunemann, Philippe: “Introduction” in: ders.: Understanding purpose. Collected essays on Kant and the Philosophy of Biology. University of Rochester: Rochester 2007, S.5f.
[83] Goy, Ina: „Die Teleologie der organischen Natur (§§ 64-68)“, S.227.
[84] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.375.
[85] Grant sieht diese Bewegung bei Kant sehr deutlich und setzt Schellings Konzeption eines freien Spiels von Kräften dagegen. Vgl. Grant, Iain: “The Chemestry of Darkness” in: Fincham, Richard / Kollias, Hector: Parallel Process: Philosophy and Science. University of Warwick: Coventry 2000, S.45.
[86] Dieses Problem der Autopoiesis wird sich nicht nur in nahezu jeder Philosophie des Organischen übernommen.
[87] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.373.
[88] Vgl. Kant, Immanuel: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. S.544, S.394.
[89] Vgl. Kreines, James: „The Inexplicability of Kant’s Naturzweck. Kant on Teleology, Explanation and Biology“ in: Archiv für Geschichte und Philosophie (87), 2005.
[90] Offensichtlich bedenkt Kant die Möglichkeit überhaupt nicht, dass es sich bei der hylozoistischen Behauptung gar nicht um eine Analogie handelt. Die belebte Materie könnte sehr wohl selbst der Bildungstrieb sein.
[91] Vielmehr ist hier vermutlich die Theorien von Thomas von Aquin und dessen Auslegung der Aristotelischen Seelenlehre gemeint.
[92] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.375.
[93] Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900, S.414ff.
[94] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900, A 803, B 823.
[95] Lenoir, Timothy: „Kant, Blumenbach and Vital Materialism in German Biology“ in: Isis. (no.71), 1980, S.77-108.
[96] Grant, Iain: Philosophers of Nature after Schelling. Bloomburry: London 2006, S.15.
[97] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.400.
[98] Husserl, Edmund: „Philosophie als strenge Wissenschaft“ in: Gesammelte Schriften. Bd.8. Meiner: Hamburg 1999.
[99] Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986. S.548.
[100] Vgl. Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie der Subjektivität. Husserliana XV. Martinius Nijhoff: Den Haag 1973, S.297.
[101] Wie Plessner es einmal ausdrückt hat: Vgl. Plessner, Helmut: Die Stufen des Organischen und der Mensch. de Gruyter: Berlin 1975, S.294.
[102] Auch wenn eben diese These zu einer Vielzahl von Kritiken geführt hat, ist das Paradigma doch noch lange nicht aus der Phänomenologie gewichen. Selbst Husserl sucht nach diesen nicht-gegenständlichen Erfahrungen, wie beispielsweise den Empfindungen. Vgl. Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Husserliana IV. Martinius Nijhoff: Den Haag 1952, S.23.
[103] Ferlinghetti, Lawrence: Un regard sur le monde. Bourgeoise: Paris 1970, S.111.
[104] Scheler, Max: Die Wissensformen und die Gesellschaft. Francke: Berlin 1960, S.268.
[105] Portman, Adolf: Aufbruch der Lebensforschung. Rhein: Zürich 1965, S.200.
[106] Böhme, Gernot: Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp: Frankfurt am Main: 1992, S.53.
[107] Vgl. Bogost, Ian: Alien Phenomenology, or What It’s like to be a Thing. University of Minnesota Press: Minneapolis 2012.
[108] Böhler, Arno: „Staging Philosophy. Toward a Performance of Immanent Expression“, in: Cull, Laura / Lagaay, Alice (Hg.): Performance and Philosophy. Palgrave Macmillan: Hampshire 2014, &45.
[109] Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. De Gruyter: Berlin 1966, S.375.
[110] aaO. S.375.
[111] aaO. S.376.
[112] aaO. S.375.
[113] aaO.
[114] aaO. S.252.
[115] Vgl. Brassier, Ray: Nihil Unbound. Enlightenment and Extiction. Palgrave: London 2007, S.230.
[116] Vgl. Marion, Jean-Luc: Being Given. Toward a Phenomenology of Givenness. Stanford University Press: Stanford 2002, S.248.
[117] Vgl. Henry, Michel: Radikale Lebensphänomenologie. Alber-Verlag: Freiburg im Breisgau 1992, S.41, S.84f.
[118] Gondek, Hans Dieter / Tengelyi, László: Neue Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2011, S. 647.
[119] Badiou, Alain: Theoretical Writings. Continuum: London 2004, S.171.
[120] Zilsel, Edgar: „Philosophische Bemerkungen“ in: Zilsel, Edgar: Wissenschaft und Weltanschauung. Aufsätze 1929 – 1933. Böhlau: Wien 1998, S.34.
[121] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.55.
[122] Vgl. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Gesamtausgabe Bd.3. Klostermann: Frankfurt am Main 1991, S.138.
[123] Vgl. Deleuze, Gilles: Kants kritische Philosophie. Die Lehre von den Vermögen. Merve: Berlin 2008, S.56.
[124] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, A835, B863.
[125] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B165ff.
[126] aaO. B167.
[127] Kant, Immanuel: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, S.544.
[128] aaO.
[129] Ingensiep, Hans Werner: „Organismus und Leben bei Kant“ in: Ingensiep, Hans Werner / Baranzke, Heike: Kant Reader. Könighausen&Neumann: Würzburg 2004. S.119.
[130] Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, S.9.
[131] aaO.
[132] Dieses Thema ist ein entscheidendes in der Bioethik, da mit der Bestimmung als Lebewesen auch Rechte einhergehen. Vgl. Singer, Peter: Animal Liberation. Befreiung der Tiere. Rowohlt: Hamburg 1996.
[133] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.400.
[134] Kant, Immanuel: Physische Geographie. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1900, S.364.
[135] Heidegger, Martin: Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Wintersemester 1929/1930). Gesamtausgabe 29/30. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S. 263.
[136] Heidegger, Martin: Grundbegriffe der Metaphysik, S.226.
[137] Agamben, Giorgio: Das Offene. Der Mensch und das Tier. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2003, S.67.
[138] Heidegger, Martin: Grundbegriffe der Metaphysik, S.226.
[139] aaO. S.289.
[140] aaO. S.289.
[141] Um hervorzuheben, wie absurd die Behauptung wäre, dass der Stein die Eidechse wirklich berühre, fühlt sich Heidegger verpflichtet das Wort selbst in Spitzklammern zu setzen.
[142] aaO. 291.
[143] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.380.
[144] Aristoteles geht wirklich so weit, Kinder, die ihren Vätern nicht genügend ähnlich sehen, als monströs zu bezeichnen, weil der Samen des Mannes nicht die Macht hatte über die Anlagen der Frau zu triumphieren.
[145] Canguilhem, Georges: Die Erkenntnis des Lebens, S.309.
[146] „Musik hat einen Zerstörungsdurst […]“ schreibt Deleuze. Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Merve-Verl: Berlin 1992, S.408.
[147] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.419.
[148] Lovecraft, Howard P.: „Die Farbe aus dem All“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013, S.97.
[149] Vgl. Lovecraft, Howard P.: “Der Schatten aus der Zeit“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013, S.209.
[150] Lovecraft, Howard.P.: „Die Farbe aus dem All“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013, S.92.
[151] Land, Nick: Fanged Noumena. Collected writings 1987-2007. Urbanomic: Windsor Quarry 2012, S. 292.
[152] Doyle, Sir Arthur Conan: The lost world & other Stories. Wordsworth Editions: Hertfortshire 1995, S.441.
[153] Bennett, Jane: Vibrant Matter. A political ecology of things. Duke University Press Books 2009, S.9.
[154] Kafka, Franz: „Die Sorge des Hausvaters“ in: ders.: Gesammelte Werke. Bd.5. Fischer-Verlag: Frankfurt am Main 1996, S.129.
[155] aaO.
[156] aaO. S.130.
[157] Plessner, Helmuth: „Die Utopie in der Maschine“ in: Dux, Günther / Marquard, Odo / Plessner, Helmut: Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985, S.31-40.
[158] Grant hat diese Verbindung zwischen dem anorganischen Leben, dem Robotertrend, der Deleuzeschen Maschine in den 1990ern philosophisch verarbeitet und mit Philip K. Dicks Bladerunner verschmolzen. Vgl. Grant, Iain: „Burning AutoPoiOedipus“ in: Abstract Culture. Swarm (no.2.), 1999, Online-Veröffentlichung. Vgl. Dick, Philip K.: Bladerunner. Heyne: München 2002.
[159] Anders sah schon ganz richtig, dass dies den Menschen obsolet, antiquiert machen würde und stellte sich als Moralist dagegen auf. Es bleibt jedoch die Frage, ob dieses humanistische Pathos eine Möglichkeit (des Denkens) versperrt. Vgl. Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen. Band I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. C.H. Beck: München 1956.
[160] Vgl. Lyotard, Jean-François: Libidinöse Ökonomie. Diaphanes: Zürich-Berlin 2007, S.117f.
[161] Vgl. Braidotti, Rosi: The posthuman. Polity Press: Cambridge, England, Malden, Massachusetts 2013, S. 106.
[162] Margulis, Lynn / Sagan, Dorion: What is life? Simon & Schuster: New York 1995, S. 49.
[163] Ryle, Gilbert: “Descartes Myth” in: Chalmers, David: Philosophies of the mind. Classical and contemporary readings. Oxford University Press: Oxford 2002, S.32-38, hier S.34.
[164] Lacan, Seminar XX: Encore S.9
[165] Vgl. Perniola, Mario: Der Sex-Appeal des Anorganischen. Turia+Kant: Wien 1999, S.9.
[166] Vgl. Simmel, Georg: „Der Henkel“, S.122.
[167] Vgl. Guzzoni, Ute: Unter anderem: die Dinge. Karl-Alber-Verlag: Freiburg-München 2008, S.25.
[168] Massumi hat auf die Tendenz hingewiesen, dass eine Suche nach dem Jenseits des Menschen schnell wieder zu ihm zurück führt, wenn man nur die Negation des Menschen sucht, und somit alles erneut negativ anthropozentrisch ausrichtet. Vgl. Massumi, Brian: A User‘s Guide to Capitalism and Schizophrenia. MIT-Press: Cambridge 1992, S.232.
[169] Latour, Bruno: „Irreductions“ in: ders.: The Pasteurization of France. Harvard University Press: Cambridge 1988, S.162.
[170] Eine gute Einführung, wie Auseinandersetzung mit dieser Theorie findet sich in: Vgl. Weyer, Johannes (Hg.): Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. Oldenbourg: München 2000, S.102ff.
[171] Harman, Graham: “On the Undermining of Objects. Bruno, Grant and Radical Philosophy” in: Bryant, Levi R. / Srnicek, Nick / Harman, Graham: The speculative turn. Continental materialism and realism. re.press: Melbourne 2011, S. 24.
[172] Vgl. Meillassoux, Quentin: Nach der Endlichkeit. Versuch über die Notwendigkeit der Kontingenz. Diaphanes: Zürich 2008, S. 16f.
[173] Mutatis mutandis würde dies auch für die frühe radikal empiristische Position von William James oder auch den Empiriokritizismus gelten.
[174] Deleuze, Gilles: David Hume. Campus Verlag: Frankfurt am Main 1997, S.16.
[175] Besonders aber in den Händen von Wilfried Sellars und den (gelegentlich von Harman angesprochenen) Radikalisierungen durch Ray Brassier wird diese Anti-These zu den Objekten noch verschärft. Aufbauend auf den Arbeiten zum Empirismus von Quine (Vgl. Quine, Willard Orman van: „Zwei Dogmen des Empirismus“ in: ders: Von einem logischen Standpunkt. Neun philosophische Essays. Ullstein: Frankfurt am Main 1979, S.27-50.) richtet sich Sellars (und in der Folge auch Brassier) gegen den „Mythos des Gegebenen“ (Vgl. Sellars, Wilfrid: Empiricism and the Philosophy of Mind. With an Introduction by Richard Rorty and a Study Guide by Robert Brandom. Harvard University Press: Cambridge 1997, S.14.), der sich auf das Vorfinden von Strukturen und Gegenstanden in der Welt stützt, um über Wissen zu sprechen, wie es etwa in der Phänomenologie oder einigen empiristischen Positionen geschieht. Die Genese dieses Mythos ist für Sellars in der Alltagsbeziehung gegründet, in der Dinge als manifeste, stabile und einheitliche Objekte erscheinen. Gegen dieses „manifeste Bild“ setzt er das „wissenschaftliche Bild“ (Vgl. Sellars, Wilfried: Philosophy and the Scientific Image of Man,” in: Colodny, Robert: Frontiers of Science and Philosophy. University of Pittsburgh Press: Pittsburgh 1962, S.35–78.), welches die scheinbaren Manifestationen als solche entlarvt und sie der ana-lytischen (auflösenden) Kraft des wissenschaftlichen Blicks freigibt.
[176] Harman, Graham: “On the Undermining of Objects. Bruno, Grant and Radical Philosophy” in: Bryant, Levi R. / Srnicek, Nick / Harman, Graham: The speculative turn, S.23.
[177] Den Prozess der Individuation aufnehmend, entwickelt Barthélémy ein Denken an den Grenzen der Kybernetik. Vgl. Barthélémy, Jean-Hugues: “Simondon – Ein Denken der Technik im Dialog mit der Kybernetik” in: Hörl, Erich: Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2012, S.93-109.
[178] Vgl. DeLanda, Manuel: A Thousand Years of Non-Linear History. Zero-Book: New York 1997, S.21.
[179] Vgl. Nancy, Jean-Luc: “Corpus” in: ders: The Birth of Presence. Stanford University Press: Stanford 1993. S.174.
[180] ‚Il y a‘ als „das Murmeln der Stille“. Levinás, Emmanuel: Die Zeit und der Andere. Meiner: Hamburg 1984, S.23.
[181] Harman, Graham: Bells and Whistles. More Speculative Realism. Zero Books: Winchester, Washington 2013, S.78.
[182] aaO., S.85.
[183] Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures. Essays and lectures. Zero Books: Ropley 2010, S.95.
[184] Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Niemeyer: Tübingen 1993, S.67f.
[185] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S. 68.
[186] Vgl. Heidegger, Martin: Sein und Zeit S.102.
[187] Zur Psychophysik des Schmerzes, die für Schmitz im Leib wurzelt: Vgl. Schmitz, Hermann: Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Therapeutik. Junfermann: Paderborn 1992, S.169ff.
[188] Bennett, Jane: “The agency of assemblages and the North American blackout”, in de Vries, Hent / Sullivan, Lawrence E.: Political theologies public religions in a post-secular world. Fordham University Press: New York 2006, S.602-616.
[189] Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures. Essays and lectures. Zero Books: Ropley 2010, S. 97. Der Begriff “tool”, welchen Harman ebenfalls als Übersetzung von Zeug verwendet ist tatsächlich irreführend, scheint er doch Heidegger zu einer Art Technikphilosophen zu machen, dessen Interesse vor allem Hämmern, Bohrmaschinen und Hobeln gilt. Zeug ist tatsächlich mehr als nur Werkzeuge.
[190] Heidegger, Martin: “Der Ursprung des Kunstwerks” in: ders: Holzwege. Gesamtausgabe 5. Vittorio-Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S.25.
[191] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S.7.
[192] Harman, Graham: Towards speculative realism, S.100.
[193] Bryant, Levi R. / Srnicek, Nick / Harman, Graham: The speculative turn, S.36.
[194] Vgl. Bruno; Giordano: Von der Ursache, dem Anfangsgrund und dem Einen. Eugen Diederrichs Verlag: Jena 1906, S.51.
[195] Dies behauptet Harman zumindest, verdreht Heidegger damit aber enorm und es ist noch eine Untersuchung wert, ob diese Herabsetzung des Daseins wirklich auch zu einer Erhöhung der Dinge führt, oder sie beide in ein unerforschliches Feld stürzen lässt.
[196] Auch Ute Guzzoni macht diesen Unterschied zwischen Substanz und Ding in Heideggerscher Manie klar. Vgl. Guzzoni, Ute: Unter anderem: die Dinge. Karl-Alber-Verlag: Freiburg-München 2008, S.11f.
[197] Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures, S. 101.
[198] Es bleibt fraglich, ob es ein Ding geben kann, dass ohne die anderen besteht, wenn doch Heideggers Zeuganalyse gerade die notwendige Verbindung der Dinge aufzeigt, die Harman ja unterscheibt.
[199] Brentano hat diesen Umstand schon festgehalten, indem er nicht nur auf die potentielle Möglichkeit von endlichen Substanzen, sondern auf Aristoteles faktischer Ausweisung solcher hinweist. Vgl. Brentano, Franz: Über Aristoteles: Nachgelassene Aufsätze. Meiner: Hamburg 2013, S.374.
[200] Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures, S. 103.
[201] Harman kritisiert den Materialismus (sehr generell) als reduktive Position auf zwei Weisen. Entweder als szintistischen Materialismus, der behauptet, dass jedes Objekt auf seine kleineren Bestandteile reduziert werden kann (sub-atomare Teilchen etc.) oder insofern man der Linie Bruno, Spinoza (und Grant) folgt, für die Materie der morphogentische Grund für jedes Objekt ist.
[202] Harman, Graham: Bells and Whistles, S. 7.
[203] Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986, S.167.
[204] Vielleicht kommt diese Hegelsche Version Spinozas – die Spinoza nicht adäquat wiedergibt – am besten wieder, was Ray Brassier in seinem Buch Nihil Unbound beschreibt, wenn er die Philosophie als Organon der Auslöschung bezeichnet. Vgl. Brassier, Ray: Nihil Unbound. Enlightenment and Extiction. Palgrave: London 2007, S.239.
[205] Spinoza, Baruch de: Die Ethik. Reclam: Leipzig 2007, Buch IV, Lehrsatz 67, S.581.
[206] aaO. Buch III, Lehrsatz, S.271.
[207] Moder, Gregor: Hegel und Spinoza.Negativität in der gegenwärtigen Philosophie. Turia+Kant: Wien 2013, S.124
[208] Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986, S.83.
[209] „Incarnation is comedy and all comedy always involves incarnation“ Zupančič, Alenka: Odd one in: On Comedy. MIT-Press: London 2008, S.45.
[210] Die Schädelstätte findet sich an entscheidender Stelle beispielweise in Verbindung mit dem absoluten Wissen. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986, S.591.
[211] Vgl. Heidegger, Martin: Holzwege. Gesamtausgabe 5. Vittorio-Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S.364.
[212] Luther, Martin: „Gott selbst liegt tot“ in: Becker, Hansjakob: Geistliches Wunderhorn: Große deutsche Kirchenlieder. C.H. Beck: München 2009, S.198.
[213] Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Jenaer Kritische Schriften (III). Meiner: Hamburg 1986, S.134.
[214] Deleuze Interpretation Hegels beruht fast ausschließlich auf diesem Punkt der notwendigen Negativität und vielleicht wird er Hegel damit nicht gerecht.
[215] Vgl. Malabou, Catherine: The Future of Hegel. Temporality, Plasticity and Dialectic. Routledge: London 2005, S.56 – 60.
[216] Diese Kreuzung von Hegel und Deleuze macht Žižek immer wieder deutlich. Vgl. Žižek, Slavoj: Körperlose Organe. Bausteine für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.73.
[217] Obwohl es eine Spaltung innerhalb der Substanz gibt, basiert diese nicht auf Negation, wie Deleuze auch unablässig betont.
[218] Vgl. Kojeve, Alexander: Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the Phenomenology of Spirit. Cornell University Press: Ithaca 1980, S.120. Kojeve meint dies jedoch – aus Hegelischer Perspektive – als Abwertung. Jedoch beschreibt damit schon exakt die Art der Philosophie, die Deleuze später kreieren wird; einen wahnsinnigen Monismus, einen manisch lachenden Spinoza.
[219] Spinoza, Baruch de: Die Ethik, Buch I, Lehrsatz 29, S.73.
[220] Maturana, Humbert: Autopoesis and Cognition. The Realisation of the Living. D. Reidel Publishing Company: Boston 1980, S.78.
[221] Bryant, Levi: The Democracy of Objects. Open Humanities Press: Ann Arbor 2011, S.141.
[222] aaO. S.116f.
[223] Gerade aus dieser hyletischen Prämisse speist sich die Anziehungskraft der Spinozistischen Philosophie für Physiker und Chemiker. Vgl. Hammacher, Klaus: Spinoza und moderne Wissenschaft. Königshausen&Neumann: Würzburg 1998.
[224] Bryant, Levi: The Democracy of Objects, S.141
[225] Vgl. Protevi, John: “Deleuze and Emergence” in: Paragraph: A Journal of Modern Critical Theory. 29.2 (Juli 2006), S.19-39, hier S.34.
[226] Vgl. Jonas, Hans: „Spinoza and the theory of the organism“ in: Journal of the History of Philosophy 3(1), S.43-57.
[227] Vgl. Jonas, Hans: Organismus und Freiheit. Vandenhoeck&Ruprecht: Göttingen 1973.
[228] Spinoza, Baruch de: Die Ethik, Buch III, Definition 3, S.255.
[229] Vgl. Cook, James: „Der Conatus: Dreh-und Angelpunkt der Ethik.“ In: Hampe, Michael / Schnepf, Robert: Baruch de Spinoza. Ethik. Akademie Verlag: Berlin 2006, S.154.
[230] Hobbes, Thomas: Vom Menschen – Vom Bürger. Elemente der Philosophie II und III. Meiner: Hamburg 1994, S.81.
[231] Anzumerken ist hier, dass diese Argumentation auch vollständig umgekehrt funktioniert. Seneca, ganz gegen Spinoza, spricht vom „naturae lex“, in Bezug auf die wichtigste Notwendigkeit der Natur tut; den Tod: „Der Tod beruht auf einem Naturgesetz (mors naturae lex est), er ist die Steuer, die alle Menschen zu zahlen verpflichtet sind.“ Seneca, L. Annaeus: Naturales Quaestiones/Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1995, S.200f.
[232] Vgl. Hampe, Michael: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2007, S.62
[233] Entscheidend ist die Übersetzung von conatur – dem Streben,Versuchen oder Willen im Sein zu verharren. Spinoza verdeutlicht das ‚Streben‘ implizit schon in seiner Studie zu Descartes, indem er das ‚Streben‘ mit dem Streben eines sich in der Kreisbewegung befindlichen Körpers von der Mitte weg gleichsetzt. Insofern bezeichnet streben nicht voluntaristisches, sondern eine absolute, natürliche Notwendigkeit. Siehe: Spinoza, Baruch de: Descartes‘ Prinzipien der Philosophie in geometrischer Weise dargestellt. Meiner: Hamburg 2005, S.248.
[234] aaO. S.125.
[235] Vgl. Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes, S.22f.
[236] Vgl. Deleuze, Gilles: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. Fink: München 1993, S.18.
[237] Macherey hat diesen Punkt herausgestellt, um gegen Hegel die Substanz Spinozas zu einer lebendigen und doch unbeweglichen Immanenz zu machen. Vgl. Macherey, Pierre: Hegel ou Spinoza, Découverte: Paris 1990, S.113.
[238] Vgl. Balibar, Etienne: Spinoza. From Individuality to Transindividuality. Eburon: Delft 1997, S.8-10.
[239] Heidegger, Martin: Nietzsche. Gesamtausgabe Bd. 6.1. Klostermann: Frankfurt am Main 1997, S.56/7
[240] Nietzsche, Friedrich: Nachgelasse Fragmente 1887-1889. Kritische Studienausgabe Bd. 13. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1988, S.227.
[241] Laruelle sieht hier sogar die Grundparadoxie, das die Differenz zerstören will, worauf sie aufbaut und umgekehrt. Vgl. Laruelle, François: Philosophy of Difference. A Critical Introduction to Non-Philosophy. Continuum: New York 2010, S.213.
[242] Interessanterweise ist eben gerade Hegel die Form der Organismen – ebenso wie die Form des Subjekts – sehr viel wichtiger als seine Komponenten oder sein Inhalt. Der Vorwurf trifft vielleicht eher Hegel selbst.
[243] Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2000, S.103.
[244] Spinoza, Baruch de: Die Ethik, Buch 3, Lehrsatz 5, S.273. – diesen Lehrsatz formuliert er mit Rückgriff auf den vorherigen Lehrsatz, den er wiederum als selbstverständlich (also trivial im Sinne der Axiome) betrachtet.
[245] Harman, Graham: Towards Speculative Realism, S. 45.
[246] Es ist trivial zu sagen, dass Veränderung als solche möglich wäre, indem jede Veränderung in einem Ding eine reziproke Veränderung in einem anderen und wieder einem anderen etc. hervorrufen würde. Jedoch wären diese Veränderung jeweils symmetrisch und schon in der Natur der Beziehungen angelegt, schlimmer noch, insofern sich diese Beziehungen kausal (oder gar mechanisch) beschreiben lassen, fallen diesen jede Chance auf das Neue anheim.
[247] Wie Harman Latour auch nennt.
[248] Wie also auch dieses geologische anorganische Leben der Geschichte freilegen?
[249] Latour, Bruno: Reassembling the social. An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press: Oxford, New York 2005, S.244.
[250] aaO. S. 244.
[251] aaO.
[252] Vgl. Mennicken, Peter: Die Philosophie des Nicolas Malebranche. Meiner: Leipzig 1927.
[253] Harman, Graham: Bells and Whistles, S.123.
[254] aaO. S.125.
[255] aaO.
[256] aaO.
[257] „Die Profanisierung beinhaltet jedoch eine Neutralisierung dessen, was sie profaniert. Wenn aber das, was nicht verfügbar und abgesondert war, einmal profaniert ist, verliert es seine Aura und wird dem Gebrauch zurückgegeben.“ Agamen, Giorgio: Profanierungen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.74.
[258] Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. de Gruyter: Berlin 1966, S.310.
[259] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.291.
[260] Man wäre vielleicht versucht zu sagen, dass Harman der Philosoph des Vielen ist, während Deleuze der Philosoph des Einen ist. Dies ist aber vollkommen irrig, da für Deleuze das Eine immer schon das Viele ist. Das eine Sein wird bei Deleuze nicht in viele Teile zerteilt oder zerbrochen aufgefasst, sondern aus „verteilt“ – das Eine ist also nicht als zerbrochen in Viele, sondern als Verteilung des Vielen. Einheit und Vielheit sind bei Deleuze keine Gegensätze, bei Harman jedoch schon.
[261] Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1966, S.84.
[262] Gemeint sind eher Dinge, um im Jargon Heideggers zu bleiben.
[263] Harman, Graham: Bells and Whistels, S.267.
[264] Heidegger, Martin: Wegmarken. Gesamtausgabe Bd. 9. Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S.188.
[265] Heidegger, Martin: „Zeit und Sein (1962)“ in: ders: Zur Sache des Denkens. Klostermann: Frankfurt am Main 2007, S.9.
[266] Heidegger legt in „Zeit und Sein“ nicht nur den latenten Anthropozentrismus ab, sondern auch seine Angst vor einem anonymen Sein, das in Sein und Zeit nur als unauthentisches Schreckensbild des Man auftaucht. Doch, steigen wir nicht auch als Jemand aus der Masse des Man erst auf, ohne von diesem losgelassen zu werden.
[267] Beistegui verwendet die differentiellen Otologien von Heidegger und Deleuze gegen das Denken der Präsenz, aber gleichzeitig gegen das Denken der Essenz. Statt der Essenz Aristoteles setzt er – teilweise in Anlehnung an DeLandas Deleuzeinterpretation – unpersönliche Singularitäten, die den anonymen Prozess der Ausfaltung des Seins antreiben und „leiten“. Vgl. Beistegui, Miguel de: Truth and Genesis. Indiana University Press: Bloomington 2004, S.259.
[268] Bryant, Levi R. / Srnicek, Nick / Harman, Graham: The speculative turn, S.41.
[269] Vgl. Harman, Graham: Guerrilla Metaphysics. Phenemenology and the Carpentry of Things. Open Court Pub Co: Chicago 2005. S.82.
[270] Whitehead, Alfred North: Process and Reality. The Free Press: New York 1978, S.289.
[271] aaO. S.284
[272] Whitehead, Alfred North: Modes of Thought. The Free Press 1968, S. 137.
[273] Whitehead, Alfred North: Process and Reality, S.340.
[274] aaO.
[275] Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1994, S. 280.
[276] Saint-Hilaire, Etienne Geoffroy: „Divers mémoires sur des grands sauriens” in: Mémoires de l’Academie Royale des Sciences de l’Institute de France, (no.12), 1833, S.89.
[277] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1930. Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986, §247 Anm.
[278] Hartmann, Nicolai: Die Philosophie des deutschen Idealismus. De Gruyter: Berlin, S.117.
[279] Vgl. aaO..
[280] Vgl. Grant, Iain: Philosophers of Nature after Schelling, S.163.
[281] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.330.
[282] aaO. S.329.
[283] aaO. S.330.
[284] aaO., S.58.
[285] aaO. S. 57.
[286] Nietzsche, Friedrich: Nachgelasse Fragmente 1885-1887. Kritische Studienausgabe Bd. 12. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1988, S.550.
[287] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.58.
[288] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.68.
[289] Vgl. Hutton, James: “Theory of the Earth; or an Investigation of the Laws observable in the Composition, Dissolution and Restauration of the Land upon the Earth” in: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1788, (no.1), S. 304.
[290] Es stellt sich also das Problem, dass Bruno gerne die Kräfte der Materie betonen will und auf eine substratunabhängige Philosophie zusteuert, aber im letzten Moment noch das hypokeimenon des Aristoteles annimmt, um die Dinge letztendlich in einer Quelle zu vereinen, die sich selbst aus nichts anderem ableitet. Die Frage ist folglich – die Deleuze bearbeiten wird – wie man eine Ontologie denken kann, die alle Dinge in einer Substanz verwurzelt, ohne diese aber zu einer ersten und unwandelbaren Substanz zu hypostasieren.
[291] Vgl. Grant, Iain: Philosophers of Nature after Schelling, S.33.
[292] Williams, Robert: “Life is inorganic too” in: Nature. (Vol. 248), 22.März 1974, S.302.
[293] Was nicht zuletzt durch das Desinteresse der Philosophie des späteren 20.Jh. an umfassenden Kosmologien evoziert und das Zerfallen in Philosophien der Physik – losgelöst von denen der Biologie oder des Lebens.
[294] Aber auch die vermeintliche wissenschaftlich oder gar mathematisch abgesicherten Bedingungen des Denkens, können sich bloß als kontingent herausstellen. Wie das Parallelenpostulat, an das Kant noch glaubte, sich aber als nicht Denknotwendig herausstellte.
[295] Vgl. DeLanda, Manuel: “Nonorganic Life” in: Crary, Jonathan / Kwinter, Sanford (Hg.): Zone 6. Incorporations, Urzone: New York 1992, S.129-167, hier: S.140f.
[296] Bolzmann hat bereits gezeigt, dass sie solche Ansammlungen nach nur genügend langer Zeit bilden.
[297] Obwohl es sich bei den „Umlaufbahnen um die Kerne nicht notwendig um neue Attraktoren handeln muss. Vgl. Iberall, Arthur: Toward a General Science of Viable Systems. McGraw Hill: New York 1972, S. 33. – Stellt bereits eine Theorie der virtuellen Umlaufbahnen vor, die quantenphysisch gesehen, nicht auf Anziehung beruht, sondern auf Minima von freier Energie. Das System strebt demnach nicht so sehr nach dem folgen der Attraktoren, als nach der Reduzierung der radikalen Energie. Ein ähnliches Modell finden wir bei Freud in Bezug auf die Bindung psychischer Energie.
[298] Vgl. Mainzer, Klaus: Leben als Maschine. Von der Systembiologie zur Robotik und Künstlichen Intelligenz. Mentis: Paderborn 2010, S.43.
[299] Die Bifurkationen des Silikons „steuern“ auch, welche Struktur das abkühlende Silikon annehmen wird. Entscheidend sind Geschwindigkeit, Temperatur und Druck bei der Bildung von Quarz, Glas oder Kristallen aus Glas. Vgl. Palmer, Richard: „Brocken Ergodicity“. In: Stein (Hg.): Lectures in the Science of Compexity, Addison-Wesley: New York 1989, S.275.
[300] DeLanda, Manuel: A Thousand Years of Non-Linear History, S.27.
[301] Obwohl Žižek fälschlicherweise behauptet, Deleuze würde Epistemologie und Ontologie in Eins fallen lassen. Vgl. Žižek, Slavoj: Körperlose Organe. Bausteine für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.36.
[302] Tatsächlich finden sich im 20.Jh. von der Phänomenologie über den linguistic turn bis hin zur Dekonstruktion nahezu keine Positionen, die einen Realismus zulassen. Deleuze scheint eine Ausnahme zu sein, wenn man von seinen Humeschen Tendenzen absieht.
[303] DeLanda, Manuel: Deleuze. History and Science. Atropos Press 2010, S.81.
[304] DeLanda, Manuel: “Delanda – Deleuze, Diagrams and the Genesis of Form” in: ANY.Architecture New York 23. Diagram Work. Data Mechanics for a Topological Age. (Juni 1998), S.30.
[305] aaO. S.31.
[306] DeLanda, Manuel: Intensive Science and Virtual Philosophy. Bloomsburry: London 2013, S.3.
[307] Dieser Attraktor wurde vom Metrologen Edward N. Lorenz entdeckt. Er versuchte Langzeitvorhersagen über das Wetter zu machen und entdeckte die Wirkung eines deterministischen Chaos in der Erdatmossphäre. Da es sich um die Kopplung von drei nicht-linearen gewöhnlichen Differentialgleichungen handelt, lässt sich die Vorhersage nur probabilistisch treffen, da kleine Änderungen der Anfangsbedingungen große Wirkung für die späteren Zustände des Systems. (Später auch Butterfly Effekt genannt)
[308] Deleuze, Gilles /Guattari, Felix: Tausend Plateaus, S.564.
[309] Gelegentlich meint er das Einzelne und Einzigartige (Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.345.), häufiger und auch bedeutungsschwerer meint er aber singuläre Punkte, die den linearen Verlauf einer Kurve verändern (Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.76.). Ob die beiden Bedeutungen vereinbar sind, müsste noch geklärt werden.
[310] Deleuze, Gilles: Foucault. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1995, S. 54.
[311] Ähnlich wie Deleuze das Verhältnis von monarchischer und nomadischer Wissenschaft charakterisiert. Während die royale Akademie nach den ewigen und unveränderlichen Gesetzen des Kosmos sucht, besteht die nomadische Wissenschaft aus jenen Leuten, die an den Materialien arbeiten; die Geräte zur Messung bauen und Maschinen für Experimente vorbereiten. Sie arbeiten an den Materialien und wissen um die Trends und Tendenzen eines Stoffes; um seine plötzlichen Transformationen und Richtungswechsel. Smith bemerkt hierzu auch das besondere Wissen der Metallurgen, die mit den mittelgroßen Dingen (Metall) zu tun hatten und sich nicht mit dem unendlich Großen (Universum) und dem unendlich Kleinen (Partikel) befassten. Gerade so konnten sie die einzigartige polykristalline Struktur in diesen Materialien entdecken – viel eher als die nicht Hand anlegenden Wissenschaftler. Vgl. Smith, Cyril Stan: History of Metallurgy. Gordon&Breach Science Publishers: London 1966.
[312] Man darf hier auf keinen Fall darstellen als abbilden auffassen, sondern als Zeigen im Sinne eines Machens.
[313] Deleuze ist hier gespalten. Es drückt sich hier der immer wiederkehrende Kampf zwischen Humeschen Empirismus und Spinozistischem Naturalismus aus.
[314] Châtelet, Gilles: Figuring Space. Philosophy, Mathematics and Physics. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht 2000, S.10.
[315] Vgl. Reichert, André: Diagrammatik des Denkens. Transcript: Bielefeld 2013, S.65.
[316] Obwohl William Bray bereits 1921 einen ähnlichen Effekt bei der Aufspaltung von Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff beschrieben hatte. Vgl. Stewart, Ian: Does God play Dice? The Mathematics of Chaos. Wiley-Blackwell: New York 2002, S.186.
[317] DeLanda, Manuel: „Nonorganic Life“, S.132.
[318] Prigogine, Illya / Stengers, Isabelle: Order out of Chaos. Bantam: New York 1984, S. 155.
[319] aaO.
[320] Vgl. Goldberger, Ary / Rigney, David: “Chaos and Fractals in Human Physiologie” in: Scientific American. (no.262.2), Februar 1990, S.42.
[321] Vgl. Bennett, Jane: Vibrant Matter, S. 21.
[322] Vgl. DeLanda, Manuel: “Deleuze in Phase Space” in: ders.: Deleuze. History and Science, S.141-159.
[323] Vgl. Serres, Michel: The Birth of Physics. Climanen Press: Manchester 2001, S.58.
[324] Vgl. Smith, Cyril Stan: A History of Metallography. The Development of Ideas on the Structure of metals before 1890. Chicago University Press: Chicago 1960, S.134.
[325] Bennett, Jane: Vibrant Matter, S.35.
[326] Vgl. Deleuze, Gilles / Guattari, Felix: Tausend Plateaus, S.564.
[327] „Schließlich ist die Inflexion in sich selbst von einer unendlichen Variation oder einer unendlich variablen Krümmung untrennbar.“ Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2000, S.31.
[328] Zum Zusammenhang mit der organischen, sowie auch anorganischen Morphogenese und den sieben Katastrophen bei diesen verweist Deleuze auf: Vgl. Thom, René: Morphogenése et Imaginaire. Lettres Moderne: Paris 1978, S.130.
[329] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.675.
[330] Deleuze, Gilles: Unterhandlungen. 1972 – 1990. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1993, S.209.
[331] Insofern ist auch Schelling ursprüngliche Verwirrung in der Weltseele zu erklären, die versucht die Kantische Opposition aufbrechen, jedoch keine Alternative zum Rahmen des Denkens findet und damit mit dem Welt-Organismus endet.
[332] Speiser, Andreas: „Naturphilosophische Untersuchungen von Euler und Riemann“ in: Journal für die reine und angewandte Mathematik. (Nr.157), 1927, S.105-127. Wenn Denken, dann spontane sichtbare Handlung – keine spontane sichtbare Handlung der Dinge – ergo keine Denken in der Dingen; modus tolens. Die offensichtlichere Schwierigkeit – neben der Annahme der Spontanität des Denkens – ist die Annahme der Sichtbarkeit dieses Denkens, dass einen fast zwangsläufig in einen anthropomorphen Abgrund stürzt.
[333] Dies ist die paradoxe Konstellation die nicht zuletzt im Begriff ‚transzendentaler Empirismus‘ wieder Ausdruck findet. Der Naturalismus Spinozas gründet sich auf den Affektionen, welche sich nicht mit den groben Eindrücken des Humeschen Empirismus vereinen lassen. Entweder man ist auf der Seite Humes oder auf der Spinozas – es ergibt sich jeweils ein anderer Deleuze.
[334] Vgl. Shaviro, Steven: “Interstial Life. Remarks on Causality and Purpose in Biology” in: Gaffney, Peter (Hg.): The Force of the Virtual. Deleuze, Science and Philosophy. Minnesota University Press: Minneapolis 2010, S.139.
[335] Vgl. aaO. S.144.
[336] Bereits Hegel schreibt sogar den Zahlen ein reflexives Vermögen zu.
[337] Vgl. Russel, Bertrand: The Principles of Mathematics. Norton: New York 1938, S.104, S.171.
[338] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.568.
[339] Deleuze, Gilles: Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. Fink: München 1993, S.227.
[340] Vgl. Haken, Hermann: Synergetics. An Introduction. Springer: Berlin 1978.
[341] Selbst der Blick des Physikers bleibt hier nicht ungetrübt – auch Schrödinger entwickelt mit seinem Begriff der Negentropie einen sehr einseitigen Lebensbegriff. Vgl. Schrödinger, Erwin: Was ist Leben? Piper-Verlag: München 1989, S.36.
[342] Eigen, Manfred / Winkler, Ruthild: Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall. Piper: München 1975, S.87.
[343] Auch wenn die Theorien von Jentsch einen neuen kosmischen Anlauf versuchen.
[344] Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft, S.375.
[345] Eine sehr gute Übersicht über die Debatte findet sich bei: Vgl. Heidelberger, Martin: „Selbstorganisation im 19.Jahrhundert“ in: Kron, Wolfgang / Küppers, Günther: Selbstorganisation. Aspekte einer wissenschaftlichen Revolution. Vieweg: Wiesbaden 1990, S.67-104.
[346] Hume thematisiert die Skepsis, ob es sich überhaupt lohne über das Thema nachzudenken, als er droht in den infiniten Regress zu fallen bei dem Gedanken einer idealen Welt, die wiederum auf einer anderen idealen aufbauen müsste etc., so dass am Ende gar keine reale Welt mehr möglich wäre. Vgl. Hume, David: Dialoge über natürliche Religion. Meiner: Hamburg 1968, S.42.
[347] Für Kant kann nur Gott für die selbstorganisierende Einheit der Natur bürgen. Schon früher hatte Kant argumentiert, dass ein derart komplexes Universum die Handschrift Gottes tragen müsste, welche sich in der Schönheit und Eleganz aller natürlichen Beziehungen zeigen würde. Vgl. Kant, Immanuel: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Petersen: Königsberg-Leipzig 1755, A144.
[348] Vgl. Harman, Graham: Towards speculative realism: Essays and lectures, S.176.
[349] DeLanda, Manuel: Intensive Science and Virtual Philosophy. Bloomsburry: London 2013, S.35.
[350] aaO.
[351] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.291.
[352] Vgl. Bhaskar, Roy: Scientific Realism and Human Emancipation. Verso: London 1987.
[353] DeLanda, Manuel: Deleuze. History and Science. Atropos Press 2010, S.70.
[354] In Bezug auf Aristoteles Lehre der Potenzen. Später bemerkt DeLanda auch, dass bei Deleuze die beiden Ebenen nicht so strikt getrennt werden (aaO. S.77.) – hält aber dennoch an seiner Trennung fest.
[355] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung. S.264.
[356] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.114. Die Ko-Existenz der Gegenwart mit der Vergangenheit ist für Deleuze dann auch nur in solch einer Weise ein Paradox, wenn man am gewöhnlichen Bild festhält, dass die Vergangenheit in der gleichen Weise existiert wie die Vergangenheit. Deleuze ist kein Philosoph der Paradoxien unaufgelöst als Axiome stehen lässt. Im Gegenteil zeigen die para doxa, ja gerade, dass sich die übliche doxa in Widersprüche verwickelt.
[357] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.291.
[358] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.271.
[359] Marion weigert sich in ähnlicher Weise – jedoch in der christlich theologisch umgedeuteten Nachfolge von Derrida – zu sagen, dass Gott existiere. Gott existiert nicht und doch wirkt er. Und er kann nur so wirken, wie er wirkt, weil er nicht existiert. Vgl. Marion, Jean-Luc: Dieu sans l’être. Presses univ. de France: Paris 1991.
[360] Bei normalen Luftdruck.
[361] „Concrete Universals“ nennt DeLanda die Mannigfaltigkeiten auch. DeLanda, Manuel: Intensive Science and Virtual Philosophy. S.22.
[362] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.291.
[363] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.215.
[364] Vgl. Bataille, George: „Der Begriff der Verausgabung“ in: ders.: Aufhebung der Ökonomie. Fink: München 1985.
[365] Denn die Philosophie lässt sich nicht von der Nicht-Philosophie trennen. Vgl. Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Suhrkamp: Frankfurt am Main 1996, S.49.
[366] Vgl. Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips. Reclam: Leipzig 2013, S.14.
[367] aaO. S.10.
[368] aaO. S.11.
[369] aaO. S.12.
[370] Vgl. Spinoza, Baruch de: Die Ethik. Buch III, Lehrsatz 18, S.295.
[371] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.21.
[372] aaO. S.23
[373] Vgl. Freud, Sigmund: „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten“ in: Werke aus den Jahren 1913-1917. Gesammelte Werke Bd.10. Fischer: Frankfurt am Main 1946, S.128.
[374] aaO.
[375] Bachmann, Ingeborg: „Unter Mördern und Irren“ in: ders.: Das Dreißigste Jahr. Piper: München 2008, S. 92.
[376] Benjamin, Walter: „Erfahrung und Armut“ in: ders: Gesammelte Schriften II/1. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977, S.123f.
[377] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S. 16.
[378] Besonders von dem, was Freud die unbelehrbaren Sexualtriebe nennt.
[379] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.24.
[380] Vgl. aaO. S.25.
[381] Vgl. Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur“ in: ders.: Fragen der Gesellschaft. Studienausgabe Bd.9. Fischer Taschenbuch Verl.: Berlin 1989.
[382] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.77.
[383] aaO. S.28.
[384] Derrida, Jacques: Die Postkarte. Von Sokrates bis an Freud und jenseits. 2. Lieferung. Brinkmann: Berlin 1987, S.11.
[385] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.29.
[386] aaO. S.28.
[387] aaO. S.31.
[388] Über welche noch nicht viel bekannt war zur Entstehung von Jenseits des Lustprinzips. Gerade im Aufgreifen der genetischen Dynamik, nicht nur der statischen, wie noch Bräuer, liegt Freuds Genie in seiner Spekulation.
[389] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.31.
[390] Gilles, Deleuze: Was ist Philosophie? S.49.
[391] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.31.
[392] Vgl. Gould, Stephen Jay: Ontogeny and Phylogeny. Harvard University Press: Cambridge 1977.
[393] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.34.
[394] Lyotard, Jean-François: „Anima Minima“ in: Welsch, Wolfgang: Die Aktualität des Ästhetischen. Fink Verlag: München 1993, S.417-428.
[395] Vgl. Lyotard, Jean-François: „Newman, der Augenblick“ in: ders: Das Inhumane. Passagen Verlag: Wien 1989, S.99.
[396] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.43f.
[397] aaO. S.43.
[398] Deleuze, Gilles: Logik des Sinns. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1993, S.296.
[399] Vgl. Ansell-Pearson, Keith: Germinal life. The difference and repetition of Deleuze. Routledge: London, New York 1999, S.108.
[400] Freud, Sigmund: „Ergebnisse, Ideen, Probleme (London, Juni 1938)“ in: ders.: Schriften aus dem Nachlaß 1892-1938. Gesammelte Werke Bd.17. Fischer Verlag: München 1951, S.152.
[401] In jenem Sinne, wie Deleuze Affektion gleichzeitig als Affizieren und affiziert werden versteht.
[402] Lyotard, Jean-François: „Anima Minima“, S.442.
[403] Nancy, Jean-Luc: Corpus. Diaphanes: Berlin 2003, S.83.
[404] Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Voltmedia: Paderborn 2006, S.225.
[405] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S. 46.
[406] Haeckel, Ernst: Prinzipien der Generellen Morphologie der Organismen. Reimer: Berlin 1866, S.300.
[407] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.102.
[408] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1930. Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1986, §339.
[409] Lacan, Jacques: Die Ethik der Psychoanalyse. Seminar VII. Quadriga: Berlin 1986, S.382.
[410] Weismann, August: „Zur Frage nach der Unsterblichkeit der Einzelligen“ in: Biologisches Centralblatt. Bd. 4, (Nr. 21), 1885, S. 650–665.
[411] Man müsste sich auch einmal fragen, ob nicht auch Heidegger mit seiner Beschreibung des Menschen als dem einzigen der stirbt, nicht auch eine solche – wenn auch abgewandelte – These vertreten müsste.
[412] Iain Grant hat diese Naturphilosophie des Schleims gegen die rigide Transzendentalphilosophie Kants ins Feld geführt. Vgl. Grant, Iain: „Sein und Schleim“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013, S.241-274.
[413] Woodard hat eine ganze Liste genau dieser Kreaturen mit dem passenden philosophischen Kommentar parat. Vgl. Woodard, Ben: Slime Dynamics, Zero Books: Winchester 2012, S.15.
[414] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.54f.
[415] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.47.
[416] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.46.
[417] Bichat, Xavier: Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod. Friedrich Brummer: Kopenhagen 1802, S.2.
[418] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.73.
[419] Ansell-Pearson, Keith: Germinal life. The difference and repetition of Deleuze. Routledge: London, New York 1999, S.111.
[420] Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur“ in: ders.: Fragen der Gesellschaft. Studienausgabe Bd.9. Fischer Taschenbuch Verl.: Berlin 1989, S.246.
[421] Vgl. Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2012, 23ff.
[422] Brun, Rudolf: „Über Freuds Hypothese vom Todestrieb“ in: Psyche, (7/2), 1953, S. 81 – 111. hier: S.81.
[423] Fromm, Erich: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Deutsche Verlags Anstalt: Stuttgart 1974, S.411.
[424] Freud, Sigmund: „Das Unbehagen in der Kultur“, S.194f.
[425] Vgl. Freud, Sigmund: „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ in: ders.: Fragen der Gesellschaft. Studienausgabe Bd.9. Fischer Taschenbuch Verl.: Berlin 1989, S.33-60.
[426] aaO.
[427] aaO. S.56.
[428] Vgl. Land, Nick: The thirst for Annahilation. George Bataille and Virulent Nihilism. An Essay in Atheistic Religion. Taylor&Francis: London 1992, S.45.
[429] Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips, S.67.
[430] Lacan, Jacques: Die Ethik der Psychoanalyse, S.257.
[431] aaO. S.288.
[432] aaO. S.246
[433] aaO. S.288
[434] Sade, Donatien-Alphonse-François de: Ausgewählte Werke. Bd.3. Merlin Verlag: Hamburg 1962, S.826ff.
[435] Lacan, Jacques: Die Ethik der Psychoanalyse, S.254.
[436] aaO. S.257.
[437] aaO.
[438] Fromm, Erich: Anatomie der menschlichen Destruktivität, S.407.
[439] Vgl. Lacan, Jacques: „Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse“ in: ders.: Schriften I. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1975, S.166.
[440] Vgl. Lacan, Jacques: „Das Drängen des Buchstaben und die Vernunft sein Freud“ in: ders.: Schriften II. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1975, S.44.
[441] Vgl. Derrida, Jacques: Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression. Brinkmann: Berlin 1997, S.26.
[442] Vgl. Boothby, Richard: Death and Desire. Routledge: London 1991, S.20.
[443] Lacan, Jacques: Die Ethik der Psychoanalyse, S.257.
[444] Pearson, Keith Ansell: Viroid Life. Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition. Routledge: London 1997, S.57ff.
[445] Für eine kurze und konzise Kritik: Vgl. Ansell-Pearson, Keith: Germinal life. The difference and repetition of Deleuze. Routledge: London, New York 1999, S.112.
[446] Vgl. Rentsch, Thomas: Martin Heidegger. Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung. Piper: München/Zürich 1989, S.173f.
[447] Žižek, Slavoj: The Plague of Fantasies. Verso: London 1997, S.89.
[448] aaO.
[449] Vgl. Deleuze, Gilles: „Vier Thesen über die Psychoanalyse“ in: ders: Schizophrenie und Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.75.
[450] Vgl. Deleuze, Gilles: „Sacher-Masoch und der Masochismus“ in: Sacher-Masoch, Leopold von: Venus im Pelz. Insel-Verlag: Frankfurt am Main 1980.
[451] Synthese des Narzissmus, Synthese der Partialobjekte und Synthese des Todestriebes werden hier die drei Synthesen der Zeit genannt. Diese Namen stammen nicht von Deleuze, sondern vom Autor der Arbeit.
[452] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.99.
[453] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, A98.
[454] Kant hatte in der ersten Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft – ähnlich wie Deleuze später – versucht den Zusammenhang von Zeit und Bewusstsein in ihrer gegenseitigen genetischen Beziehung zu denken. In der zweiten Auflage ist jedoch das Kapitel „Die drei Synthesen der Zeit“ plötzlich verschwunden und umgeschrieben von Kant in den Anhang verbannt worden.
[455] aaO.Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.100.
[456] aaO. S.101.
[457] Deleuze, Gilles: David Hume. Campus Verlag: Frankfurt am Main 1997, S.11.
[458] Vgl. James, William: Der Pragmatismus: Ein neuer Name für eine alte Denkmethode. Meiner: Hamburg 1994, S.141.
[459] Deleuze; Gilles: Differenz und Wiederholung, S.100.
[460] aaO.
[461] aaO. S.130.
[462] Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. de Gruyter: Berlin 1966, S.267.
[463] Goldstein, Kurt/ Rosenthal, Otto: Zum Problem der Wirkung der Farben auf den Organismus. Schweizer Archiv für Neurologische Psychiatrie. Vol.26, 1930, S.3ff.
[464] Deleuze; Gilles: Differenz und Wiederholung, S.102.
[465] Deleuze; Gilles: Differenz und Wiederholung, S.105.
[466] Deleuze; Gilles: Differenz und Wiederholung,aaO. S.104.
[467] Insofern es sich um ein System handelt, welches einen Betrachter hervor bringt und dieser sich selbst betrachten kann. Vgl. Förster, Heinz von: Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie. Carl Auer Verlag: Heidelberg 2005.
[468] Heidegger, Martin: Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit (Wintersemester 1929/1930). Gesamtausgabe 29/30. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S.252.
[469] Deleuze; Gilles: Differenz und Wiederholung, S.104.
[470] Somers-Hall, Henry: Deleuze’s Difference and Repetition. Edinburgh University Press: Edinburgh 2013, S.88.
[471] Vgl. Ashby, Ross: Design for a brain. Chapman&Hall: London 1960, S.98f.
[472] Vgl. Ashby, Ross: Einführung in die Kybernetik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985, S.381.
[473] Smith und Hayek hegen beide noch den glauben, dass die dem Markt immanenten Ordnungsprinzipien von selbst zu Gleichgewichten führen werden. Vgl. Hampe, Michael: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2007, S.117.
[474] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.105.
[475] aaO., S.330.
[476] aaO., S.105.
[477] Vgl. Grant, Iain: “The Chemestry of Darkness” in: Fincham, Richard / Kollias, Hector: Parallel Process: Philosophy and Science. University of Warwick: Coventry 2000, S.43.
[478] Vgl. Prigogine, Illya / Stengers, Isabelle: Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens. Piper: München 1980, S.145.
[479] Vgl. Peirce, Charles Sanders: Naturordnung und Zeichenprozess. Schriften über Semiotik und Naturphilosophie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1990, S.179.
[480] Vgl. Lyotard, Jean-François: Libidinöse Ökonomie. Diaphanes: Zürich-Berlin 2007.
[481] Vgl. Hume, David: Untersuchungen über die Prinzipien der Moral. Meiner: Hamburg 2003, S.17.
[482] Vgl. Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2000, S.107.
[483] aaO. 2000, S.156.
[484] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.111.
[485] Kierkegaard, Søren: Die Wiederholung. Meiner: Hamburg 2000, S.8f.
[486] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.114.
[487] Vgl. aaO. S.118.
[488] aaO.
[489] Kafka, Franz: „Gibs auf!“ in: Sämtliche Erzählungen. Anaconda-Verlag: Köln 2007, S.562.
[490] Benjamin, Walter: Anmerkungen zu „Franz Kafka: Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages“ (1934) in: Gesammelte Schriften II, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977, S.1255.
[491] Vgl. David-Ménard, Monique: Deleuze und die Psychoanalyse. Ein Streit. Diaphanes: Zürich 2009, S.61.
[492] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.118.
[493] Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist. Meiner: Hamburg 1991, S.127.
[494] aaO.
[495] Es ist daher richtig, dass die reine Vergangenheit nicht bewusst ist und auch nicht sein kann. Es ist das Unbewusste – jedoch nicht im Sinne des frühen Freud. Die reine Vergangenheit ist das Unbewusste, aber trotzdem nichts Seelisches. Vgl. Deleuze, Gilles: Henri Bergson zur Einführung. Junius: Hamburg 2007, S.74.
[496] Vgl. Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis, S.129.
[497] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.115; und Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis, S.158.
[498] Vgl. Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis, S.147.
[499] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.114.
[500] aaO. S.114.
[501] Volkstümliches Lied
[502] Freud beschreibt jedoch auch die Objekte der Trauer als austauschbar. Vgl. Däuker, Helmut: Bausteine einer Theorie des Schmerzes. LIT-Verlag: Münster 2002, S.40.
[503] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, aaO.S.137.
[504] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.49.
[505] Vgl. Žižek, Slavoj: Körperlose Organe. Bausteine für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.9, S.125.
[506] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung S.134.
[507] Ebenso wie die Zeichen der passiven Synthesen in der Gewohnheit nicht mit den Repräsentationen verwechselt werden durften, obwohl diese sich sehr wohl beeinflussen konnten.
[508] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.137.
[509] David-Ménard, Monique: Deleuze und die Psychoanalyse. Ein Streit. Diaphanes: Zürich 2009, S.63.
[510] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.140.
[511] Freuds Ur-Verdrängung verweist nicht umsonst auf Ranks Theorie des Traumas der Geburt. Vgl. Rank, Otto: Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse (1924). Psychosozial-Verlag: Giessen 2007.
[512] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.140.
[513] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.138.
[514] Deleuze verweist darauf, dass Nietzsches Zarathustra hätte so enden sollen. Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.126.
[515] Vgl. Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Kritische Studienausgabe Bd. 4. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999, S.279f.
[516] Vgl. Adorno, Theodor W.: „Fortschritt“ in: Stichworte, Kulturkritik und Gesellschaft II. Gesammelte Schriften Bd. 10.2. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977, S.625.
[517] Abel, Günther: Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr. De Gruyter: Berlin 1998, S.389.
[518] Schelling, Friedrich Wilhelm: Sämtliche Werke VIII. Cotta’scher Verlag: Stuttgart 1859, S.339.
[519] Vgl. Lyotard, Jean-François: Libidinöse Ökonomie. Diaphanes: Zürich-Berlin 2007.
[520] Vgl. Derrida, Jacques: Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität«. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1991, S.38.
[521] Sloterdijk, Peter: Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1983, S.10.
[522] Deleuze versucht diese drei Wiederholungen als Aspekte der ewigen Wiederkehr zu deuten (Vgl. Deleuze, Gilles: Nietzsche und die Philosophie. Europ. Verl.-Anst: Hamburg 1991, S. 75.), kann aber auch nicht klären, wie diese drei nahtlos zusammenwirken, da sie immens disparat sind. Für eine produktive Interpretation ist es sicherlich von Vorteil, diese auch als inkommensurable oder diskontinuierliche Wiederholungen behandeln.
[523] Nietzsche hatte Fechner in Leipzig kennen gelernt. Vor allem von einem Buch Fechners, versucht sich Nietzsche besonders abzugrenzen: Fechner, Gustav Theodor: Über die physikalische und philosophische Atomenlehre (1855). Kessinger Pub Co.: Whitefish 2010.
[524] Nietzsches Verständnis der Physik ist vor allem positiv von einem Werk geprägt, welches er in dieser Zeit las: Vgl. Vogts, Johann Gustav: Die Kraft. Eine real-monistische Weltanschauung. Haupt&Tischler: Leipzig 1878.
[525] Nietzsche, Friedrich: Morgenröte, Idyllen aus Messina, Die fröhliche Wissenschaft. Kritische Studienausgabe Bd. 3, Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999, S.571.
[526] Jaspers hebt auch bei Schelling schon diesen Aspekt der Lebensprobe der Philosophie fest. Vgl. Jaspers, Karl: Schelling: Größe und Verhängnis. Piper: München 1955, S.114.
[527] Vgl. Waldenfels, Bernhard: Antwortregister. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1994, S.365f.
[528] Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1882-1884. Kritische Studienausgabe Bd. 10. Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999, S.610.
[529] Whitehead, Alfred North: Prozess und Realität. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1984, S.408.
[530] Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral. Kritische Studienausgabe Bd. 5. Dt. Taschenbuch-Verl.: Leipzig 1999, S.412.
[531] Vgl. Caygill, Howard: „The Survival of Nihilism“ in: Pearson, Keith Ansell / Morgan, Diana: Nihilism Now! Monsters of Energy. Maximilian Press: London 2000, S.189.
[532] Vgl. Derrida, Jacques: Dissemination.Passagen Verlag: Wien 1995, S.108.
[533] Nietzsche, Friedrich: Der Fall Wagner, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist / Ecce homo, Dionysos-Dithyramben / Nietzsche contra Wagner. Kritische Studienausgabe Bd. 6. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999, S.373
[534] aaO. S.348.
[535] Vgl. Brassier, Ray: „Solare Katastrophe. Die Wahrheit der Auslöschung“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013, S.57.
[536] Vgl. Brassier, Ray: „Solare Katastrophe. Die Wahrheit der Auslöschung“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013, S. 58.
[537] Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Kritische Studienausgabe Bd. 4. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999, S.16.
[538] Vgl. Brassier, Ray: „Solare Katastrophe. Die Wahrheit der Auslöschung“ in: Avanessian, Armen / Quiring, Björn (Hg.): Abyssus Intellectualis. Merve: Berlin 2013, S.59.
[539] Vgl. Lovecraft, Howard P.: „Die Farbe aus dem All“ in: ders.: The best of H.P.Lovecraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2013, S.113.
[540] Vgl. Lovecraft, Howard P.: Chronik des Cthulu Mythos I. Festa: Leipzig 2011.
[541] Vgl. Harman, Graham: Weird Realism. Lovecraft and Philosophy. Zero books: Winchester 2012, S.134.
[542] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S. 50.
[543] Carlin, Garry / Allen, Nicola: „Slime and Western Man. H.P.Lovecraft in the Time of Modernism“ in: Simmons, David (Hg.): New Critical Essays on H.P. Lovecraft. Palgrave: London 2013, S.80.
[544] Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Sämtliche Werke Bd.6, C.H. Beck Verlag: München 1973, S.168.
[545] Meillassoux, Quentin: Nach der Endlichkeit. Diaphanes: Zürich-Berlin 2008, S.24.
[546] Vgl. Brassier, Ray: Nihil Unbound. Enlightenment and Extiction. Palgrave: London 2007, S.223.
[547] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 36.
[548] Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 43-46.
[549] Meillassoux, Quentin: Nach der Endlichkeit, S.21.
[550] Peter Gratton nennt Heidegger und Merleau-Ponty als starke Korrelationisten, da sie die Welt nicht ohne Bezug auf den Menschen (Dasein oder Leib/Fleisch) denken können. Vgl. Gratton, Peter: Speculative Realism. Problems and Prospects. Bloomsburry: London 2014, S.26f.
[551] Fodor, Jerry: Representations: Essays on the Foundations of Cognitive Science, Harvard Press: Cambridge 1979.
[552] Descartes, René: Philosophische Schriften in einem Band. Felix Meiner Verlag: Hamburg 1996, S.55.
[553] Vgl. Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1973, S.69.
[554] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.120.
[555] Das transzendentale Programm ist insofern gerade dem Transzendenten entgegen gesetzt, als Kant nichts anderes gelten lassen will als das, was in der Erfahrung gegeben werden kann.
[556] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Preußische Akademie der Wissenschaften: Berlin 1902, B152/153.
[557] Rölli, Marc: Gilles Deleuze. Philosophie des transzendentalen Empirismus. Turia + Kant: Wien 2003, S.364.
[558] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B178/A139.
[559] Insofern Deleuze wirklich nur Empirie gelten lässt, selbst ohne etwas anzunehmen, was nicht in der Erfahrung gegeben ist, wie das transzendentale Subjekt.
[560] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.124.
[561] Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Kritische Studienausgabe Bd. 4. Dt. Taschenbuch-Verl.: München 1999, S.165.
[562] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.123.
[563] Vgl. Deleuze, Gilles: Das Zeit-Bild. Suhrkamp-Taschenbuch-Verl: Frankfurt am Main 1999, S.42.
[564] Shakespeare, William: Hamlet. Reclam: Leipzig 1974, S.34.
[565] Vergil, Publius Marco: Georgica. Reclam: Stuttgart 1994, Buch 3, Zeile284.
[566] Vgl. Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.122.
[567] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.291.
[568] Bei Deleuze ist nichts transzendentes mehr übrig, was den Ernst legitimieren würde. Es bleibt nur eine göttliche Ironie. Vgl. Zechner, Ingo: Deleuze. Der Gesang des Werdens. Fink: München 2003, S.131.
[569] Vgl. Blanchot, Maurice: Warten, Vergessen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1987.
[570] Man kann eben hieran sehen, wieso Deleuze Bergson eine Art von Platonismus unterstellt, insofern dieser an die Unveränderlichkeit und Unvergänglichkeit der reinen Vergangenheit glaubt. Vgl. Deleuze, Gilles: Bergson zur Einführung. Junius-Verl: Hamburg 1989, S.79.
[571] Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.186.
[572] Und man wird sich noch vor denen hüten müssen, die einerseits von der Freude am Verlust (einer Form des Masochismus) sprechen oder vom Einrichten im Vergehen. Denn das Vergessen ist keine von außen hinzu getretene Kraft, sondern der innere Kern oder das Wesen der Zeit selbst.
[573] Vgl. Dostoevskij, Fedor M.: Der Grossinquisitor. Insel-Verl.: Frankfurt am Main, Leipzig 2003.
[574] Jesus kommt nicht als er selbst, sondern als ein Idiot wieder, der vielleicht keiner ist.
[575] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.368.
[576] aaO. S.125
[577] Heidegger wird zwar die Ereignishaftigkeit und Zeitlichkeit des Seins selbst betonen, aber diese in einen (quasi-)ontotheologischen Kontext – die Seinsgeschichte – setzen, obwohl er diese Art der Argumentation eigentlich ablehnte. Deleuze wird sich diesem Rückschritt auf eine Geschichte wiedersetzen. Vgl. Rölli, Marc: „Begriffe für das Ereignis: Aktualität und Virtualität. Oder wie der radikale Empirist Gilles Deleuze Heidegger verabschiedet“ in: Rölli, Marc (Hg.): Ereignis auf Französisch. Von Bergson bis Deleuze. Fink: München 2004, S.340. Diese Rekontextualisierung der Zeit in die größere Geschichte des Seins macht eine Rückkehr – wie zu den Griechen – möglich um die originären Seinserfahrungen wieder zu entdecken. Deleuze, ebenso wie Derrida liegen diese Ausflüchte ins Vergangene und Authentische fern – sie sind ganz und gar Nietzianische Philosophen der Trugbilder. Vgl. Alliez, Eric: „Ontology and Logography“ in: Patton, Paul / Protevi, John: Between Deleuze and Derrida. Continuum: London, New York 2003, S.84-97.
[578] Derrida spricht in Grammatologie in von der Allianz des linearen Zeitbildes und der Philosophie der Präsenz und will diese durch eine Dekonstruktion der Präsenz mit einem de-liniarisierten Bild ersetzen. Vgl. Derrida, Jacques: Grammatologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1983, S.127. Im Gegensatz zu Deleuze wird Derrida aber den Begriff der Spur als von der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft inkommensurablen Begriff darstellen, der eine neue Zeitlichkeit bedarf. Letztendlich wird er diese auch auf die Zukunft beziehen – aber auf andere Weise. Siehe dazu auch: Lorraine, Tamsin: „Lining a Time out of Joint“ in: Patton, Paul / Protevi, John: Between Deleuze and Derrida. Continuum: London, New York 2003, S.30-45.
[579] Auch Lyotard spricht wiederholt von der Verräumlichung der Zeit, insofern man Materie und Zeit immer zusammen denken muss. Vgl. Lyotard, Jean-François: „Materie und Zeit“ in: Lyotard, Jean-François: Das Inhumane. Plaudereien über die Zeit. Passagen-Verl.: Wien 2006.
[580] Nancy, Jean-Luc: „Zeit gegen Raum“ in: Nancy, Jean-Luc: Das Gewicht eines Denkens. Parerga: Düsseldorf, Bonn 1995, S.104.
[581] Vgl. Köveker, Dietmar: ChronoLogie. Texte zur französischen Zeitphilosophie des 20. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 2000, S.226.
[582] Bergson betont schon, dass die Materie nicht die reine Vergangenheit sein kann, da die Materie vergeht, die reine Vergangenheit jedoch nicht. Und vielleicht, so müsste man sagen, vergeht sie doch, insofern sie sich nur differenziell wiederholt.
[583] Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985, S.218.
[584] Vgl. Lindner, Eckardt: „Und noch einmal – das Einzigartige. Über ddas Neue als Norm“ in: Lindner, Eckardt / Quent, Marcus: Das Versprechen der Kunst. Aktuelle Zugänge zu Adornos ästhetischer Theorie. Turia + Kant: Wien 2014, S.117-140.
[585] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.124.
[586] Brassier, Ray: “Stellar Void or Cosmic Animal?” in: Fincham, Richard / Kollias, Hector: Crises of the transcendental. From Kant to Romanticism. University of Warwick: Coventry 2000, S.216. Brassier verwendet erstaunlicher Weise “anorganic” statt inorganic.
[587] Man möchte fast meinen, dass es ein frühes Vorspiel zu Immanenz: ein Leben … ist, denn alles kommt hier schon vor: der Doppelaspekt des Todes, das Feld, das Ereignis, das gespaltene Subjekt. Und doch ist die Studie zu Fitzgerald weniger akademisch, sondern persönlich und schon gar nicht so vitalistisch wie der späte Text. dennoch sind es die beiden großen Texte Deleuze‘ über das Leben, dass sich nicht auf den Widerstand gegen den Tod reduzieren lässt. Immanenz und Knacks sind nicht zu trennen.
[588] Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.193.
[589] aaO.
[590] aaO.
[591] aaO..
[592] Wunderschön hat Yates dies in seinem Debutroman festgehalten. Vgl. Yates, Richard: Revolutionary road. Vintage Books: New York 2008.
[593] Buzzati, Dino: Die Tatarenwüste. Reclam: Leipzig 1982, S.114.
[594] Vgl. Deleuze, Gilles: „Immanenz. Ein Leben …“ in: Balke, Friedrich. / Vogl, Joseph: Gilles Deleuze. Fluchtlinien der Philosophie. Fink: München 1996, S.31.
[595] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.328.
[596] Buzzati, Dino: Die Tatarenwüste, S.113.
[597] Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Niemeyer: Tübingen 1993, S.235.
[598] Kants Begriff der Zeit befindet Heidegger als „abgeleiteten“ und „nicht eine ursprüngliche“ Vorstellung der Zeit. Vgl. aaO., S.427.
[599] Vgl. Husserl, Edmund: Texte zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917). Meiner Verlag: Hamburg 1985.
[600] Heidegger, Martin: Der Begriff der Zeit (1924). Gesamtausgabe 3. Vittorio-Klostermann: Frankfurt am Main 2004, S.125.
[601] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S. 326.
[602] Vgl. Kierkegaard, Søren: Der Begriff Angst ;. Vorworte. Grevenberg Verlag Dr. Ruff & Co.: Simmerath 2003, S.42.
[603] Heidegger, Martin: Der Begriff der Zeit (1924), S.116.
[604] Eine Bewegung die auch in der existenziellen Bestimmung der Zeit Lacan noch mitmachen wird. Auch für ihn ist die existenziellste Stimmung nicht das Glück, sondern die Angst als Zeichen des Realen. Vgl. Lacan, Jacques: Das Seminar X. Die Angst, 1962 – 1963. Turia + Kant: Wien 2010, S.197.
[605] Vgl. Deleuze, Gilles: Spinoza. Praktische Philosophie. Merve: Berlin 1988, S.23f.
[606] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S.329.
[607] Heidegger, Martin: Der Begriff der Zeit (1924), S.123.
[608] Wenn man für „Dasein“ in Sein und Zeit einmal „Ich denke“ einsetzt, dann sind die rein formalen Strukturen der Argumentation gar nicht mehr so verschieden. Es ist auf jeden Fall eine interessante Lektüre.
[609] Heidegger verbleibt in gewissen Sinne in dem Rahmen, der von Husserl gesteckt wurde, ohne ihn wesentlich zu verändern. Er bleibt daher auch in denselben Aporien stecken, wie dieser. Vgl. Römer, Inga: Das Zeitdenken bei Husserl, Heidegger und Ricoeur. Springer Science+Business Media B.V: Dordrecht 2010.
[610] „Das Tier verendet. Es hat den Tod weder vor sich noch hinter sich.“ Heidegger, Martin: Das Ding“ in: ders: Vorträge und Aufsätze. Gesamtausgabe Bd.7. Klostermann: Frankfurt am Main 2000, S.180.
[611] Heidegger bindet das Denken des Seins nicht nur in seinem frühen Werk an den Menschen. Vgl. Gratton, Peter: Speculative Realism. Problems and Prospects. Bloomsburry: London 2014, S.26f.
[612] Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S.302.
[613] „Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod; und seine Weisheit ist nicht ein Nachsinnen über den Tod, sondern über das Leben.“ Spinoza, Baruch de: Die Ethik. Buch IV, Lehrsatz 67, S.581.
[614] Blanchot, Maurice: L’espace littéraire. Gallimard: Paris 1955, S.160f. zitiert nach Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.150.
[615] Es ist daher nicht ganz klar, was Marc Rölli genau meint, wenn er sagt, dass die drei Synthesen der Zeit kein Ganzes bilden. Vgl. Rölli, Marc: Gilles Deleuze. Philosophie des transzendentalen Empirismus. Turia + Kant: Wien 2003, S.367. Sicher ist die dritte Synthese unsymmetrisch zu den ersten zwei Synthesen, jedoch kann die dritte Synthese nicht ohne die zwei ersten stattfinden. Sie ist der Riss.
[616] Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.195.
[617] aaO. S.197.
[618] Theodorakopoulos, Johannes: Die Hauptprobleme der platonischen Philosophie. Heidelberger Vorlesungen 1969. Martius Nijhoff: Den Haag 1972, S.73.
[619] Deleuze, Gilles: Logik des Sinns, S.197.
[620] Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.290.
[621] Vgl. Clausius, Rudolph: Abhandlung über mechanische Wärmetheorie. Friedrich Vieweg und Sohn: Braunschweig 1867.
[622] Vgl. Falk, Gottfried / Ruppel, Wolfgang: Energie und Entropie. Springer-Verlag: Berlin 1976.
[623] Philosophisch sind beide Namen eher verfehlt – von Hitze oder Kälte kann nur als Differenz gesprochen werden.
[624] Engels, Friedrich: „Dialektik der Natur“ in: Marx, Karl / Friedrich, Engels: Werke. Bd. 20. Dietzel-Verlag: Berlin 1962, S.325.
[625] Rölli, Marc: “Das Intensive denken. Überlegungen zum Paradox der Materialität mit Bezug auf Deleuze“ in: Köhler, Sigrid G. / Metzler, Jan Christian / Wagner-Egelhaaf, Martina: Prima Materia. Beiträge zur transdisziplinären Materialitätsdebatte. Helmer: Königstein im Taunus 2004, S.72.
[626] Man kann Problemlos einen Liter 90°C heißes Wasser in zwei teilen und erhält zwei 0,5 Liter große Portionen (Volumen=extensiv), jedoch nicht zwei 45°C heiße Flüssigkeiten, sondern beide sind unteilbar 90°C heiß (Temperatur=intensiv).
[627] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 208; B 210.
[628] Hermann Cohen spricht hier schon sehr hellsichtig von Differenzialgrößen (als Bezug auf Leibniz).
[629] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.227.
[630] Man muss sich nur einmal fragen, was es bedeuten würde dieses Konzept nur auf die bewusste Wahrnehmung anzuwenden. Jeder Tropfen auf dem Fenster, jede Berührung unserer Kleidung, jedes noch so kleine Zucken der Schultern oder die Bewegung der Erdkruste selbst – all dies würde das Bewusstsein überfluten. Es bliebe nur der Wahnsinn – der Wahnsinn der Materie selbst. Vgl. Meillassoux, Quentin: „Subtraction and Contraction. Deleuze, Immanence and Matter and Memory” in: Mackay, Robin (Hg.): Collapse III. Unknown Deleuze. Urbanomic: Falmouth 2007, S.104.
[631] Dieser Gedanke heißt keineswegs, dass die Materie in der Wahrnehmung sein muss oder sogar sein könnte. Vielmehr ist sie im Sinne Deleuze – auch wenn er gelegentlich abschätzig über die spricht – intensiv und damit nicht sichtbar. Dies entspricht viel eher Schellings Materiekonzeption als das Dunkle. Vgl. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: „Ueber das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts“ in: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Ausgewählte Schriften. Band 3. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985, S.589.
[632] Vgl. Welchman, Alistair: „Mechanic Thinking“ in: Pearson, Keith Ansell (Hg.): Deleuze and Philosophy. The Difference Engineer. Routledge: London 1997, S.213.
[633] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Was ist Philosophie? Suhrkamp: Frankfurt am Main 1996, S.195.
[634] Sommer, Manfred: Lebenswelt und Zeitbewusstsein. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1990, S.125.
[635] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Anti-Ödipus. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1984, S.53f.
[636] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.174.
[637] Deleuze wird daher von den Asymmetrischen Synthesen des Sinnlichen sprechen. Die Fakultäten können darin auch auseinanderstreben oder eine die anderen überlagern –keine Harmonie, sondern die Freiheit eines anderen Funktionierens der Wahrnehmungsmaschinen.
[638] Deleuze, Gilles: Unterhandlungen, S.209.
[639] Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.150.
[640] Vgl. Calvino, Italo: Der Ritter, den es nicht gab. Dt. Taschenbuch-Verlag: München 1990.
[641] David-Ménard, Monique: Deleuze und die Psychoanalyse. Ein Streit. Diaphanes: Zürich 2009, S.68.
[642] Vgl. Perniola, Mario: Der Sex-Appeal des Anorganischen. Turia+Kant: Wien 1999, S.128.
[643] Perniola hat diese Verbindung von Musik und Architektur als anorganischer Kunst bei Schelling, anstatt der damals üblichen Formen herausgestellt. Vgl. Perniola, Mario: Der Sex-Appeal des Anorganischen. Turia+Kant: Wien 1999, S.111..
[644] Kafka, Franz: Tagebücher 1910 – 1923. Fischer: Frankfurt am Main 1983, S.156.
[645] Burroughs, William S.: Naked Lunch. Die ursprüngliche Fassung. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 2011, S.86.
[646] Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1994, S.323.
[647] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.691.
[648] Das Virtuelle ist für Deleuze real und doch existiert es nicht, sondern insistiert. Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.118, S.264.
[649] Genauso wie Derrida das Parasitäre beschreiben würde. Vgl. Derrida, Jacques: „Die Signatur aushöhlen – Eine Theorie des Parasitären“ in: Pfeil, Hannelore / Jäck, Peter: Politiken des Anderen. Hanseatischer Fachverlag für Wirtschaft: Rostock 1995, S.29-41.
[650] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.220.
[651] Deleuze, Gilles: Francis Bacon – Logik der Sensation. Fink: München 1995, S.32.
[652] Adorno bringt die Herrschaft mit der Verwaltung des Lebens in Verbindung, welche es yerdinglicht und vereinheitlicht. Vgl. Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1966, S.353.
[653] Mark Fisher identifiziert daher auch den Kapitalismus mit diesem Mythos des Zombies; eines Lebens, das sich da, wo es erscheint, selbst mumifiziert. Vgl. Fisher, Mark: Capitalist realism. Is there no alternative? Zero Books: Winchester 2009, S.21. Eben dieselbe Tendenz scheint Nancy erkannt zu haben, wenn er vom technisch-kapitalistischen Paradigma als Erhaltung um der Erhaltung willen spricht. Vgl. Nancy, Jean-Luc: „Struktion“ in: Hörl, Erich (Hg.): Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2012, S.68.
[654] Ruf, Simon / Kleinschmidt, Erich: Fluchtlinien der Kunst. Ästhetik, Macht, Leben bei Gilles Deleuze. Königshausen & Neumann: Würzburg 2003, S.109.
[655] Lovecraft, Howard P.: “Aus dem Jenseits” in: Lovecraft, Howard P.: Die lauernde Furcht. Horrorgeschichten. Festa: Leipzig 2013, S.102f.
[656] Man muss Nietzsches Genealogie eben als eine solche Umarbeitung verstehen. Man darf sie nicht auf eine reine (historische) Aufdeckung reduzieren, deren Kraft sich durch die Entblößung der Werte selbst generiert. Sondern die Genealogie Nietzsches ist da kritisch, wo sie in den Entstehungsherd nach anderen Anfängen sucht, wo sie versucht der Vergangenheit eine andere Zukunft zu entlocken. Und macht Adorno nicht genau dasselbe, wenn er die Umschlagpunkte in der Geschichte sucht, an der die Rationalität sich selbst übergeht und verrät, um einen anderen Anfang der Moderne zu finden – oder den Anfang der Moderne überhaupt. Vgl. Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Fischer: Frankfurt am Main 2011, S.10.
[657] Vgl. Artaud, Antonin: Schluß mit dem Gottesgericht. Matthes & Seitz: München 1993.
[658] Statt der terra incognita, die sich Deleuze wünscht. Vgl. Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, S.177.
[659] Vgl. Heidegger, Martin: Vorträge und Aufsätze. Gesamtausgabe Bd.7. Klostermann: Frankfurt am Main 2000, S.36.
[660] In gewisser Hinsicht, ist es die gleiche Einsicht, die sich in der analytischen Tradition zum einen an die Theorie der Sprachakte Austins, zum anderen aber auch in Konsequenz des Problems des Regelfolgens bei Wittgenstein ergibt. Am deutlichsten ist die Position bei Grice, der die Regeln der Sprache durch den Gebrauch definiert, der ihre Regeln erst hervorbringt und sie doch verwenden muss. Vgl. Grice, Herbert P.: Studies in the way of words. Harvard University Press: Cambridge, 1989.
[661] Vgl. Guattari, Félix: Die drei Ökologien. Passagen-Verl: Wien 1994, S.13.
[662] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.690.
[663] Derrida war bestenfalls skeptisch gegenüber dem Begriff der Maschine bei Deleuze: Vgl. Derrida, Jacques: Jedes Mal einzigartig, das Ende der Welt. Passagen-Verl: Wien 2007, S.239. Jedoch bemerkt auch Derrida, dass es gerade die Maschinen sind, die schon immer und ohne Verstellung allein durch das Prinzip der Wiederholung arbeiteten. Vgl. Derrida, Jacques: Without alibi. Stanford University Press: Stanford 2002, S.72.
[664] Dieter Mersch sieht im Begriff des Kanals einen der Grundbegriffe der Moderne: Vgl. Mersch, Dieter: Ordo ab chao – order from noise. Diaphanes: Zürich 2013, S.23.
[665] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.12.
[666] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Anti-Ödipus, S.14.
[667] Land, Nick: Fanged Noumena. Collected writings 1987-2007. Urbanomic: Windsor Quarry 2012, S.283.
[668] Vgl. Pickering, Andrew: Kybernetik und neue Ontologien. Merve: Berlin 2007, S.109
[669] aaO.S. 95
[670] Norbert Wiener spricht sogar von „einer der größten philosophischen Beiträge der heutigen Zeit“ (Vgl. Wiener, Norbert: The human use of human beings. Cybernetics and society. Avon Books 1967, S.54.) Das Problem mit Ashbys Maschine ist natürlich, dass – auch wenn sie sich selbst immer verändert – noch auf einem Bauplan beruht, der sie dazu bringt, sich immer wieder ein Gleichgewicht zu suchen. Was wäre aber eine solche Maschine, die sich gleichzeitig selbst vom Gleichgewicht wegbringt?
[671] Hierin unterscheidet sich Ashby vielleicht auch noch von Beer und Pask, da Beer ausdrücklich betont, dass Systeme immer eine unberechenbare und irreduzible Offenheit besitzen (Vgl. Beer, Stafford: Kybernetik und Managment. Fischer-Verlag: Frankfurt am Main 1967.) während Ashby viel eher darauf besteht, alle möglichen Konfigurationen einer Maschine bestimmen zu können. Vgl. Ashby, Ross: Einführung in die Kybernetik. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1985, S.18.
[672] Es ist vor allem das Verdienst Andrew Pickerings Deleuze bereits mit den Kybernetikern zu konfrontieren, jedoch nicht unter diesem Namen und noch nicht ontologisch fundiert genug. Über Deleuze und die Kybernetiker wäre noch zu schreiben.
[673] Vgl. Günther, Gotthard: Das Bewusstsein der Maschinen. Eine Metaphysik der Kybernetik. Agis-Verl: Krefeld 1963, S.47.
[674] Es ist erstaunlicher Weise Žižek, der diese transzendentale Verbindung von Mensch mit/als Maschine im Deleuzeschen Sinne sieht. Vgl. Žižek, Slavoj: Die politische Suspension des Ethischen. Suhrkamp: Frankfurt am Main 2005, S.129.
[675] Deleuze, Gilles / Guattari, Félix: Tausend Plateaus, S.195.
[676] aaO. S.569.
[677] Es ist eben dieses Prinzip, das auch den ungebremsten Vitalismus Rosi Braidottis aussetzt, der nur die Befreiung von den Organisationen fordert, ohne ein Prinzip der Steuerung oder Reterritorialisierung. Besonders in politischer Hinsicht ist diese Ansicht problematisch, wenn nicht gefährlich, wie auch Marin Saar bemerkt: Saar, Martin: Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza. Suhrkamp: Berlin 2013, S.133.
[678] Vgl. Jullien, François: Sein Leben nähren. Abseits vom Glück. Merve-Verl: Berlin 2006, S.16f.